
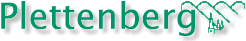
|
| Plettenberger Schulen |
| Folgende Schul-Chroniken werden derzeit bzw. in absehbarer Zeit im Rahmen des Plettenberg-Lexikons angeboten: |
|
Quelle: "Aus der Geschichte der Gemeinden Plettenberg, Ohle und
Herscheid nach vielen Quellen", P. D. Frommann, 1927, S. 167 ff.
Vom Schulwesen
Seit der Durchführung der allgemeinen Schulpflicht machte sich die
weite Entfernung mancher Gehöfte von den Kirchorten unangenehm
bemerkbar. Das begünstigte die Einrichtung von Winkelschulen in
entlegenen Ortschaften. 1811 beschäftigte sich der Tagelöhner K. D.
Hügel mit dem Unterricht der Jugend zu Selscheid im Buchstabieren
und Lesen. 1815 war eine Winkelschule zu Warbollen, in die auch
nach Ohle schulpflichtige Kinder, sogar aus Grimminghausen und
Selscheid, gingen. 1816 bestanden Winkelschulen in Bubbecke,
Hüinghausen und Reblin, in denen "unwissende Leute den Kindern
wöchentlich für 2 Stüber Unterricht gaben."
Um solchen Übelständen abzuhelfen, schritt die Regierung nach den
Befreiungskriegen [1813-1815] rührig zur Gründung von Bauerschaftsschulen.
Die von 1806-1818 geführten umständlichen Verhandlungen über die
anzulegenden Bauerschaftsschulen zeigen, dass jedes Dorf eine eigene
Schule haben wollte, ohne die dazu erforderlichen Opfer auf sich zu
nehmen. Am schwersten wurde es Holthausen und Eiringhausen, sich in
die neuen Verhältnisse zu finden und auf eine eigene Schule zu
verzichten. In Plettenberg scheute Pastor Schlieper "keine Mühe,
kein Schreiben, Rennen und laufen in der frohen Hoffnung, dass alle
seine Bauern nun Lesen, Schreiben und Rechnen lernen würden."
Zunächst wurde im Amte Plettenberg in jedem der vier Täler nur eine
Schule eingerichtet. Die Schülerzahl betrug in Landemert 49, im
Oestertale 83, im Elsetal 83 und im Lennetal 94. - In der Gemeinde
Herscheid entstanden einklassige Schulen in Schönebecke, Elsen und
auf der Höh.
Es hielt schwer, für so viele neue Stellen auf einmal geeignete Lehrer
zu finden. Wissenschaftliche Bildung durfte von ihnen nicht verlangt
werden. Man war zufrieden, wenn sie gut schrieben, rechneten und in
der deutschen Grammatik nicht unerfahren waren. Unterricht wurde
erteilt in Katechismus, biblische Geschichte, Lesen, Schreiben und
Rechnen. 1826 zeigte sich bei einer Prüfung, dass die Kinder in allen
vier Bauerschaftsschulen der Gemeinde Plettenberg nicht weit gefördert
waren. Die Schuld daran trugen der unregelmäßige Schulbesuch und die
Sorgen der Lehrer, denen manche Familien das Schulgeld vorenthielten.
Die neuen Lehrer an den Bauerschaftsschulen suchten sich mit Eifer
in ihrem neuen Berufe zu vervollkommnen und erhielten hierzu allerlei
Anregungen von den aus dem Soester Seminar hervorgegangenen besser
vorgebildeten Lehrern.
1843 urteilte der Plettenberger Chronist Hölterhof über die dortige
lutherische Schule, "dass dieselbe die gewöhnlichen Anforderungen
an eine Elementarschule nicht überraget." Wie sehr sich aber das
Schulwesen infolge der vielen Schulen und des regen Schulbesuchs,
an den sich auch die Mädchen gewöhnen mussten, hob, soll nur an
drei Schulen gezeigt werden. 1835 rechneten die Kinder der Bremcker
Schule in dicken Tagebüchern mit Hilfe der Gänsefeder sauber und
richtig Aufgaben aus der Regeldetri (Dreisatz) mit ganzen Zahlen, der Bruchrechnung
und die Regeldetri mit Brüchen bis zu schwierigen Fällen. 1840
leisteten Schüler des Lehrers Rentrop zu Elsen Vorzügliches im
Schönschreiben, in Geschäftsaufsätzen und der Anfertigung großartiger
Kohlezeichnungen. Er erteilte nebenher auch Unterricht im Klavier
und Flötenspielen und bereitete junge Männer zum Eintritt in das
Seminar vor. Lehrer Rötelmann in Ohle ließ auch Geschäftsaufsätze
in hervorragender Schönschrift anfertigen. Er lehrte schon etwas
vaterländische Geschichte und Erdkunde unter besonderer Berücksichtigung
der Gemeinde Ohle und ließ Karten mit Wasserfarbe zeichnen.
Erklärungen oft vorkommender Fremdwörter wurden ins Heft geschrieben
und fähige Knaben angeleitet, allerlei Schreiben an Behörden,
sogar Protokolle über Gemeinderatssitzungen zu entwerfen.
Über die äußeren Verhältnisse der einzelnen Schulen gibt
nachstehende Zusammenstellung Auskunft (Quelle: v. Holzbrinck,
Statistik des Kreises Altena 1866):
Quelle: Bericht über die Verwaltung und den Stand der
Gemeindeangelegenheiten der Stadt Plettenberg für die Zeit vom
1. April 1905 bis 31. März 1906; 1907, S. 4-6
Das Schulwesen in Plettenberg
Mittelschullehrer Ernst Weimann
Wenn wir über das Schulwesen in unserer engeren Heimat in alter Zeit
berichten wollen, so liegt es dabei auf der Hand, dass es sich dann
wohl nur um jene Bildungsanstalt handeln kann, welche allen Menschen,
ohne Unterschied des Geschlechts, des Standes und des künftigen Berufs
diejenigen Elemente intellektueller und religiös-sittlicher Bildung
aneignen will, auf welche jeder Mensch als solcher Anspruch hat und
erheben darf: wir meinen die Volksschule.
Ein Volksschulwesen wird sich aber nur da ausgestalten können, wo
eine humane Weltanschauung herschend ist, wo die unveräußerlichen
Menschenrechte eines jeden als solche anerkannt werden und insonderheit
jedem Menschen ein gewisses Anrecht auf geistige Bildung zugesprochen
wird.
Wenn nun auch das Christentum zuerst den Geist wahrer Humanität offenbarte,
so hat es doch nicht sofort ein fertiges Volksschulwesen ins Leben gerufen;
viemehr hat sich dich christliche Volksschule nur sehr allmählich
ausgestaltet. Und so können wir wohl mit Recht annehmen, dass, wie das
ganze christliche Mittelalter bis hin zur Zeit der Reformation nur dürftige
Ansätze zu einem Volksschulwesen aufzuweisen hat, auch in unserer
Vaterstadt, die doch gerade in alter Zeit etwas abseits von den großen
Heer- und Verkehrsstraßen lag, die Volksjugend im Mittelalter eines
Schulunterrichts nicht teilhaftig wurde, dass vielmehr, wenigstens bis
zur Reformation, in unseren Bergen die Masse des Volkes fast ohne
alle Bildung aufwuchs.
Da begann im Jahre 1517 Dr. M. Luther um des Gewissens willen das große
Werk der Kirchenverbesserung: die Reformation verlegte den Schwerpunkt
der christlichen Religion wieder in das Innere, in die Gesinnung des
Menschen, pflanzte im notwendigen Zusammenhange mit dem Grundsatz vom
allgemeinen Priestertum zugleich das Panier einer allgemeinen Volksbildung
auf und forderte ein Volksschulwesen im eigentlichen Sinne des Wortes.
In jener Zeit also, in der ein neuer Völkerfrühling den deutschen Landen
erblühte, in jenen Tagen, als der Vikar Johann Stödter, ein geborener
Plettenberger, in unserer Lambertuskirche das lautere Evangelium verkündete
- es war wohl zuerst im Jahre 1580 - erst da hat man es auch wohl hier als
eine Gewissenspflicht angesehen, die Unwissenden zu unterweisen.
Nur darf man sich nicht vorstellen, als hätte man schon damals alle die
Ziele vor Augen gehabt, welche das moderne Schulwesen sich gestellt hat.
Gleichwohl aber blieben die Bedürfnisse des ganzen Volkes nicht vergessen;
und was für alle das Wichtigste war, - die reine Lehre des Evangeliums -
das sollte den Geringsten und Ärmsten ebenso zugänglich werden wie den
höheren Ständen.
Wie sich freilich die Unterweisung in den deutschen Schreib- und
Rechenschulen, in den Lateinschulen und ähnlichen Instituten damaliger
Zeit speziell in unserer Gemeinde im Einzelnen gestaltete, darüber kann
man nur Vermutungen anstellen, denn keine Ortschronik meldet uns darüber,
und der Stadtsekretär Freydag Adam Hammerschmidt, zugleich notarius
publicis und Schulmeister, hat auf der inneren Seite des 1725 neu
angelegten Polizei-Protokollbuches vermerkt, dass er nur wenige Akten
und Dokumente habe retten können bei dem am 12. April desselben Jahres
stattgefundenen großen Brandes, und dass auch "die Briefe für die Kirche
und Schule mit verbrannt seien". So sind also alle Nachrichten, die das
Plettenberger Schulwesen anbetreffen, so weit sie auf sicherer Basis
ruhen, verhältnismäßig ganz jüngeren Datums.
Nachdem in dem Zeitalter der Reformation ein rechtes Volksschulwesen in
unserer Gemeinde wohl soeben die ersten Wurzeln zu schlagen begonnen hatte,
brach das unsägliche Elend des dreißigjährigen Krieges über Deutschland
herein und zerknickte wohl auch hier, wie alle Blüten des geistigen
Lebens, so auch die ersten schwachen Schößlinge der Volksschule. Mehrere
Male wurde Plettenberg durch feindliche Horden geplündert, und so fand
sich in unserer Stadt am Ende des fürchterlichen Krieges wohl keine Spur
von einer Volksschule mehr.
Der Wiederaufrichtung derselben aber stellten sich nach dem Kriege große
Hindernisse in den Weg: die Behörden mussten zunächst ihre ganze
Aufmerksamkeit der Beseitigung des materiellen Elends sowie der
Wiederherstellung der staatlichen und kirchlichen Ordnung zuwenden und
konnten dem Volksschulwesen eine spezielle Fürsorge nicht widmen, zudem
zeigte das Volk, völlig verarmt und verwildert, keine Neigung, zur
Errichtung von Volksschulen beizutragen; auch gab es brauchbare Lehrer
infolge der allgemeinen Verwilderung sowie der Entvölkerung des deutschen
Landes jetzt noch weniger als in früheren Jahrhunderten.
Auch in Plettenberg hatte sich die evangelische Gemeinde in Lutheraner
und Reformierte gespalten, die sich leider gegenseitig bekämpften, bis
1660 zwei besondere Gemeinden gebildet wurden. Die lutherische Gemeinde,
welche bis zur Vereinigung im Juni 1851 die größere blieb, hatte 2
Geistliche, bis 1809 Pfarrer Schlieper die Verwaltung der Gemeinde allein
übernahm. Wieviele und welche Lehrer aber die beiden Gemeinden bis zum
Jahre 1800 etwa gehabt haben, das lässt sich an der Hand der dürftigen Akten
nur ganz lückenhaft feststellen.
Sehr interessant ist übrigens, was der obengenannte Pfarrer Schlieper, der
im übrigen ein guter Lehrerfreund und Lehrerbildner gewesen zu sein scheint,
in einem Bericht schreibt: "Man mietet einen Schulhalter für die Wintermonate
und verschafft ihm einen Wandertisch bei einem Eingesessenen und Logis;
jeden Winter einen anderen. Schule und Schäferwohnung in einem Gebäude. Der
gegenwärtige Lehrer ist Peter Glingener. In Hinsicht seines Verstandes fehlt
es an allen Kenntnissen. Weil sich gerade keiner meldete, der wohlfeiler
unterrichten wollte, dann, weil ihm das Haus, worin die Schulstube ist, gehört,
darum hat man ihn zum Schulhalter ernannt. In Hinsicht seines Willens kann
ich ihn nicht beurteilen."
Erinnern uns diese Worte nicht so recht an den 10. Satz in der Principia
regulativa Friedrich Wilhelms I. aus dem Jahre 1736, der heißt: "Ist der
Schulmeister ein Handwerker, kann er sich schon ernähren, ist er keiner, wird
ihm erlaubt, in der Ernte sechs Wochen auf Tagelohn zu gehen."? Freilich
beziehen sich obige Worte auf die Schulen der Amtsgemeinde. Ob es aber zu
damaliger Zeit in der Stadt besser gewesen ist?
Die reformierte Schule mag wohl etwas besser dagestanden haben. Zählte doch
die reformierte Gemeinde hierorts 1843 im ganzen nur 250 Seelen gegen 2000
Lutheraner, so dass die reformierten Prediger auch wohl Muße fanden, sich
des Schulunterrichts anzunehmen.
Wie stand es aber mit der lutherischen Gemeinde? Da musste z. B. der oben
genannte Magistratssekretär, der zugleich notarius publicus war, Freitag
(Freydag) Adam Hammerschmidt, von 1695-1740 auch noch so nebenbei das Amt eines
Schulmeisters versehen. Viele Eltern waren ihrer schulpflichtigen Kinder bei
häuslichen Verrichtungen benötigt. Sie mussten ihnen helfen, bei der Nadelfabrikation,
Tuchmacherei und Wollspinnerei die Kosten für den Unterhalt der Familie zu
erwerben. Dadurch entstand natürlich ein ganz unregelmäßiger Schulbesuch und
für den Lehrer der Nachteil einer Zerstückelung seiner Kräfte und seiner Zeit.
Seit 1838 waren nun bei der lutherischen Schule zwei Lehrer angestellt, während
die reformierte bei einer naturgemäß weit geringeren Schülerzahl einklassig - nicht
zu ihrem Vorteil - war. Der lutherische Lehrer hatte bis dahin einen Gehilfen
gehalten. Wenn wir nun im Folgenden Einzelheiten berichten werden, so folgen wir dabei vorzugsweise den übersichtlichen Ausführungen der "Chronik der evangelischen
Schule zu Plettenberg".
Im Jahre 1805 hatte die lutherische Schule 208 zugehörige Schüler und 221
Haushaltungen, von welch' ersteren jedoch aus den oben angeführten Gründen nur
91 die Schule besuchten, die reformierte Schule dagegen hatte 44 zugehörige Schüler
aus 57 Haushaltungen, während aber 67 Kinder die Schule besuchten.
a) von Gebäuden Rthlr. Sgr. Pf.
Bei der reformierten Schule setzten sich die Schulrevenüen folgendermaßen zusammen:
a) aus der Wohnung 15 Rthlr. - Sgr. - Pf.
Aus diesen Mitteln erhielt der erste Lehrer die Revenüen von den Grundstücken, die Zinsen,
Pächte und Erbpächte, die Realprästationen und zufälligen Einnahmen und als Zuschuss aus
dem Schulgelde jährlich 76 Rthlr. 27 Sgr. 8 Pf. Der zweite Lehrer erhielt ein Fixum von
120 Rthlr. Übrigens waren Prediger und Lehrer, wie die Schulakten des Bürgermeisters J.
H. Dulheuer aus dem Jahre 1805 beweisen, damit beauftragt, tabellarische Nachrichten von
der Schulverfassung und die Schulkataloge aufzustellen und dann das Schulgeld darnach von
den einzelnen Haushaltungen selbst einzuziehen, was nach oben angeführten Akten dem
Prediger Kleinschmidt und den Schullehrern Heller und Gregory keine geringe Mühe verursacht
haben dürfte.
Das Schulhaus der reformierten Gemeinde diente zugleich dem Lehrer zur Wohnung und
gewährte für die Schülerzahl ausreichend Raum. Das Haus ist noch jetzt unter dem Namen
"reformierte Schule" bekannt und in der Friedrichstraße der Herberge gegenüber gelegen.
58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |