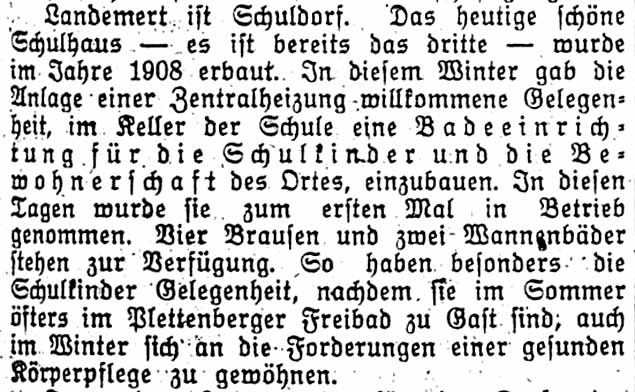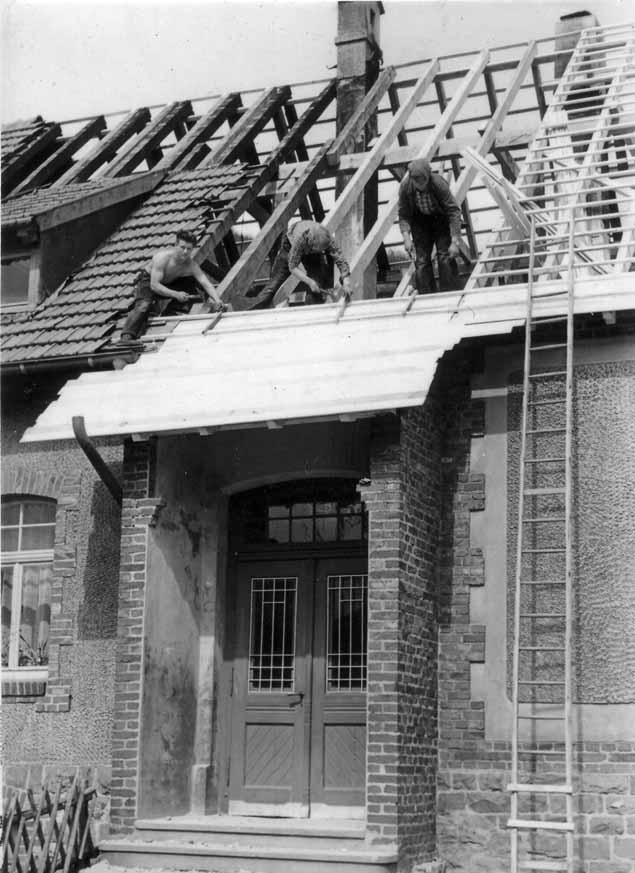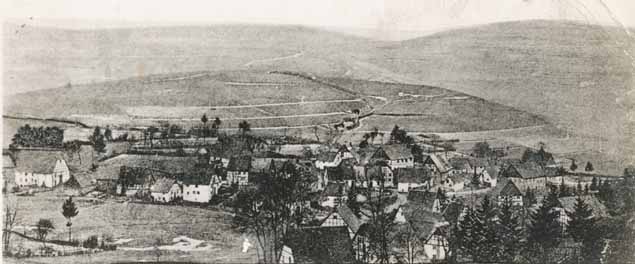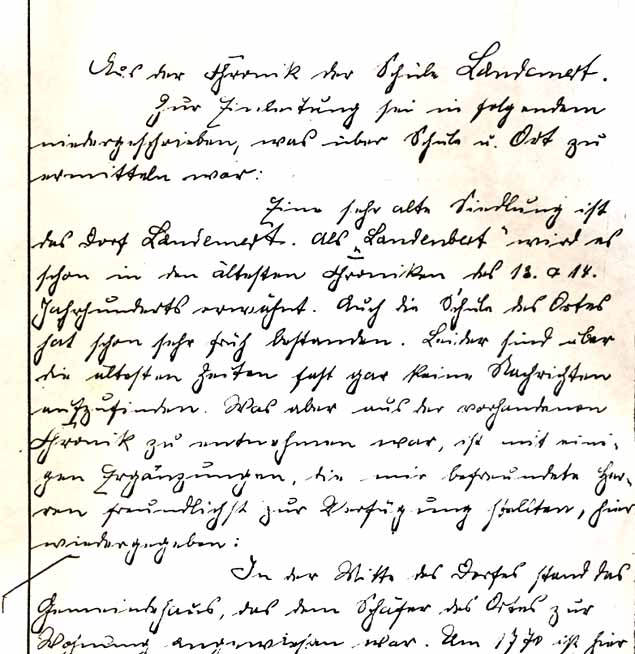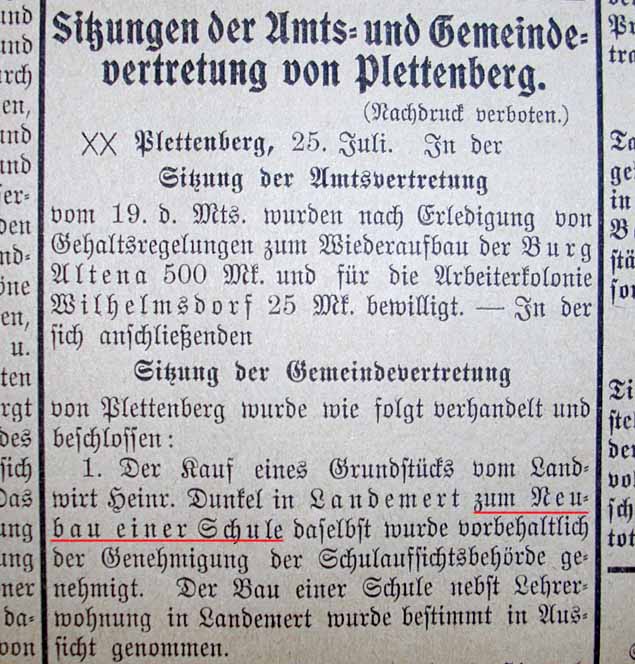|
Seit 1797 hält man Schule in Landemert
Von 1797-1818 existierte eine Winkelschule (Privatschule, Unterricht nur im Winter),
das Schulzimmer war eine Stube der Schäferwohnung; erste Lehrer waren Maul (Düsseldorf),
Sänger (Siegen), Fink (Elberfeld) und Arnold Gregory (Plettenberg). 1819 Umwandlung in eine öffentliche
Schule; Lehrer: Christian Schauerte (1827-), Kiel (Laasphe), Weber (aus Heed/Meinerzhgn.,
1854-1860), Schneider, Reichmann (1864-1875); 1825 erster Schulbau, an das Gebäude wurde
1877 ein Saal für 100 Kinder angebaut, in dem ab 28.06.1877 Unterricht gehalten wurde.
1908/1909 Neubau der Schule am Ortseingang; 07.09.1963 Einweihung der neuen Schule
Landemert - das Bild in der Eingangshalle schuf Prof. Hermann Hundt, Düsseldorf, Studienrat
Knobloch schuf ein Mosaik für das Lehrerwohnhaus; am 16.11.1974 wurde die umgebaute Schule
als Feuerwehr-Gerätehaus eingeweiht;
Quelle: Stadtchronik Albrecht v. Schwartzen, Januar 1959
Am 12. Januar 1959 brach im Gebäude der Landemerter Schule ein Brand aus. Ausgehend
von einem Bodenzimmer verbreitete sich das Feuer bald im ganzen Raum, griff auf das
Nebenzimmer über. Die Zimmer brannten völlig aus. Auch der Dachstuhl wurde ein Opfer
der Flammen. Gebäudeschaden etwa 7.000 DM, Sachschaden etwa 3.000 DM.
Schulraum in Landemert bot
Thema: Die letzten Kriegstage in Plettenberg
Der Schulbetrieb in der Zeit des Zusammenbruchs
Im Februar und März wurde nur stundenweise unterrichtet; in der Hauptsache wurden nur die Schularbeiten
nachgesehen und neue aufgegeben, da den Kindern ein längerer Aufenthalt im ungeheizten Schulraum nicht
zugemutet werden konnte.
In der Nacht vom 11. zum 12. April wurde durch Granatwerferfeuer vor allem das Dach der Schule
beschädigt; auch wurden fast alle Scheiben zertrümmert. Auch die Schulbänke, die während der
Einquartierung von deutschen Soldaten auf den Dachboden gebracht worden waren, erlitten allerlei
Beschädigungen. Am 12. April gegen 3.00 Uhr besetzten die amerikanischen Truppen unser Dorf. Der
Schulraum, der bis dahin ununterbrochen von ständig wechselnden deutschen Truppeneinheiten benutzt
wurde, bot ein wüstes Durcheinander von Stroh, weggeworfener zerlumpter Wäsche, allerlei Zubehör
von Truppenausrüstung. Landkarten waren zu Verdunkelungszwecken benutzt worden. Die Lehrmittelschränke
waren zerbrochen, mit den Lehrmitteln allerlei Unfug angestellt worden.
Die amerikanischen Truppen schauderten davor zurück, diesen Raum zu benutzen. Sie interessierten
sich jedoch für die Dienstwohnung des Lehrers, die sie mehrere Male als Quartier benutzten. Im
Mai mußte die Familie des Lehrers die Wohnung für einige Tage ganz räumen. Ein abenteuerlicher
Weg führte den Lehrer Gödde aus dem bereits von den Russen eingeschlossenen Breslau in den Tagen
des Zusammenbruchs nach Landemert zurück. Als ein Befehl der Militär-Regierung verlangte, daß
alle ehemaligen Angehörigen der Deutschen Wehrmacht sich bei der amerikanischen Militärpolizei
meldeten, kam er diesem Befehl nach und geriet auf diese Weise noch in Gefangenschaft. Auf Befehl
der Militär-Regierung blieben alle Schulen vorläufig geschlossen. Alle Lehrpersonen wurden zum
1. Juni 1945 von ihrem Amt suspendiert. Das Schulwesen sollte ganz neu aufgebaut werden.
Quelle: Schulchronik der Schule Landemert, 134 Seiten (Kopie im Archiv H. Hassel);
von der Urschrift übertragen im Oktober 2009 durch Horst Hassel
Aus der Chronik der Schule Landemert
Zur Einleitung sei in folgendem niedergeschrieben, was über Schule
und Ort zu ermitteln war:
Eine sehr alte Siedlung ist das Dorf Landemert. Als "Landenbert" wird
es schon in den ältesten Chroniken des 13. und 14. Jahrhunderts erwähnt.
Auch die Schule des Ortes hat schon sehr früh bestanden. Leider sind
über die ältesten Zeiten fast gar keine Nachrichten aufzufinden. Was
aber aus der vorhandenen Chronik zu entnehmen war, ist mit einigen
Ergänzungen, die mir befreundete Herren freundlichst zur Verfügung
stellten, hier niedergeschrieben:
In der Mitte des Dorfes stand das Gemeindehaus, das dem Schäfer des
Ortes zur Wohnung angewiesen war. Um 1770 ist hier das Zimmer "rechts
vom Eingang zur Schule gemacht worden". Die Einrichtung desselben war
sehr einfach. Ein Tisch, mit Bänken umgeben, ein Ofen und ein Stuhl
für den Lehrer füllten den Raum. Der Unterrichtsstoff dieser Zeit war
Religion, Rechnen, Lesen und Schreiben. Am Rechnen beteiligten sich
nur die ...... Die Schulbildung der ersten Lehrer soll sehr mangelhaft
gewesen sein. "Die waren vielfach zu keiner anderen Arbeit tauglich".
Es wurde nur im Winter Schule gehalten. Als Lohn bekamen die Lehrer
neben dem Wandertische täglich 7 1/2 Stüber. Die Pfarrer überwachten
den Unterricht. Sie sorgten sehr für die weitere Ausbildung der Lahrer.
Genannt werden die Pastoren Dümpelmann, Bode, Schlieper und Paffrath.
Der Prüfer in externis war der Freiherr von Plettenberg zu Schwarzenberg.
Er hat die hiesige Schule oft besucht.
Bis zum Jahre 1807 wurden folgende Lehrer genannt:
Im Jahre 1807 gab es 49 schulpflichtige Kinder. Dabei ist zu bemerken,
dass zur hiesigen Schulgemeinde auch die Orte Baukmecke, Dormecke,
Almecke, Sonneborn und Helfenstein gehörten.
Ein Übelstand für die Schulen war es auch, dass für den Lehrer keine
Wohnung da war. Über den baulichen Zustand der Schule heißt es in
einem Bericht aus dem Jahre 1809: "Das Schulhaus zu Landemert ist
baufällig und sehr klein. Es sind höchsten einige Stämme davon zu
gebrauchen." Nach einiger Zeit wurde dann auch der Bau einer neuen
Schule beschlossen. Zu erwähnen ist noch, dass Landemert zu dieser
Zeit die Glocke bekommen hat, die heute noch im Schulturm hängt.
Sie hat folgende Inschrift: "Johann Hendrich Schauerte gen.
Hinschemann Vorsteher; Johann Dietrich Schauerte Landemert. Nicolaus
Bernhard von Diefenbach goß mich i. 77 an."
Landemert war wohl ein großes Dorf, aber die Bewohner waren arm.
Pastor Schlieper schrieb am 6.4.1818: "Landemert ist eines der größten
aber auch ärmsten Dörfer meiner Gemeinde." Er schlägt zu Schulvorstehern
vor: den Kirchmeister Schauerte gen. Hinschemann zu Landemert u. den
Landwirt Peter Frommann in der Almecke. Auf diesen Vorschlag hin
wurden die vorgeschlagenen Väter zu Schulvorstehern ernannt.
Zu dieser Zeit hatte die Schule 88 Schüler. An dieser Zahl waren
beteiligt: Landemert mit 66, Almecke und Sonneborn mit 19, Berenberg
und Huemberg mit 3 Kindern. Der Pastor Schlieper sollte in dieser Zeit
geeignete junge Männer zu Lehrern für die einzelnen Schulen vorschlagen.
Da berichtete er am 28.6.1818, "für Landemert wisse er keinen, der
jetzige sei erst 17-18 Jahre alt u. noch weit zurück." Es muss dies
der spätere Lehrer Peter Wilhelm Plankemann aus Herscheid gewesen
sein, denn am 24.9.1819 wünschte Christian Schauerte den P. W.
Plankemann bis Mai 1820 zu behalten. Christian Schauerte ist der
erste geprüfte Lehrer der hiesigen Schule gewesen.
Der bauliche Zustand der Schule war nun so schlecht geworden, dass
man im Jahre 1825 ein neues Schulhaus baute. In diesem Jahre wurde
"keine Schule gehalten". Über diesen Neubau der Schule schreibt ein
Bericht des Kreisschulinspektors Pastor Re...ler - Werdohl an die
Regierung. Es heißt, er habe zu seiner Freude in Landemert eine
neue, gar nicht unzweckmäßig eingerichtete Schule gefunden u. bitte
die Regierung, etwas für Lehrmittel und Utensilien zu bewilligen.
Im Jahre 1825 brannte Landemert fast ganz ab. Die Bauerschaften
Landemert, Berg u. Himmelmert hatten nur eine Feuerspritze. Da diese
gerade in Himmelmert war, so konnte man dem Feuer nicht entgegentreten.
Leider kam dabei der 6jährige Sohn der Familie Greil (jetzt Meister'sches
Haus Muth) zu Tode. Der oben erwähnte Lehrer Schauerte heiratete die
Maria Katharina Kettelhage von hier und verwaltete die hiesige Schule
bis Januar 1848.
Außer den obigen Ergänzungen zu der alten Niederschrift gelang es
dem Lehrer Wilhelm Schäfer, noch einiges aus der Geschichte Landemerts
zu vermitteln.
Im Laufe der kommenden Jahrhunderte wurden einzelne Besitzungen und
Höfe an die Kirche oder wohltätige Anstalten verschenkt. Denen
mussten auch die Abgaben geleistet werden. Diese Abgaben blieben
bis zum Jahre 1850 bestehen. Die Abgaben, die nicht in Naturalien
bestanden, wurden durch Zahlung des 18fachen Betrages abgelöst.
Die Bauern mussten einen Zins zur Unterhaltung des Predigers
abliefern. Im Jahre 1682 lieferten 12 Viertel Hafer die Bauern:
Peter aufm Brinke, Schawert (wahrscheinlich d. heutige Schauerte),
Brösecke, Kesebrink, Schulte, Hellweg (heute Hollweg), Kettelhake,
Fischer, Schnepper und Kampe.
Im Jahre 1818 waren in Landemert 25 Erbpächter u. 1 Zeitpächter.
Der Pächter Kampmann musste in diesem Jahre an die Kirche zu
Plettenberg 1 Pfund Wachs abgeben. Schnepper besaß ein Gut des
sogenannten Armenhospitals der Boeler Kapelle. Er gab dafür ab:
1 Schwein, 6 Rtlr. u. 2 Hühner, außerdem musste er noch an zwei
Tagen mit je zwei Pferden dem Armenhospital zur Verfügung stehen.
Arnold Hollweg besaß laut Erbpachtvertrag vom 27.07.1808 vom
Armenhospital ein Gut von 83 Morgen Wiese und Ackerland und
128 Morgen Berge. Die Abgabe bestand in 25 Zentner Holzkohlen,
die zum Besten der Armen verkauft wurden. Dem Hollweg passte
das Abhängigkeitsverhältnis nicht. Er wollte freier Herr über
Grund und Boden sein, wollte diese Abgabe auskaufen. Im Jahre
1831 setzte er sich dieserhalb mit dem Re.......tum des Boeler
Armenshospitals in Verbindung. Es kam ein Vertrag zustande,
wonach er für 481 Tlr. 11 Sgr. u. 8 Pfg. die gutsherrlichen
Rechte bekam.
Der Freiherr von Plettenberg hatte auch noch gutsherrliche
Rechte in Landemert, die jedoch viel höher waren. So musste
Kaemper jährlich 12 Rtlr. 1 Schwein u. 10 Pfund Butter abliefern.
Außerdem musste er an 8 Tagen dem Freiherrn v. Plettenberg
zur Verfügung stehen. Brinkermann von diesem seine Abgaben,
3 Fuder Holzkohlen, für 40 Tlr. aus. Im Jahre 1850 wurden
alle gutsherrlichen Rechte durch einmalige Auszahlung abgelöst.
Ehedem stand in Landemert eine Kapelle, die dem heiligen Anton
geweiht war. Sie ist aber schon weit länger als 200 Jahre
zerfallen. Die Glocke, die in einem Gestell (....l) untergebracht
war, wurde noch weiter geläutet. Die aus Stiftungen stammenden
Einkünfte der Kapelle wurden nun unter den Armen verteilt.
An das Vorhandensein dieses Kirchlein erinnert nur noch der
"Kiärkhuof". Hier sollen auch Beerdigungen stattgefunden haben.
Landemert war früher das größte Dorf in der Gemeinde Plettenberg.
Nach Angaben des Vorstehers Kesebrink standen 1817 hier
33 Wohnhäuser u. 19 Stall- und Nebengebäude. Davon waren
25 Gebäude ganz aus Holz und sämtliche Häuser (52) mit Stroh
gedeckt. Die Zahl der Bewohner betrug 265. Unter ihnen waren
vier Schuhmacher, 1 Zimmermann, 1 Schneider und 1 Drechsler.
An Vieh waren vorhanden: 12 Pferde, 1 Bulle, 5 Ochsen, 72 Kühe,
37 Jungvieh, 56 Schafe, 20 Ziegen u. 27 Schweine.
Die Landwirtschaft war die Erwerbsquelle der Bewohner unseres
Ortes. Schon in alter Zeit wandte man sich auch der Erzgewinnung
zu. Davon zeugt noch die Bezeichnung "Schmelzhütte". Beim
Neubau des Weges nach Plettenberg wurde in der Wiese des
Heveschotten ein alter Röstofen freigelegt. Jedoch war die
Ausbeute gering. Solche Schürfstellen für Erz waren noch in
der "Mark" u. am Wege nach Dormecke, Sonneborn und zwar im
Hakesbrauke und dort, wo hinter der Dormecke der Weg in die
Almecke abgeht, auf dem sogenannten "Berghause".
Um das Jahr 1751 (1731?) bestand in Landemert eine blühende
Hausindustrie. Unzählige Spinnräder wurden angefertigt, die
in alle Welt verkauft wurden. Die Landemerter Spinnräder waren
weit u. breit bekannt. Zu gleicher Zeit stand auch die
Spinnerei auf der höchsten Stufe. Im siebenjährigen Kriege
[1756-1763] soll der Ort sehr gelitten haben. Die Gewerbetätigkeit
erlahmte völlig u. ist nie wieder aufgeblüht.
In alten Zeiten sollen manchmal ernsthafte Streitigkeiten
zwischen Landemert u. dem nahen kurkölnischen Hülschotten
bestanden haben. Es handelte sich um Kämpfe um die Grenze
und das Recht der Fischerei. Mit blutigen Köpfen sollen die
Kämpfenden oft auseinander gegangen sein.
Die oben (Seite 2 - 8) erwähnten Tatsachen verdankt der
Schreiber dieser Zeilen zum Teil den Forschungen des Rektors
P. D. Frommann zu Boele bei Hagen (gen. zu Frehlinghausen)
und den Aufzeichnungen des C. W. Wever zu Plettenberg. Eine
Drucklegung der Ausführungen ist verboten.
Landemert bekommt elektrisch Licht
Immer wieder wurde dieser Wunsch laut. Da fand am 21. Januar
1927 beim Gastwirt Käsebrink eine Versammlung statt. Hierzu
waren auch die Bewohner der Bauerschaft Berg (Dormecke, Almecke,
Sonneborn, Helfenstein und Humberg) eingeladen. Vollzählig
erschienen die Hausbesitzer. Unter dem Vorsitz des Herrn Amtmann
Abel fanden die Besprechungen statt. Der Herr Ingenieur Lindner
von der "Mark" gab die fachlichen Erläuterungen. Man beschloss,
den Anschluss an die Mark zu vollführen, wenn sie finanziell
tragbar war.
Die Herren Lehrer Schäfer, Wilh. Frommann u.
Wilh. Kohlhage (Fabr.Arb.) hatten die Angelegenheit weiter
zu bearbeiten. Der Kostenanschlag ergab die Summe von 65.000
Mk. Diese Summe konnte von den Leuten nicht aufgebracht werden.
Der Lehrer Schäfer verhandelte mit dem Herrn Landrat, Geheimrat
Thomee zu Altena, als dem Mitglied des Aufsichtsrates der
"Mark". Der Herr Landrat brachte den erfreulichen Beschluss
zustande, wonach von uns nur noch 30.000 RM gefordert
wurden. Nachdem der Bürgermeister Abel weitere 5.000 RM in
Aussicht stellte, war die Anlage gesichert.
Am 14. Juni versammelten sich abermals die Bewohner von Landemert
und Umgegend. In dieser Versammlung wurden die Leistungen
der Lichtabnehmer festgelegt. Es zahlten die Bewohner der
Bauerschaft Berg je 625 RM, die Landemerter und Bauern 425,
b. Kleinbesitz 315 u. die Fabr.Arb. 210 RM. Die Firma Rasche
(Herr Adolf Hollweg) zahlte 1.300 RM. Das letzte Hindernis,
dass eine Anzahl der Leute die Gelder nicht aufbringen konnte,
beseitigte der Lehrer Schäfer durch Verhandlung mit der
Amtssparkasse. 26 Anleihen erhielten die Summe von 1.184 RM
dergestalt, dass eine gegenseitige Bürgschaft bis zum Abtrag
der ganzen Summe vereinbart wurde.
Nun konnten die Arbeiten beginnen. Die "Mark" hatte die gesamte
Anlage dem Herrn Ernst Hummel, Weidenau, übertragen. Die
Schiwerigkeiten des Setzens der Masten und der Anbringung der
Dachständer war auch bald überwunden. Schnell schritten die
Arbeiten vorwärts. Das elektr. Licht wurde endlich ein
freudig aufgenommenes Weihnachtsgeschenk. Am 15. Dezember
wurde der Strom eingeschaltet. Große Freude herrschte im
ganzen Dorf.
Am 14. Jan. 1928 wurde in der "Halle" das Lichtfest gefeiert.
Das war eine Feier, wie Landemert noch keine gesehen hatte
u. auch keine je eine begehen wird. Hierzu waren erschienen
der bereits in den Ruhestand versetzte Geheimrath Thomee,
sein Nachfolger, der Herr Landrat Graubner, und der
Bürgermeister Herr Abel. Von der "Mark" waren anwesend Herr
Direktor Annemann u. der Herr Ingenieur Lindner. Der
Hersteller der Anlage, Herr Ernst Hummel, und die Vertreter
der Presse beschlossen die Reihe der Gäste. Die Bewohner
des Ortes und der Umgebung waren vollzählig erschienen. Ein
bäuerliches Wurstessen war die erste Veranstaltung des Abends.
Nach einem Eröffnungsmarsch des Plettenberger Orchesters
sprach Frl. Auguste Kettelhake (Pauls) den vom Lehrer Schäfer
verfassten Prolog u. überreichte dem Herrn Geheimrat einen
Fliederstrauß. Ein Kuss war der Dank des Herrn Geheimrats.
Nun ergriff der Lehrer Schäfer das Wort zur Begrüßungsansprache.
Er dankte dem Herren Geheimrat für die wohlwollende Unterstützung,
die erst die Anlage möglich machte. Mit einem Hoch auf den
Lichtbringer Herrn Geheimrat Thomee schloss er seine Ausführungen.
Welche Freude, als das Orchester das Musikstück "Hopp Major"
(das Lieblingsstück des Herrn Geheimrat) spielte. In heller
Begeisterung sangen alle kräftig mit.
Die Musikvorträge des Orchesters wurden abgelöst durch plattdeutsche
Darbietungen des Herrn Lehrer Schwerter (Milspe). Ein Gedicht des
Fabrikanten A. Hollweg schilderte in unserer Mundart recht
humorvoll den Werdegang der Lichtanlage. Im weiteren Verlauf
des Abends dankte der Herr Geheimrat in seiner humorvollen
Weise für die schöne Feier. Auch der Herr Landrat Graubner dankte
für die Einladung und wünschte für seine Tätigkeit dieselbe
Harmonie zwischen sich u. den Bewohnern des Kreises zu erhalten.
Abschnitt I - Schulort und Schulgemeinde
Schuljahr 1928-1929. Die Schule Landemert gehört zum Schulverband
Plettenberg-Land. Zu diesem gehören außerdem die Schulen zu:
Sonneborn, Lettmecke, Himmelmert, Bremke, Holthausen, Eiringhausen
und Pasel. Aus unserm Orte gehört der Fabr.Arb. Wilh. Kohlhage
zum Schulvorstande. Der Lehrer unseres Ortes, Wilhelm Schäfer,
ist als Vertreter der Lehrerschaft Mitglied des Schulvorstandes.
Die hiesige Schule gehört zum Schulaufsichtsbezirk Altena, der
z. Zt. von Herrn Schulrat Bierbaum zu Altena verwaltet wird.
Schuljahr 1929-1930. Durch Neuwahl der Gemeindevertretung kam
der Fabr.Arb. Wilhelm Kohlhage, bisher Mitglied des Schulvorstandes,
in diese Bürgerschaft. Mitglied des Schulvorstandes wurde der
Fabr.Arb. Heinrich Sönnecken von hier. Gemeindevorsteher wurde
der Gastwirt Heinrich Groll aus Böddinghausen. Zum Bauerschaftsvorsteher
wurde der Waldarbeiter Wilhelm Käsebrink von hier. Der Lehrer
Wilhelm Schäfer wurde von der Lehrerschaft wieder als Vertreter
in den Schulvorstand gewählt. ..... im ..... der hiesige Bezirk
dem Herrn Oberregierungsrat Frohneberg zu Arnsberg. Er übernahm
den Bezirk Dortmund während der hiesige Bezirk dem Herrn Reg.-Rat
Dr. Müller unterstellt wurde.
Schuljahr 1930-1931. In dieses Jahr fiel die Neuwahl des Elternbeirats.
Während in den Vorjahren kein Elternbeirat gewählt worden war, wurde
in diesem Jahr die vorbereitende Versammlung von einem Teile der
Elternschaft besucht. Eine Wahlhandlung war nicht notwendig, da
nur ein Wahlvorschlag eingereicht worden war. In der ersten
Versammlung des Elternbeirats wurde der Gemeinde-Vertreter Wilhelm
Kohlhage zum Vorsitzenden und die Frau Emma Sönnecken geb. Gester
zur Schriftführerin gewählt. Die übrigen Mitglieder des Eltern-Beirats
sind Fabr.Arb. August Schauerte, Bahnbeamter Heinrich Schauerte
und Frau Käthe Göbeler.
Im Februar 1931 kam eine Änderung des Schulverbandes. Unser
Bezirk des bisherigen Gesamtschulverbandes Plettenberg-Land
wurde zum Schulverband: Sonneborn, Landemert, Pasel aus der
Gemeinde Plettenberg-Land und Therek aus der Gemeinde Schönholthausen.
In diesem Verbande gehört der Fabr. Arb. Wilhelm Kohlhage zu den
Mitgliedern des Schulvorstandes.
Schuljahr 1940. Am 1.4.1940 wurde die Schule Sonneborn geschlossen.
Die Schüler wurden teilweise der Schule Hülschotten zugewiesen, teilweise
(Dormecke) der Schule Landemert. Lehrer Gödde wurde November 1947
von der Lehrerschaft der Stadt Plettenberg als deren Vertreter
in die Stadtschuldeputation gewählt. Landemert gehört seit 1940
durch Eingemeindung zur Stadt.
Abschnitt II - Die äußere Einrichtung der Schule
Schuljahr 1928-1929. In diesem Schuljahr erkrankte
der Lehrer Wilhelm Schäfer an Gelenkrheumatismus. Nachdem
vom 31. August bis 3. September der Unterricht ausfallen
musste, trat in den Weihnachtsferien eine wesentliche
Verschlimmerung ein. Alle Glieder des Körpers waren von
dieser schmerzhaften Krankheit befallen. Vom 1. Januar 1929
musste er für längere Zeit beurlaubt werden. Die Vertretung
wurde so ge... , dass der Herr Eberg vom Sonneborn vom
28. Januar 1929 ab wöchentlich 4 Tage an der hiesigen Schule
unterrichtete.
Folge des Schulstreiks vom Dezember 1929: Lehrer Schäfers Zwangspensionierung
Schuljahr 1929-1930. Leider trat in der Erkrankung des
Lehrer Wilhelm Schäfer noch keine Besserung ein. Seine
Beurlaubung musste infolgedessen erneuert werden. Bis
Ende Juni blieb die vorjährige Regelung bestehen. Am 1. Juli
übernahm der Schulamtsbewerber Heinrich Schulte aus
Hechmecke bei Plettenberg die Vertretung. Er verließ Ende
November den hiesigen Ort, um in der Nähe von Hamm eine
andere Stelle zu übernehmen. Mit dem 1. Dezember unterrichtete
wieder der Lehrer Wilhelm Schäfer, trotzdem er noch nicht
gesund war. Es sollte die Vertretung Schulte beendigt werden.
Eine unliebsame Propaganda war von seinen Verwandten im Dorf
in Szene gesetzt. Die Folgen dieses Tuns war der Schulstreik,
der am Montag, dem 2. Dezember, ausbrach (man wollte Schulte
behalten). Der Streik dauerte vom 2. - 9. Dezember 1929.
Hohe Polizeistrafen veranlassten den Abbruch des Streiks.
Einige Männer des Ortes wurden bei der Regierung zu Arnsberg
vorstellig. Unter ihnen berichtete der Fabr.Arb. Wilh. Kohlhage
(Gemeinde-Vertreter) über die Erkrankung des Lehrers Schäfer,
die er durch seine recht zahlreichen Besuche in allen Stadien
genügend kennengelernt hatte. Daraufhin veranlasste die Regierung
die Untersuchung Schäfers durch den Kreisarzt zu Altena. Die
Folge dieser Untersuchung war, da Schäfer seine Pensionierung
nicht beantragte, die Einleitung des Verfahrens der
Zwangs-Pensionierung. Gegen diese Maßnahme protestierte der
Herr Schäfer. Vom 8. Januar 1930 ab übernahm der Schulamtsbewerber
Fritz Biermann aus Bielefeld die Vertretung.
Schuljahr 1930-1931. Kurz nach Beginn des Schuljahres -
mit dem Anfang des Schuljahres, den Osterferien, verließ der
Schulamtsbewerber unseren Ort, um an der neugegründeten "weltlichen"
Schule zu Bielefeld seine Tätigkeit zu beginnen. Zum Nachfolger
bestimmte die Regierung zu Arnsberg den Schulamtsbewerber Erich
Stiepelmann aus Heeren - Werwe, der am 25. April seinen Dienst
antrat. - Gegen den Lehrer Schäfer schwebte immer noch das
Pensionierungsverfahren. Auf Veranlassung der Regierung in Arnsberg
weilte er vom 2. - 5. Juli in der Univ. Klinik zu Münster. Hier
wurde seine Dienstunfähigkeit auf längere Zeit festgestellt.
Diese Feststellung veranlasste den Herrn Schäfer, bei der
Regierung seine Versetzung in den Ruhestand zu beantragen.
Diesem Antrag entsprach die Regierung und setzte den Beginn
des Ruhestandes mit dem 1. Dezember 1930 fest. Am 4. März
zog der Lehrer Schäfer nach Plettenberg in das Gebäude der
Ortskrankenkasse.
1937/38 (S. 78) Lehrer H. Schulte wird zum 1. April 1937
nach Ohle versetzt. Sein Nachfolger wird der Lehrer Ernst Feld,
geb. aus Othlinghausen b. Lüdenscheid, bisher angestellt in
Pelkum, Kreis Leer/Ostfriesland.
Die Schule beteiligt sich an der Feiergestaltung zum 1. Mai:
die ansonsten eintönige Feier, die hierorts nur in Musik
und Tanz besteht, wird durch die Mitwirkung der Kinder, durch
Gedichtvorträge und Lieder ausgestaltet. Fabrikant Hollweg
dankt der Schule dafür und stiftet für die Reisekasse 5 Mk.
Im Frühherbst unternimmt die Schule ihren jährlichen Ausflug.
Das Ziel ist das Siebengebirge. Mit einem Autobus der Plettenberger
Straßenbahn geht es über Herscheid zunächst zur Versesperre.
Kurze Rast und Besichtigung der Sperre. Nun folgt nach Überquerung
der Volmestraße eine wunderschöne Fahrt durch das Bergische Land.
In Gimborn wird die erste größere Rast gemacht. Durch das
Aggertal erreichen wir Siegburg und um 11 Uhr vormittags den Rhein
bei Bonn...
Der Schulbetrieb in der Zeit des Zusammenbruchs
Im Januar 1945 fiel der Unterricht total aus, teilweise wegen
Mangels an Heizmaterial, eine Folge des Luftkrieges, durch den
das Transportwesen bereits weitgehend desorganisiert war. Im
Februar und März wurde nur stundenweise unterrichtet. In der
Hauptsache wurden nur die Schularbeiten nachgesehen und neue
aufgegeben, da den Kindern ein längerer Aufenthalt in ungeheizten
Schulräumen nich zugemutet werden konnte.
Schließung der Schule
In der Nacht vom 11. zum 12. April wurde durch Granatwerferfeuer
vor allem das Dach der Schule beschädigt; auch wurden fast alle
Scheiben zerstrümmert. Auch die Schulbänke, die während der
Einquartierung von deutschen Soldaten auf den Dachboden gebracht
worden waren, erlitten allerlei Beschädigungen.
Im Jahre 1955 wurden die "mittelalterlichen" Klosetts der
Schule durch moderne sanitäre Anlagen ersetzt. Da sie bedeutend
mehr Raum beanspruchten als die früheren Anlagen, wurde der
bisherige Stallraum, der zur Dienstwohnung gehörte, mit in den
Umbau einbezogen.
Schülerzahlen von 1953 bis 1958
Im Januar 1959 entstand im Dachgeschoß der Schule ein Brand
(Ursache höchstwahrscheinlich ein Kurzschluß). Etwa die Hälfte des
Dachstuhls wurde ein Raub der Flammen, da der Brand leider sehr spät
bemerkt wurde. Da durch das Löschwasser auch die darunterliegenden
Schulräume in Mitleidenschaft gezogen wurden, auch wegen des strengen
und schneereichen Winters eine sofortige Herstellung des Daches
nicht möglich war, mußte ein behelfsmäßiger Schulraum besorgt werden.
Lehrer Gödde schlug dafür den Jugendraum in der Dorfhalle vor. Schon
am Tage nach dem Brande einigte sich die Stadtverwaltung mit der
Besitzerin der Dorfhalle, der "Dorfjugend Landemert e.V.". Schon am
gleichen Tag brachten die Schüler und Schülerinnen auf ihren
Sportschlitten Tische und Stühle in den Behelfsschulraum, so daß der
Unterricht fast ohne Unterbrechung weitergeführt werden konnte. Da
der provisorische Schulraum aber größenmäßig nicht ausreichte, mußte
in 2 Schichten unterrichtet werden. Die Wiederherstellung der Schule
zögerte sich fast bis zu den Sommerferien hin.
Die 2. Lehrerstelle
. . .
|