|
Quelle: "Aus der Geschichte der Gemeinden Plettenberg, Ohle und Herscheid
nach vielen Quellen", P. D. Frommann, 1927, S. 175
Katholische Schule Ohle
Die katholischen Kinder aus Ohle besuchten als Gastschulkinder die kath. Schule
Eiringhausen, bis Ohle am 29. August 1919 eine katholische Schule erhielt, die
zunächst mit einer Baracke beim Ohler Eisenwerk vorliebnehmen musste. Die neu
erbaute zweiklassige Schule wurde geweiht am 17. Juni 1924; die Anstellung eines
zweiten Lehrers war schon 1923 beschlossen worden.
Lehrer: Franz Köhne aus Grafschaft bei Schmallenberg, war vorher Lehrer in
Eiringhausen. Als zweite Lehrer waren seit dem 15. Oktober 1923 vertretungsweise
tätig: Stader, Pauli, Burkhardt. Angestellt war seit April 1926 der Flüchtlingslehrer
Lud. Bernhard, der auf seinen Antrag hin an die weltliche Schule in Dortmund
versetzt wurde. Seit September 1926 ist angestellt Albert Dietz aus Peine (Quelle:
Die Angaben beschaffte mir Herr Lehrer Köhne).
Schule Ohle (ehem. kath. Grundschule), wird im Oktober 1990 zum Übergangsheim für Aussiedler umgebaut.
Quelle: Schulchronik der Kath. Schule Ohle, 144 Seiten, handschriftlich;
Transkription: H. Hassel (11/2007)
Die Schulchronik ist von folgenden Lehrern geführt worden:
Inhalts-Verzeichnis
I. Der Schulort und die Schulgemeinde
II. Die äußere Einrichtung der Schule
III. Innere Einrichtung der Schule
Zeitungsausschnitte
II Die äußere Einrichtung der Schule
Stand vom 16. Juni 1948: Die Kath. Volksschule bestand vom 29. August 1919 bis zum
1. April 1939. Am 1. April 1939 wurde ihr konfessioneller Charakter aufgehoben
und mit der Evangl. Schule zur Gemeinschaftsschule vereinigt. Am 23. Januar 1947
wurde die Kath. Volksschule auf Grund einer Elternabstimmung wieder eingerichtet.
Das Schulgebäude hatte während des II. Weltkrieges (1939-1945) keine Beschädigungen
erlitten.
b Die Schulgebäude
Das Gebäude entsprach nicht im mindesten den Anforderungen, die man an einen
Unterrichtsraum stellen musste. Des Winters war es nicht möglich, den Schulraum trotz
2 aufgestellten großen Öfen zu heizen. Alle Katholiken waren froh, als endlich im
Juni 1923 der Grundstein zu dem neuen Schulgebäude gelegt wurde. Erst im Juni 1924
war dieses Gebäude zum Einzug fertig. Es besteht aus einem Kellerraum, 2 übereinliegenden
Klassenzimmern und darüber eine kleine Schuldienerwohnung. Die Länge des Gebäudes
beträgt 10.60 m. Die Schulzimmer haben folgende Ausmaße: Länge 10,60 m, Breite 6.50 m,
Höhe 3,50 m. Nach der Südseite wurde das Treppenhaus für die Schule und dahinter
nach der Ostseite das für die Familie des Schuldieners errichtet. Es hat eine Breite
von 11,45 m. Es ist so geräumig gebaut, weil es für einen evtl. Anbau gleich
ausreichen soll.
In dem 2. Stockwerke des Treppenhauses ist ein kleines Lehrmittelzimmer
in einer Größe von 3 m Länge und 3,70 m Breite eingebaut. Über dem Klassenzimmer der
I. Klasse befindet sich die Wohnung des Schuldieners. Sie besteht aus 3 Räumen: 1 Küche
3 x 4 m, 1 Schlafzimmer 4 x 5 m und einem Wohnzimmer 2 x 3 m. Dazu ist dort noch eine
Abortanlage und ein kleiner Flur. Das eigentliche Schulgebäude ist durch eine Treppe
mit der sonst in sich abgeschlossenen Wohnung verbunden. Über diesen Wohnräumen befindet
sich der Bodenraum, der als Trockenraum Verwendung finden soll.
Die Fundamente bestehen
aus Grauwacke der heimischen Steinbrüche. Wände und Kellerboden erhielten besondere
Isolierschicht gegen aufsteigendes Grundwasser bei Hochwasser. Das diese Schicht aber
in Anbetracht des schlechten Materials der hochinflationszeit seinen Zweck erfüllen
wird, ist (S. 46:) höchst zweifelhaft. Ein tiefer Sinkerschacht, der das Regen- und Spülwasser
aufnehmen soll, wurde an der Westseite, diesseits der Treppe errichtet. Da der unterste
Teil dieses Schachtes im Lennekies endet, ist wohl ein Abfluss der Abwässer gewährleistet.
Das 1. Stockwerk ist ein Massivbau, der aus Ziegelsteinen errichtet wurde. Die
Kellerdecke bildet feuersichern Beton. Das 2. Stockwerk sowie das Wohngeschoss ist ein
Fachwerkbau, der mit durchlässigen Schwemmsteinen ausgemauert ist und von außen mit
Schiefer bekleidet ist. Das Dach ist ebenfalls ein Schieferdach. Ein großer Nachteil
in hygienischer Hinsicht bildet die Anordnung der Schulfenster, die alle nach der
Vorderfront gelegen sind. Um wenigstens einen Spätnachmittagssonnenstrahl in die
Klassenzimmer zu bekommen, wurde an der Westseite in jedes Klassenzimmer 1 Fenster
gemauert. 20 m südlich wurde dann das Abortgebäude errichtet. Es hat eine Länge von
11,6 m und eine Breite von 10,8 m. Der untere Teil ist ein Ziegelbau mit aufgesetztem
Schieferdach. Es ist zweitig gebaut, so dass der Teil für Mädchen (3 Aborte) und
Knaben (2 Aborte u. Pissoir, 4,70 x 3,1 m) getrennt ist. Unter dem ganzen Gebäude
zieht sich eine Jauchegrube hin.
Das Schulgebäude hat Anschluss an die Dorfwasserleitung. Auf dem Flur (3,7 m), an der
Seite einer jeden Klassentür, befindet sich ein Kran mit einem Abflussbecken. In der
Wohnung befindet sich ebenfalls Wasseranschluss. Treppe, Flur, Klassenzimmer und Wohnung
sind mit elektrischem Licht versehen. Der Schuleingang liegt nach Westen und ist durch
einen Vorbau gegen diese Schlagseite (Wetterseite) geschützt. Der Eingang für die
Wohnung ist auf der Ostseite.
Bis zum Jahre 1927 wurde die Heizung durch größe Öfen bewerkstelligt. Im Herbst 1927
erhielt die Schule und die Wohnung eine Warmwasseranlage. Sehr unschön wirken in den
Klassenzimmern unförmliche, dicke Eisenbetonunterzüge. Von außen macht das Gebäude einen
eigentümlichen Eindruck, da es vollständig frei steht (Kaffemühle).
c Die Schulgrundstücke
Im Oktober 1922 gelang es der Gemeinde Ohle im Vermittlungswege durch Herrn
Weihbischof von Hähling von Herrn Baron von Wrede ein Tauschgrundstück zu erwerben.
Da jedoch die Verhandlungen nicht notariell gemacht worden waren, trat Baron von
Wrede wieder zurück. Erst Ende Dezember gab Baron von Wrede auf Drängen von der
Regierung, und durch die Vermittlung des Herrn Pfeifer das Austauschgrundstück
endgültig her. So erhielt die kath. Schule auch ein eigenes Schulgrundstück.
Das Grundstück liegt südlich der Provinzialstraße, mitten zwischen der Fabrik
des Herrn Pfeifer und dem Dorfe Ohle. Es liegt auf Flur --- und umfasst die
Parzellennummer ---- in Größe von ----. Das Grundstück wurde nach der Westseite
hin mit dem Schulgebäude bebaut und das Gelände durch Anschüttung bis zu 1 m gehoben.
Der östliche Teil und ein Rest des westlichen Teiles wurden zu Gartenparzellen
aufgeteilt und an Interessenten vermietet.
Im Herbst 1934 wurden auf dem Schulgrundstück (Schulplatz) vor dem Eingang als
Schutz gegen die Stürme 10 Pappeln gepflanzt. Auch wurden für die eingegangenen
Bäume auf dem Schulplatz neue Anpflanzungen vorgenommen. Im Frühjahr 1935 legte
die Schule hinter dem Abortgebäude einen Schulgarten an. Anmerkung: Die Pappeln
wurden 1958 umgeschlagen, da sie erstens zu hoch geworden waren und ein Teil
kernfaul geworden war. Neue wurden nicht gepflanzt.
Im Herbst 1936 wurden zwei weitere Obstbäume (jetzt 5) und Rosensträuche gepflanzt.
Im Frühjahr 1937 wurde der Schulgarten um das Doppelte vergrößert, so dass derselbe
jetzt 330 qm groß ist. Die Seiten der Wege wurden mit Steinen ausgelegt. Die
Schule bekam im Frühjahr Samen geliefert, so dass reichlich Gemüse angebaut werden
konnte. Der Schulgarten bekam einen Zaun, Länge ca. 65 m. Ein Teil des Zaunes
ist mit Liguster bepflanzt worden, jetzt soll noch eine Rotdornhecke gepflanzt
werden. Die Kinder der 7. u. 8. Jahrgangs (S. 52:) haben ein kleines Beet erhalten, das
sie selbst bepflanzen können. Auch weitere Geräte wurden noch gekauft, so dass
die Schule jetzt über die notwendigsten Gartengeräte verfügt. Herr Amtsbürgermeister
Wahle lieferte der Schule einen 45 m langen Schlauch, so dass der Schulhof und
Garten bei trockenem Wetter besprengt werden kann. Hinter dem Abort wurde durch
Schlossermeister Siepmann ein Fahrradstand erichtet (1937)
e Die Personalien der Lehrpersonen
Nachdem er sich am 8. Dez. 1918 der Regierung zu Arnsberg zur Verfügung gestellt
hatte, wurde ihm am 1.1.1919 eine Stelle an der 4-klassigen kath. Schule zu Eiringhausen
übertragen. Hier verwaltete er die 8. Lehrerstelle bis zum 29. Aug. 1919. Seit
diesem Tage verwaltet und leitet er die einklassige kath. Schule Ohle. Die 2.
Prüfung legte er am 16. Febr. 1921 daselbst ab. Im Mai 1921 erkrankte Lehrer
Köhne an einem Lungen- und Kehlkopfleiden, wohl eine Folge der ungünstigen
Lage der Notschule (Baracke, die direkt am Ohler Eisenwerk lag).
Am 1. Okt. 1921 übernahm Lehrer Köhne wieder die Schulstelle. Während der
Beurlaubung des Lehrer Köhne vom 1. - 24. Sept. 1922 wurde er vom Schulamtsbewerber
Leonhard Pankau aus Kirchhundem (Kreis Olpe) vertreten. Leonhard Pankau
war am 2. März 1897 zu ....
Durch die ungesunde Lage der Schulbaracke war Lehrer Köhne im Sommer 1923
gezwungen, wieder einen längeren Urlaub zu nehmen. Zu seiner Vertretung wurde
Lehrer Bernhard Rehborn aus Langeneiche Kreis Lippstadt...
...
Am 29.03.1963 Abschiedsfeier für Lehrer Steegborn, der ein Jahr freiwillig blieb
und nun aufhört. Außerdem Abschiedsfeier für Hauptlehrer Albold als Schulleiter,
der beabsichtigt, noch ein Jahr im ????dienst zu verbleiben.
III. Innere Einrichtung der Schule
Die Einweihung des neuen kath. Schulhauses am 17. Juni 1924
Als Auftakt zur Einweihung der Schule versammelte sich in der Frühe des Tages
die kath. Bevölkerung der Gemeinde, um an der kirchl. Einweihung der Schule
teilzunehmen, die Herr Pfarrvikar Busch vornahm. Im Anschluss daran wurde eine
Messe zelebriert, der 1. kath. Gottesdienst wieder in Ohle seit der Reformation.
Die weltliche Einweihung der Schule fand 3 Uhr nachmittags statt. Gemeindevertretung,
Schulvorstand, Handwerksmeister, die die Schule ausgeführt hatten, Elternschaft
und Schuljugend bildete die Festversammlung. Herr Amtmann Abel begrüßte die
Erschienenen mit folgenden Worten: Zu aller Freude und Genugtuung stehen wir
(S. 122:) jetzt vor dem vollendeten Bau, dessen Einweihung wir nunmehr vorzunehmen
gedenken. Im Auftrages des Schulvorstandes und der Gemeindevertretung von Ohle
heiße ich sie alle, die Sie zur Einweihung unseres neuerbauten Schulhauses
erschienen sind, herzlich willkommen. Ganz besonders begrüße ich den Vertreter
der Regierung, Herrn Oberregierung- und Schulrat Frohneberger. Es ist uns eine
besondere Freude, ihn heute unter uns zu sehen. Ferner begrüße ich die Vertreter
des Landrats, Herrn Regierungsassessor Brancaglio und Watermann. Weiter begrüße
ich Herrn Kreisschulrat Bierbaum, dem seit einigen Wochen die Aufsicht über die
kath. Schulen des Kreises Altena im Lennetal übertragen ist. Namens des
Schulvorstandes und der Gemeindevertretung von Ohle danke ich den vorhin erwähnten
Herren ganz besonders für ihr Erscheinen.
...
Vom 1. - 10. 2 1933 war die Schule wegen Grippeerkrankungen geschlossen.
Infolge des Sieges der nationalen Regierung durch die Wahl am 5. März 1933 fiel
der Unterricht am 8. März 1933 aus.
...
Am 16.6.1933 fiel der Unterricht aus, weil die Lehrer die große Volkszählung
vornehmen mussten.
Am 6. Mai 1934 wurden durch die N.S. Volkswohlfahrt 5 Kinder aus kinderreichen
Familien für die Zeit vom 6.5. - 18.6. nach Bückeburg zur Erholung geschickt.
Am 2. August verstarb der Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg.
In der Schule fand eine Gedächtnisfeier statt. Die Schule hatte halbmast geflaggt.
...
Vom 20. - 25.2.1939 wurde die 1. Klasse wegen Diphtherie geschlossen. Da die Zahl
der erkrankten Kinder in der folgenden Zeit bis 35 % der Geamtzahl betrug, wurde
am 20. März die Schule bis zu den Osterferien vollständig geschlossen.
Mit dem neuen Schuljahr 1939/40 wird in Ohle die Einheitsschule eingeführt.
Ab 23. Januar 1947 wurde in Plettenberg-Ohle die kath. Volksschule wieder eingeführt.
Nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Staates (1945) fand in den einzelnen
Orten auf Grund der Erziehungsanordnung Nr. 1 der Militär-Regierung eine Abstimmung
der Eltern über die Wiedereinrichtung der konfessionellen Volksschulen statt. In
Plettenberg-Ohle stimmten über 90 Prozent der kath. Elternschaft für die Errichtung
der kath. Volksschule. Diese wurde am 23. Januar 1947 in dem Schulgebäude der
früheren kath. Schule eingerichtet. 164 Schüler und Schülerinnen wurden übernommen.
Infolge der angewachsenen großen Schülerzahl wurde durch den neu gebildeten Elternbeirat,
der am 15. Februar 1947 zum ersten Male zusammentrat, die Errichtung einer 3. Lehrerstelle
gefordert. Diese wurde eingerichtet (1.4.47) und am 9. Mai konnte Herr Steegborn, der
für diese Stelle vorgesehen war, seinen Dienst antreten.
Zum neuen Schuljahr 1947/48, das mit dem 1. April 1947 begann, wurden 14 Lernanfänger
aufgenommen, von denen 2 vom Arzt zurückgestellt wurden. Die Kinder erhalten täglich
1/2 Liter Süßspeise oder Erbsensuppe. Es werden (Stichtag 24.9.1947) 157 Kinder bespeist,
von denen 54 Schüler von der Bezahlung befreit sind...
Am 6. Oktober 1947 wurden aus unserer Schule von Eminenz Weihbischof Bolte aus Fulda
64 Schüler gefirmt. Schon im Frühjahr, am 21. Mai 1947, fand in unserer Schule ein
Verkehrsunterricht statt, der von einem Polizeibeamten abgehalten wurde.
...Leider blieb der Weihnachtsschnee, der dem Feste ein besonderes Gepräge gibt, aus.
Dafür regnete es seit dem 18. Dezember ununterbrochen. Dies hatte zur Folge, dass die
schon angeschwollene Lenne am Sonntag, dem 28.12.1947, über die Ufer trat. In den
frühen Morgenstunden, 4 Uhr war's, ertönte die Sirene. Die Leute suchten nun die
wichtigsten Lebensmittel wie Einmachgläser u. a. in höher gelegene Räume zu bringen.
Mittags ergoß sich dann das Wasser über die Wiesen und Felder. Die Maiwegstraße,
frühere Schulstraße, stand völlig unter Wasser. Am nächsten Tag verlief sich allmählich
das Wasser. Das Grundwasser blieb noch mehrere Tage in den Kellern stehen.
...
Am 21.6.1948 wurde die Reichsmark durch die Deutsche Mark abgelöst. Jeder konnte
60,- alte Mark gegen 60,- Deutsche Mark umtauschen. Das übrige Geld musste der Bank
abgeliefert werden und wird späterhin entwertet, kleinere Beträge abgewertet. Nähere
Gesetze hierüber werden noch erlassen.
1. Oktober 1950 = Die Schule, die dreiklassig ist, hat nur zwei Klassenräume, so
dass eine Klasse Nachmittag-Unterricht hat (Bd. II der Schulgeschichte).
S. 144: Mit dem 1. Januar 1951 wurde dieser erste Band der Schulgeschichte abgeschlossen.
Bd. II der Schulgeschichte |

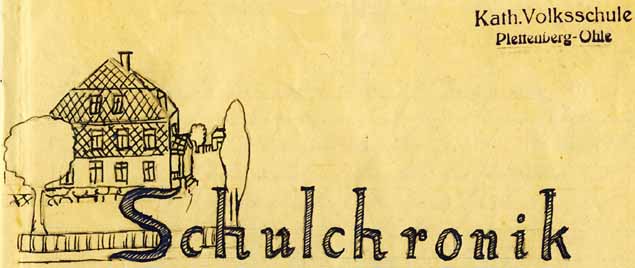

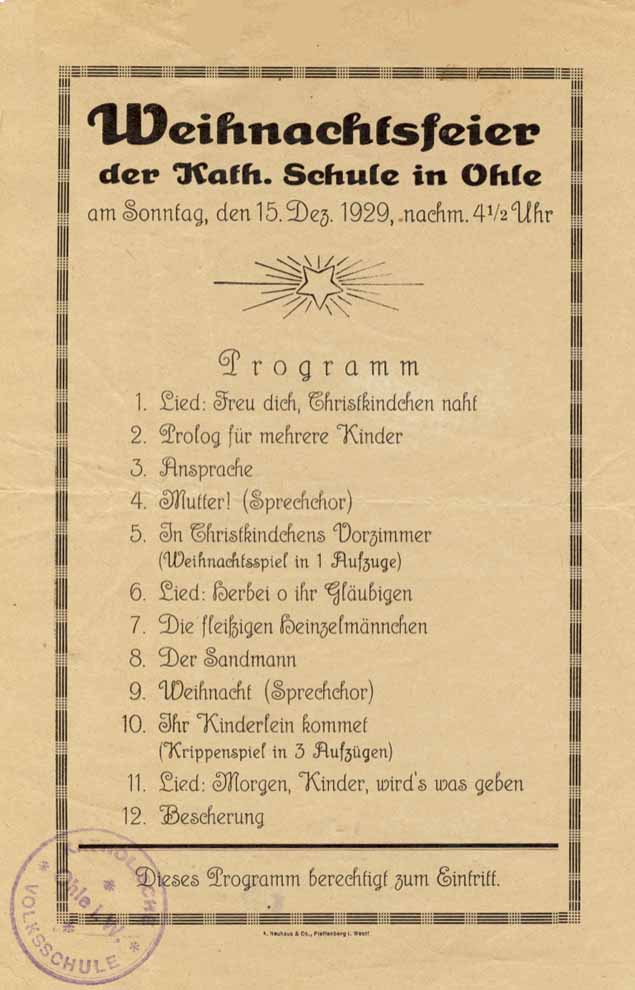 <2>
<2>