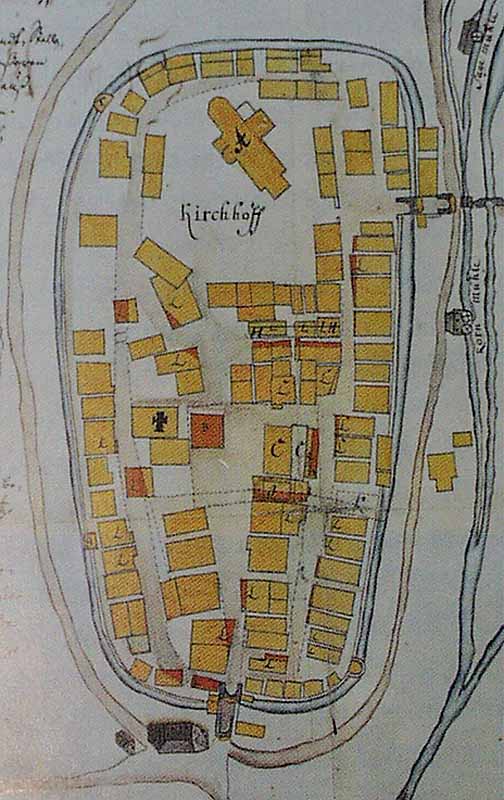|
zur Grundlage für ein Häuserbuch. Er suchte im lutherischen Lagerbuch, in alten Grundbüchern,
im Kataster etc. nach den Eigentümern und Bewohnern der Häuser. Dabei fanden sich
Daten und Fakten vom 17. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert.
Albrecht von Schwartzens nachfolgende Häuserliste basiert in ihrer Reihenfolge auf der Häuserliste in der Brandakte
von 1725. Das Haus Nummer 1 in der Brandakte ist demzufolge auch das Haus Nr. 1 in Albrecht v. Schwartzens
Häuserbuch. Etwas irritierend: In der Brandakte heißt das Haus Nummer 1 "Richter von den Hoeven Hauß", bei Albrecht
von Schwartzen heißt das gleiche Haus "Färbers Haus". Der Grund: A. v. S. hat die Ursprünge der Häuser gesucht und
ist in Zeiten lange vor dem Stadtbrand fündig geworden. So ist das Haus Nr. 64 - "Haltermanns-Haus" - als solches bereits
vor 1620 erwähnt, in der Brandakte des Jahres 1725 ist es das Haus Nr. 64 "Joh. Rincke, Schlächter (halbes Haus)".
Zu nahezu jedem Haus hat A. v. S. eine Parzellen-Nummer angefügt. Diese Parzellen-Nummern basieren wiederum auf dem 1830
angefertigten Urkataster. Bei den aufgeführten Geldbeträgen (in Reichstaler) handelt es sich um den Gebäudewert
(Versicherungswert, Taxe) zur Zeit des Stadtbrandes 1725. Neben den oft genannten Berufsbezeichnungen der jeweiligen
Hauseigentümer finden sich auch genealogische Hinweise auf Geburts- und Sterbedaten oder Eheschließungen. Diese Daten
konnte Albrecht von Schwartzen aus seiner rund 2000 Seiten umfassenden genealogischen Sammlung (basierend auf Kartei des
Lehrers Hardt, Eiringhausen) entlehnen.
Nr. 1 Färbers-Haus (heute Wilmink), Haus und Scheune vor dem Stadttor
(Obertor) gegenüber dem Torhaus (Pz 247); Besitzer: Bürgermeister Engelbert von den Hoeven (*1642, †30.12.1721, verh.
mit Marianne Marggraf), genannt Färbers. 1725: H. Richter von den Hoeven, sel. Hauß
und Scheune, gewesener Königl. Richter des Ampts Plettenberg, Taxe 200 Rtlr.
Nr. 2 Erben Hammerschmidt, Joh. Balthasar, cand. jur. (1725), Haus und
Scheune, versichert mit 200 Tlr.
Nr. 3 Christoph Malthan, Wirt und Handelsmann (Haus 75 Tlr.)
Nr. 4 Rümhers-Haus oder Robertus-Haus (Haus 100 Tlr)
Nr. 5 Schulmeisters-Haus, später "Potten-Haus" am Kirchhof (Pz 233)
Nr. 6 Paulmans-Haus (Pz 245, Haus 50 Tlr.), 17.09.1829 Privatkaufvertrag
Moritz Bettermann; 1928: Ehefrau Fritz Delwig
Nr. 7 Portemans (Pförtner) -Haus am Obertor (auf der Oberpforten, dem
Färbers-Haus gegenüber), (Pz 289)
Nr. 8 Christoph Hagedorn? - Herman Heyman (1725), Bäcker und Fuselbrenner
Nr. 9 Diedrich Möller (Gregory), 1707 Korporal u. Pächter der Sägemühle,
1711 Ratskämmerer (Pz 291)
Nr. 10 Stephan Kissing, Tuchmacher, und Arnold Esselen, Wollspinner
(1725), Sahmenhaus?, (Haus 70 Tlr.)
Nr. 11 Johan Anton Esselen (1725), Kaufmann und Tuchmacher *1668 †März
1730; 1928: Robert Borbeck (Pz 292)
Nr. 12 Herman Diederich Plettenberg (1725), Schneider (Pz 293, 50 Tlr.), 1840: Stephan
Heinrich Gregory und Anna Elisabeth geb. Dulheuer; 1929: Fritz Ohm;
Nr. 13 Sigis Mundus Rincke gt. Dulheuer (1725), Schmied (50 Tlr.), 1921:
Fritz Röwenstrunk, Packmeister (Pz 294)
Nr. 14 Humperts-Haus (Pz 295), 1929: Wilhelm
Geck; um 1955: Erben Schumachermeister Wilhelm Geck
Nr. 15 Johan Jacobi (1725), Tuchmacher und Brotbäcker (80 Tlr.), 1758: Tuchmacher
Henrich Bernhard Jacobi; 1772, 1775: Bernhard Jacobi; nachfolgender Besitzer war der Gerber (?)
Johan Henrich Lohmann (XXI c 23 u. 27), der es an Leopold König verkaufte, dieser wiederum
verkaufte es an Joh. Henrich Lohmann; 1791: Johann Christoph Lohmann; 1921:
Ehefrau Fabrikant Otto Dunkel, Helene geb. Grotensohn
Nr. 16 Jasper Giese (Pz 231, 60 Tlr.), 1830: Friedrich Bernh. Geck
Nr. 17 Unnas-Haus, Peter Unna - Peter Roß gt. Unnaes (luth. Lagerbuch S.
129 Nr. 11), (Pz 228, 55 Tlr.)
Nr. 18 Dulheuers-Haus (Pz 226), 1868: Carl Alberts, Klempner; 1913: Witwe
Klempner Carl Alberts, Amalie geb. Krugmann und Kinder Anna, Karl, Emma,
Lina und Johanna; 1929: auf Stadt Plettenberg überschrieben
Nr. 19 Rollen-Haus (Haus und Gut) oder Höggel (Pz 297, 50 Tlr.), 1830:
Peter Wilhelm Geck
Nr. 20 Bastert-Haus, 1533: Stoffel Bastert (Pz 225, 80 Tlr.); 1830: Peter Gerhard Böley
Nr. 21 Henrich Jacobi (1725) kleines Häuschen (Pz 223, 40 Tlr.); 1830:
Joh. Diedrich Broecker
Nr. 22 Schürmanns-Haus, Joh. Died. Schürmann, Stahlschmied (Pz 222, 60
Tlr.); 1830: Witwe Joh. Bernh. Böley
Nr. 23 Stam(m)s-Haus vulgo in der Gaßen (Pz 221, 40 Tlr.); hat nach dem
Brande aufgebaut Christoffel Voß, Drechsler; 1758: Christophel Voß; 1830:
Gebrüder Casp. Wilhelm u. Peter Diedr. Essellen
Nr. 24 Haseken-Hauß hinter Holländers Haus (Pz 220, 50 Tlr.); 1904:
Kaufmann Friedrich Siepmann; 1932: dto.
Nr. 25 Kloevers-Haus (Pz 218, 75 Tlr.); 1809,1817,1821,1830: Adam
Seissenschmidt; 1928: Albert Westhelle (Pz 2421/218), Gustav Sternberg Witwe (Pz 2420/218);
Nr. 26 Wilh. Jacoby (1725), Tuchmacher (50 Tlr.)
Nr. 27 Goebeler oder Gobelii-Haus "Terens-Haus am Markt" (Pz 303, 100
Tlr.); 1620: Peter Terens; 1821 u. 1830: Friedrich Wilhelm Schmöle; 1928: Josef Neuhäuser (Pz 2056/303)
Nr. 28 Kirchen-Stette, 1725: Christoffel Klumpe, Tuchmacher (Pz 302/04);
2. Die Knochenstätte (Pz 302); b) Pz 304: Anton Nothjunge von Himmelmert;
31.12.1829: Friedr. Wilhelm Schmöle; Haus-Nummern: 1725: 28, 1758 u. 1772:
67; 1775: 62; 1791 u. 1809: 159; 1830: Pz 302
Nr. 29 Schecken-Haus (Dünen-Haus, Sternberg, Funke),
(Pz 299); 1920, 1928: Kaufmann Sally
Sternberg; 1938: Stadtsparkasse Plettenberg
Nr. 30 Peter Ohle (vor 1725); Matthias Hoever gt. Marl (1725, 80 Tlr.),
Brotbauer; 1872: Subh. Briefträger Friedrich Korte
Nr. 31 Zellen-Haus (Pz 301); Matthias Zeller, Tuchmacher (1725, 70 Tlr.);
1809, 1817, 1821 u. 1830: Peter Caspar Schulte; 1928: Robert Bitzhenner
Nr. 32 Sattlers Haus (Pz 368/369)
Nr. 33 das Stadtboten-Haus, Tuchmacher Joh. Christof Grothe gen. Groher (1725),
(Pz 366/367), beim Stadtbrand versichert mit 70 Rtlr.; 1899: Witwe Menschel geb.
Langenbach; 1909: Schreiner Wilhelm Theis; 1936: Schreiner August Theis; das
Haus wurde im Jahre ???? abgerissen;
Nr. 34 Zur Nachts-Haus, Hans zur Nacht - sein Sohn war Johan Rinke - itzo
Witwe Hutzen zahlt 6 Stbr. an das Armenhospital; (Pz 305/2059)
- Basterts (luth. Lagerbuch S. 227 Nr. 14 - S. 231 Nr. 5); 1712: Elsken Bast gt. Hutzes gest. vor
1725 (XX d7/10); 1725: Hutzes Erben, Christoph Bast; 1725: Christoph Bast, ein armer Wollspinner;
seit 1737: Witwe Eiringhaus (XX d7); seit 1756: Peter Heimendahl; 1764/65 von Grund auf
repariert; seit 1779: Heinrich Seuthe; 1772 u. 1785: Henrich Wilh. Tienghaus (Tihinghaus);
1787 verkauft an Hufschmied Died. Winterhoff, Streit mit dem Nachbarn Gregory wegen Erweiterung
seines Wohnhauses und Anbau einer Schmiede; 1809: Joh. Died. Winterhoff; 1928: Alb. Elhaus Wwe.
Nr. 35 Stoffel Kösters Haus (Pz 306); um 1710, 1725: Tuchmachermeister Caspar Eyringhaus
oder Hasecke und Matharina Kluche, um 1710 bis um 1720 Pächter der Beiderwandwalkerei;
beim Stadtbrand war das Haus mit 45 Tlr. versichert; 1758: Wollspinner Friedrich
Eyringhauß; 1841: K Schneider Carl Jung; 1844: K Peter Heinrich Schulte; 1862:
Posthalter Friedrich Schulte (gegen Leibzucht und Abfindung seiner Geschwister);
Nr. 36 "Krummen-Haus" (war ein Gasthaus, in dem die Stadtherren mitunter
auch Verzehr hielten) später "Papenhaus" (Pz 309); um 1600: Bürgermeister Dieterich
Krumme; Johannes Krumme; 1658: Tuchmachermeister und Bürgermeister (1683) Johannes
Pape alias Krumme, Zunftmeister 1659 und 1665; 1866: Fabrikant Heinrich Schmellenkamp;
1899: Kaufmann u. FA Wilhelm Wulfert; 1931: Ehefrau Marie Tusch geb. Wulfert;
Nr. 37 Auf der Burg, Haus und Nebengebäude, beide 1725 versichert mit 80
Tlr. (1725), (Pz 350); 1836 u. 1839: Carl Christoph Wilhelm Theiß allein; 1872: Schreiner
Wilhelm Theis, Anbau mit Schweinestall Neue Str. 7 und Werkstätte Neue Str. 7a;
1936: Schreinermeister August Theis;
Nr. 38 Haus und Nebengebäude H. Secr. Hammerschmidt (Pz 349); 1833: Lohgerber
Heinrich Adam Schulte; 1867: Lohgerber Friedrich Schulte; 1905: Metzgermeister Albert
Bitzhenner; 1947: Ehefrau Architekt Werner Theis, Lydia geb. Bitzhenner;
Nr. 39 Johannes Schütte, Bürger und Tuchmachermeister seit 1682, ebenso
Küster; 1725: Tuchmacher Christoph Schütte; beim Stadtbrand war das Haus mit 50 Tlr.
versichert; Stahlschmied Adam Hallemann Pz. 348 ?;
Nr. 40 um 1690: Matthias Stemper oder Theis Moller gen. Stemper, Zimmermann und
Müller; 1829: Nadler Peter Stamm; 1846: Lohgerber Carl Stamm; 1898: FA Wilhelm Ries; 1905:
FA Wilhelm Ries und zwei Söhne Gustav und Fritz; 1937: FA Wilhelm Ries;
Nr. 41 1725: Handelsmann und Tuchmacher Evert (Eberhard) Klumpe und Maria
Paulmann (2. Frau), + vor 1727, beim Stadtbrand versichert mit 95 Tlr.; 1727 klagt
seine Witwe geb. Paulmann, die Stiefmutter der Cath. u. Maria Klumpe war, dass
Johan Henrich Gregory und Maria Klumpe ihr vom verkauften Paulmanns Haus noch
30 Tlr. schulden (VII / 4, S. 65,66 und 68); 3 Erben (VII / 4, 12);
Nr. 42 Christoph Seißenschmidt, Tuchmacher (1725), Häußgen, beim Stadtbrand
mit 40 Tlr. versichert;
Nr. 43 Knustes Hausstette (Pz 345 - 343?); 1831: Bäcker Adam Schulte allein;
1839: K Schreiner Peter Heinrich Kötter; 1847 n. S.: für 150 Tlr. Peter Heinrich
Schulte; 1847: für 230 Tlr. Friedrich Kißing und Peter Wilhelm Neumann; um 1849:
Friedrich Kißing allein; 1855 n. S.: pens. Gensd'arm Friedrich Wilhelm Nehry;
1861: Geschwister Caroline und Golde Sternberg; 1873: Papiermacher Heinrich Selter;
1892: Wwe. Papiermacher Heinrich Selter, Wilhelmine geb. Mertens; 1897: Schuhmacher
Ludwig Winkemann; 1902: Buchhändler Johann Scharenberg; 1918, 1932: FA Matthias
Resch;
Nr. 44 Lülings Hausstätte (Pz 344); 1658, 1662: Peter Höker oder Lüling, Ratsverwandter -
zahlte für die Hausstätte 4 Stbr. ..... an das Armenhospital (XX d 7/Erl.); 1688: Gerhard Lüling
alias Overring; 1712: Johannes Ohle; 1725 Johann Gregory, Tuchmachermeister seit 1718,
übertrug 1725 dem Peter Ohle sein halbes Haus (hinterher); 1758 gehörte das Haus
Arnold Gregory, Wollspinner, Meister seit 1747, und Peter Ohle, Sensenschmied (1/2 Haus
und 1/2 Sensenhammer an der Waschebecke); 1928: Johan Ruhrmann Ehefrau
Nr. 45 Johan Kayser (Rasche alias Keyser), Schornsteinfeger (Pz 342); das
Haus brannte 1725 ab, es war versichert mit 45 Tlr.; das Haus wurde sofort nach dem
Brande von Johan Kayser wieder aufgebaut; 1726: Rasche; 1758: Witwe Rasche, eine
arme Tagelöhnerin 1/2 Haus; 1772: Witwe und Johannes Rasche; 1775 Johannes Rasche;
1783 und 1788: Joh. Friedrich Rasche u. Hermann Weiß; 1791: Hermann Scheffen und
Hermann Weiß (Hermann Scheffen hatte erst kurz vorher das halbe Haus in der
Rasche'schen Subhastation erworben (XXI C/13/8 Stadtarchiv); 1809: Hermann Scheffen
und Arnold Voß; 1830: Heinrich Ries und Arnold Voß; 1928: Huf- und Wagenschmiede Jakob Muth
Nr. 46 Johan Herman Seißenschmidt (Pz 320), Tuchmacher (1725); 1809: Johann Wilhelm
Seißenschmidt und Johan Christoph Weiß; 1817: Weiß; 1830: Hermann Bernhard Elhaus;
1832: Peter Friedrich Elhaus und Mar. Cath. geb. Seißenschmidt; 1872: Schuster Friedrich
Elhaus allein und Maria Cath. geb. Klaucke; 1911: Landbriefträger Wilhelm Elhaus allein;
1928: Wilhelm Elhaus Erben
Nr. 47 Eberhard Seißenschmidt, Tuchmacher (1725), das Haus (Pz 321) brannte 1725 ab, es war
versichert mit 50 Tlr.; 1758: Eberhard Seißenschmidt, ein alter Tuchmacher; 1772: Caspar Elhaus; 1788:
Peter Graewe als Mieter; 1795: Arnold Elhaus; 1809 u. 1817: Hermann Elhaus; 1830: Arnold Elhaus
Tuchmacher; 1868: Bäcker Wilhelm Haape; 1908: Wwe. Bäckermeister Wilhelm Ernst Haape und Kinder
Paul und Louise; 1928: Wilhelm Haape Wwe. und deren Kinder; 1990: Bäckerei Haape;
Nr. 48 Wwe. Catharina Seißenschmidt (Pz 322); 1840: Bäcker Peter Heinrich Schulte
für 244 Tlr. 25 Sgr.; 1851: Bäcker Peter Heinrich Schulte mit 7 Kinder; 1855: K Peter Dietrich
Hohage zus. mit 323 für 800 Tlr.; 1856: K Conditor Peter Werdes; 1872 n. S.: Lehrer
a. D. Heinrich Elhaus zu Elberfeld; 1872: K Fabrikant Wilhelm Volmerhaus; 1876:
Gustav Schulte und Julie geb. Weiß; 1887: Schuhmacher August Höfinghof; 1947:
Wwe. Reichsbahnassistent Rudolf Sirringhaus, Klara geb. Höfinghoff (Herscheid), Kaufmann
Friedrich Wilhelm Höfinghoff (Heiligenhaus), FA Julius Höfinghoff, Ehefrau Kaufmann
Paul Schildknecht, Elisabeth geb. Höfinghoff, Ehefrau Verwaltungsangestellter Ernst
Bauckhage, Johanna geb. Höfinghoff; ????: Uhrmachermeister Engelhard Finke; die
angrenzende Parzelle 329 war 1928 im Besitz von August Höfinghoff Erben;
Nr. 49 Schelten-Haus (Pz 314), Neue Str. 12; etwas 1690: Johan Schelten, kam von
Amecke1, Tuchmachermeister seit 1690; 1725: Joh. Henrich Schelten, seit 1721 Tuchmachermeister,
1740 Zunftmeister; 1758: Diederich Schelter genannt Böllinghaus; 1772 Diederich Böllinghaus;
1809: Joh. Christoph Worth; 1830: Caspar Heinrich Hesmer; 1869: Böttchermeister Rudolf Haape
und Caroline geb. Schmidt durch Kauf; 1884: Ehefrau Schieferdecker August Bültmann,
Alwine geb. Klauke; 1907: oHG Höfinghoff & Allhoff; 1916: Stadtsparkasse Plettenberg;
1919: Fritz Allhoff; 1928 Fritz Allhoff; seit 1931: Anstreichermeister Heinrich Fröhling;
Nr. 50 Gerhard Wort, Tuchmachermeister, S. d. Rötger Woerd v. Ohle (Pz
315); 1758: Johan Christoffel Wort (siehe Nr. 57); 1809: Schneidermeister Peter Hermann Schulte; 1830:
derselbe 1/2 und die Kinder 1. Ehe; 1850: Der Schuhmachermeister Heinrich Brücher,
verheiratet mit Elisabeth Ehlhaus; 1873: Der Schuster Georg Hoos und Elisabeth geb. Höfer;
1881: dessen Witwe; 1890: FA Adolf Gutschank (seine Mutter war Julie Höfer); 1928: Adolf Gutschank;
1947: Kaufmann Wilhelm Gutschank;
Nr. 51 Henrich Bernhard Hagedorn (1725), (Pz 324); 1809: Peter Arnold Lohmann 1/2
und Sebastian Neumann 1/2; 1817, 1830: Wilhelm Hügel; 1928: Heinrich Huß; 1929: Gebr. Hüseken;
Wurth
Nr. 52 Stadthirtenhaus im Unterthor (Pz 325), 1809: Johann Wilhelm Voß,
1817: Voß; 1830: H. D. Rademacher, Schneider; 1928: Wwe. Ferdinand Huss u. deren Kinder;
Biehsmann
Nr. 53 Peter Hanebeck (1725), Weißgerber, hatte in Iserlohn die Lehre
ausgestanden und 1715 vor der Tuchmacher-Zunft das Meisterstück gemacht (Pz
326); 1747 wurde Henrich Wilhelm Geck durch die Heirat der Wwe. Hanebeck
Besitzer des Hauses; 1758, 1772: Caspar Hermann Cramer, Tuchmacher und Krämer,
gleichzeitig 1758 in der Schmiedezunft Amt . . .."Erlaubnis zum Handeln mit Eisen....",
Richt.... der Schmiedezunft 1761; 1775: Conrad Hanebeck, Stiefsohn des H. W. Geck,
hat das 1779 teils abgebrannte, teils verfallene Haus wieder aufgebaut für 536 Tlr. 43 Stüber.
Er hatte ..... ..... verloren und dadurch großen Schaden erlitten; 1809, 1817, 1830: Peter
Caspar Hanebeck, Lohgerber (Lohmühle und Scheune); 1906: Blomberg; 1907: Abriß des
Hauses und Neubau eines 3 1/2 geschossigen Wohn-/Geschäftshauses; 1928: Ernst Schulte,
Kaufmann, Wilhelmstraße (Pz 326/2148,2149,2150);
Nr. 54 Auf der Trenke an der untersten Pforten (Pz 130a); Servos: Joh. Peter Klumpe;
1725: Peter Klumpe "in der Pforten"; 1783: Johannes Leonhard (Enkel des Peter
Klumpe, ging 1767 in die Schmiedelehre bei Bernd Ohle); zwischen 1783 und 1788
tauschten die Familien Leonhard ihr Haus mit dem Nachbarhaus der Familie Adell;
1788: Christian Adell, Waagenschreiber (*28.01.1715 +24.07.1808) ; 1791: Joh. Friedrich
Moritz Adell, Strumpfwirker (*17.10.1758 +17.01.1830); 1809: Johann Friedrich Moritz
Adell; 1817: Adell; 1830: Joh. Christoph Selter, Nadler; 1878: Friedrich-Wilhelm Schuster,
gebürtig aus Wuppertal, richtet einen Friseursalon in dem Haus ein und bietet Tabakwaren
feil; 1907: Abriß des Hauses und
Neubau eines 3 1/2 geschossigen Wohn- und Geschäftshauses; 1928: Wilhelm Schuster (Friseur,
Rauchwaren, Toilett-Artikel, Wilhelmstr. 42);
Nr. 55 Pauls Haus, Johannes Paul (Pz 183); 1725: Bürgermeister Died. Pauli,
Tuchmacher; 1758, 1772: Johannes Paul, Tuchmacher; 1772/75: tauschte mit Christoffel
Boeley (XXI c/2 S. 38 Stadtarchiv); 1775: Johan Diederich Boeley; 1809, 1817: Caspar
Gerhard Gregory; 1821/1830: Johan Wilhelm Voß, Gerichtsbote zu Altena; 1912: Wwe.
Friedrich Schulte; 1913: Abriß des Hauses und Neubau eines 3 1/2 geschossigen Wohn-
und Geschäftshauses; 1928: Heinrich Schulte; 1945: Konditorei P. H. Schulte; 1995: Mieter
Schöner schenken und wohnen Brinkmann, 2002: Mieter ars vivendi;
Nr. 56 Seißenschmidts-Haus "In den Müren"
(Pz 318/319); Stephan Seißenschmidt genannt Koster (Küster), war auch Küster; Stoffel
Seißenschmidt; 1725: Tuchmacher Johan Peter Seißenschmidt (Bruder des Eberhard S.),
Johan Henrich Seißenschmidt - beim Stadtbrand war das Haus mit 80 Tlr. versichert;
1758, 1772, 1775, 1783, 1788: Johan Henrich Seußenschmidt; 1791: Johan Henrich Seißenschmidt
sen.; 1830: Joh. Christoph Seißenschmidt (Pz 318), 1889: Metzger August Müller (Parz. 318);
1825: Nadler Heinr. Wilhelm Ries und Mar. Kath. geb. Seißenschmidt (Schwiegersohn) (Pz 319);
1928: August Müller (Pz 318), Pz 319: 1854 n. S. Kesselschmied Carl Stahlschmidt, 1890
Briefträger Arnold Miläus, 1919 Oberpostschaffner Aug. Klumpe u. Emma geb. Myläus;
Nr. 57 Lüling-Haus; 1658 u. 1662 (XX d 7/): Peter Höcker von Lünings Hausstätte;
1688: Gert Lüling alias Overring, Tochter des Melchior Oberring (XX d 7); Peter Höcker
genannt Lüling, Rathsverwandter; 1725 Johan Died. Klaucke (vorn), Johan Diederich
Kluck (Pz 315/ 316); 1796: Johan Henrich Gerhard Gregory, Joh. Christoffel Worth (hinten);
1928: Adolf Gutschank (Pz 315) und Bruno Krage (Pz 316);
Nr. 58 Die "Beyenburg" oder "Biggenburg", später Budden-Haus unterhalb
des Marktes (Pz 313)
Nr. 59 Wittibe Vicary Hammerschmidt (1725) - Anna Margaretha Stollen, später
Frau Johannes Tuncker (?) (Pz 312); 1758: Johan Heinrich Gregory, Tuchmacher;
1809: Joh. Christ. Gregory; 1817: Schullehrer Gregory;
1830: W.. Joh. Christ. Gregory; 1928: Wwe. Kurt Heyne (Pz 786/312), Friedr. Lübke u. Kinder (Pz 2394/312)
Nr. 60 H. Homberg ref. Prediger (1725)
Nr. 61 Bouckelmanns-Haus, später Wagemeisters-Haus (Pz 307); 1548: Bürger
Johan Bouckelman; 1566/1570: Richter Johan Bouckelmann; 1620: Heinrich Bockelmann;
1624: Johannes Bockelmann; um 1650: Henrich Wagemeister; 1725 Heymann; neu erbaut
vor 1728 von Jgfr. Heimann; 1758: Georg Schmillenkamp, Brotbäcker und Böttger, aus der
Grafschaft Limburg stammend, leistete 1727 den Bürgereid, heiratete 1727/28 Anna Maria
Höfer gt. Marl; vor 1772: Christoffel Arnold Essellen, Sohn des Mauritius Augustinus
Essellen, der heiratete 1755 Clara Anna Maria Elisabeth Schmellenkamp; 2. luth. Pastorat
Pastor Möller; 1928: Friedrich Erben; 1970: Schlütter;
Nr. 62 Melchers-Haus oder Rümhers-Haus unterhalb des Marktes; 1725: Jobst
Rümer, Tuchmacher (das Haus war versichert mit 65 Tlr.); 23.01.1756: Johan Diedrich Boeley;
1772: Diedr. Rumher (Haus Nr. 118 zu 1/2); 1775, 1783: Johannes Paul; 1788, 1791, 1809, 1817:
Johann Henrich Paul; 1928: Lieschen u. Willy Möller; Mieter 1995: Brinkmann, Mieter 2002: ars vivendi
Nr. 63 Thomasens-Haus (hierzu gehörte vor 1671 das Haus Nr. 62 bzw. 74 - alles
zusammen hieß das "Rümhers"- oder "Höckers-Haus"); 1758: Peter de Bra, Diakon
aus Amsterdam, Tuchmacher und Kunstmaler, leistete 1735 den Bürgereid, heiratete
1746 Sibilla Elisabeth Boeley; Rümhers-Haus 1758: Jürgen Stahlschmidt,
Stahlschmied; 1775 und 1778: Peter Caspar Stahlschmidt; 1809 u. 1817: Johannes
Christian Gerhardt; 1830: Johann Gerhard;
Nr. 64 Haltermann-Haus (vor 1620 Jakob Haltermann, er ist 1641 als Bürger- und
Ratsverwandter erwähnt, am 30.01.1657 unterschreibt Joh. Haltermann noch eine
Magistratsurkunde); 1725: Joh. Rincke, Schlächter (halbes Haus); 1830: Erben Joh. Henr.
Dulheuer;
Nr. 65 Joh. Bacharot, Chrurgus (halbes Haus) (1725), seine Witwe heiratete
den Adam Voß (33,22)
Nr. 66 Klingelmanns-Haus; 1560: Henrich Klingelmann, Bürger; 1610: Johan
Klingelmann, Ratsverwandter und Vorsteher d. Ha.. Pl.; 1756 (?) Joh. Henrich Seißenschmidt
(XX d7); Caspar Henrich Seißenschmidt (XX d7); ref. Schulhaus;
Nr. 67 Peter Friedhoff, Kat. um 1640; 1725: Wilhelm Kauke, Stadtdiener (ab 1690
Bürgergeld), Heirat 1718; Joh. Henr. Leopold Brockhaus (* um 1720 +09.07.1780), war
verheiratet (vor 1766) mit Anna Cath. Elis. Malthan (* um 1733 *13.04.1800);
Nr. 68 "Fillerie" später Osselen-Haus (Pz. 133b); (Im März 1649 verkauften Bürgermeister und
Rat der Stadt ihre "Fillerie" an den "ehrbaren und bescheidenen" Stoffel Lüling Gut Ossselen
und .... von Beruf. Bis dahin hatte das ehemalige Rathaus noch zeitweilig dem Rat bei ihren
Amtshandlungen als Behausung gedient. 20 Jahre später, am 16.10.1669, verkaufte er dem
Freiherrn von Plettenberg zum Schwarzenberg sein in Landemert gelegenes sog.
Klockengut-Erbteil mit allem Zubehör); 1645: Eberhard Osselen; 1725: Joh. Peter Eveking;
Wilhelm Eveking (L.L.S. 137); 1939: Elektriker Hermann Winterhoff;
Nr. 69 Schniders-Haus bei ...stette (Pz 132/133); 1725: Jobst Ohle, Tagelöhner (kam 1682 von
Eiringhausen und trat bei Bernh. Plettenberg in die T(uchmacher)-Lehre (XVIII 1 S. 24);
sein Schwiegersohn Peter Schröder hat das Haus 1729 wieder aufgebaut; 1830: Peter Korte;
1873: FA Friedrich Schmalt; 1891: FA Adolf Hecker; 1922: Wwe. Adolf Hecker und Carl Heinrich
Hecker; 1946: Werkzeugmacher Erwin Höllermann und Ilse geb. Hecker;
Nr. 70 Blessings-Haus am Graben vor der Hausstätte (Pz 181/182); 1681: Johan Blessing,
Witwe Seißenschmidt alias Blessing; 1725: Peter Diederich Seißenschmidt, Tuchmacher;
ab 1758 zwei Besitzer; 1809 u. 1830: Joh. Christoph Becker / 1830: Caspar Cramer (seit 03.10.1814);
Nr. 71 Berendts-Haus (Pz 180); 1620: Clemens Berenß; 1655: Arndt Berendts; 1830: Wwe. Casp.
Heinr. Klumpe, 3/4, und Sohn Peter Caspar Klumpe; 1877 K: Winkelier Friedrich Rentrop für 2.150 M; 1904:
Wirt und Schneidermeister Richard Pier und Anna geb. Kirchhoff; 1919: Ehefrau Gastwirt Wilhelm
Hoppe, Hedwig geb. Pier; 1928: Gastwirt Wilhelm Hoppe;
Nr. 72 Lüttgen-Haus (Pz 178/179); 1725: Joh.. Henrich Lüttecke, Schmied (heiratete 1719);
ab 1809 drei Besitzer: Ernst Neuß / Friedrich Neuß und Elisabeth Neuß; 1830: Ernst Neuß / Friedrich Neuß;
1876: Metzger Jacob Lennhoff (4.200 M); 1893: Fa. F. Blomberg Wwe.; 1896: Händler Anton Piotrowsky;
1904: Wwe. Händler Anton Piotrowsky; 1919: Hammerschmied Friedrich August Piotrowsky; 1934:
Gastwirt Wilehlm Hoppe und Hedwig geb. Pier; 1942 E: Wwe. Gastwirt Wilhelm Hoppe;
Nr. 73 Steffens- oder Küpershaus (Pz 177); Johann Steffen, Munders Steffen, 1725: Heinrich Steffen, Faßbinder;
1758, 1772 und 1775: Joh. Diedrich Steffens, Böttger; 1830: Kuper (Küfer?) Peter Heinrich Steffens;
1877 Schreiner Wilhelm Steffens; 1900 Schuhmacher Wilhelm Steffens; 1934 Schäftemacher Heinrich Köhler;
Nr. 74 Siggelers-Haus (Pz 190); 1725: Joh. Diedr. Boeley, Schuster (1719 = Tuchmacher);
1830: Bernhard Kaempfer; 1871: Bäcker Peter Heinrich Wilhelm Kaempfer; 1876: Wohnhaus-Anbau und
Vergrößerung; 1911: Konditor Albert Ohle und Mina geb. Kaempfer; 1928: Albert Ohle;
Nr. 75 Wittgerer (Weißgerber)-Haus (Pz 191); 1725: Henrich Winckels Hauß; Joh. Henrich
Schmalt, Lohgerber und Schuhmacher, hate das Haus wider aufgebaut; 1772: Herman Henrich Stahlschmidt
(Das alte Haus wurde abgebrochen und ein neues mit Steinen Gemauertes für 606 Taler gebaut - XVII/2);
1775, 1783, 1788 und 1791: Herman Henrich Stahlschmidt; 1809 und 1817: Henrich Bernhard Stahlschmidt;
1830: Stahlschmidt Erben, Bernhard Kämpfer, Stephan Heinrich Stahlschmidt, Bernhard Stahlschmidt;
1842: Schreiner Karl Stahlschmidt jr. und Julie geb. Brockhaus; 1859: Wwe. Schreiner Karl Stahlschmidt;
1863: Buchbinder Theodor Westhelle und Julie geb. Brockhaus verw. Stahlschmidt; 1912:
Klempnermeister Carl Thomee und Henriette geb. Henkelmann; 1928: Wwe. Karl Thomee;
Nr. 76 Huxholls- oder Tümmer-Haus (Friedhof-Haus), (Pz 175); Bes.: Johan
Friedhof, Tönnis Tümmer, Huxholl; 1809, 1817, 1830: Peter Heinrich Alberts,
Fuhrmann; 1837: Adam Kray für 310 Tlr.; 1848 brannte das Haus ab, wurde aber nicht
wieder aufgebaut. Die Hausstelle wurde an die Nachbarn aufgeteilt.
Nr. 77 Blaufärbers-Haus; das Haus war belastet mit einem 1/2 Winkel
(Hafer?), je zur Hälfte an das ref. und luth. Pastorat; Bes.: Hans Joachim
(oder Hammerschmidt)?, (Pz 174); 1775: Johannes Vosloh; Schumacher; 1861: Schneider
Heinrich König für 420 Tlr.; 1900: FA Rudolf König;
Nr. 78 Jobst Haußmann (+ vor 1725), (Pz 171); 1725: Christoph Hausmann;
1830: Gerichtsscheffe Johan Heinrich Thomee und Elisabeth geb. Selter; 1844 n. S.:
Drechsler Peter Rentrop (590 Tlr.); 1856: Jacon Lennhoff; 1878: Schlachter Isaac
Lennhoff; 1900: Metzgermeister Moritz Heilbronn und Rika (?) geb. Lennhoff;
1911: Metzger Alex Heilbronn; 1928: Alex Heilbronn; 1938: Schuhmacher Otto Großheim;
Nr. 79 Das Storchen-Haus (Pz 172), Bes.: Johannes Hammerschmidt; 1725:
Joh. Bernd Hammerschmidt, Tuchmacher; 1830: Glaser Pet. Diedrich Groll
erwarb das Haus aus der Spiekermannschen Subhastation; 1928: Wilhelm Frank u. Ehefrau;
Nr. 80 Lüermann Haus - muß wahrscheinlich heißen Liermanns-Haus (Pz 170,
50 Tlr.); 1830: Wwe. und Erben Friedrich Lück; 1900: Schneidermeister Johann
Prangel; 1918: Bahnarbeiter Wilhelm Müller; 1929: Albert Müller;
Nr. 81 Leiendecker-Haus (Pz 192, 45 Tlr.); Johan Henrich Weiß - 1714 bei
Christoffel Klumpe in die Tuchmacher-Lehrer, 1721 Meisterstück; 1725: Wittib
Weiß, Bäcker u. Brauer;1758: Johan Henrich Weiß, Wollspinner u. Bierbrauer;
1775: Arnold Weiß; 1833, 1850: Friedrich Schmalenbach; hinter dem Hause erwarb
Schmalenbach ein kleines Grundstück, errichtete darauf eine Stallung mit
Überbau (wie Kobbenrod), welche ... ein Hintergebäude des Wohnhauses Nr. 81 bildete;
1852: Katholische Kirchengemeinde erwarb die Hausstelle, worauf später das
Kirchengebäude, Schulstr. 1, und Schulgebäude mit Lehrerwohnung, Friedrichstr.
Nr. 82 Esselen-Scheune bzw. Viehhaus (Pz 169 a+b), Richter Esselen 1646 an sich
gebracht; das spätere sogenannte "Tiggeses Haus"; 1725: Steffen Krohnen Hauß, Tuchmacher;
19.09.1825 aus der Kattwinkelschen Subhastation; 1830: Nadler Arnold Aßmann; 1852: Teil a
nach S. erwarb Friedrich Wilhelm von Toenges beide Teile und vereinigte sie wieder zu
einer Hausstelle; 1861: Diedrich Wilhelm Wirths; 1864: n. S. Kaufmann Friedrich Schmits
aus Lüdenscheid; 1864: Bergmann und Brennermeister Carl Weimann u. Mar. Cath. Langenbach;
1881: Wohnhaus-Reparatur (Bauakten); 1869: Stallneubau auf IX/144; 1897: Packmeister
August Kuhnen; 1903: Fuhrunternehmer Friedrich Rentrop; 1928: Friedrich Rentrop;
Nr. 83 Anthony-Haus (Pz 193); 1725: Johan Henrich Brockmann, Tuchmacher;
1758: Peter Hanebeck, Tuchmacher und Weißfäber; 1772 und 1775: Erben Hanebeck;
1791: Stephan Henrich Hanebeck; 1809 und 1817: Joh. Henrich Tusch; 1830: Caspar Heinrich
Tusch, Wirt;
Nr. 84 Klumpen-Hausstätte (Pz 195); 1725: Clumpe modo Henrich Koch (ist von
einem Tuchmacher bewohnt worden); 1809 und 1817: Gerichtsschreiber Friedrich Schantz;
1830: Peter Diedrich Wüllner; Instrumentenmacher Caspar Heinrich Schulte hat das
Wohnhaus mit dem Haus und Düngerplatz von Wüllner für 538 Tlr. käuflich erworben;
Nr. 85 Stoffel Malthan (?, L.L. 89,34) (Pz 216); 1725: Henrich Malthan, Tuchmacher;
1827: Subhastation (gerichtl. Zwangsversteigerung), meistbietend: Schullehrer Friedr. Malthan zu Bremcke; 1827: Scheffe
Johann Heinrich Thomee; 1832: Carl Tusch und Ehefrau Mar. Cath. geb. König meistbietend
für 300 Tlr. ; 1843: dessen Witwe 1/2 und deren 3 Kinder 1/2; 1853: statt der Witwe deren
2. Ehemann Hermann Diedr. Lösenbeck; 1855: statt des verstorbenen H. D. Lösenbeck der
H. B. Friedrich Tusch 1/4 und Caroline Tusch 1/4; 1860: Eheleute Heizer Carl Kling und
Caroline geb. Tusch 5/8 und Carl August Tusch 3/8; 1866: statt der Eheleute die geschiedene
Ehefrau Caroline 5/8; 1868: Kohlenhändler C. H. Siepmann und Caroline geb. Tusch; 1902:
Gebr. Löwenthal; 1928: Firma Gebr. Löwenthal (Pz 1902/216 etc.); 1938: Spar- und Darlehnskassen Verein eGmbH;
Nr. 86 Holländers-Haus (Pz 215); 1725: Henrich Ohle, Krämer, seine Tochter Anna
Maria heiratete Caspar Henrich Schulte (XVII 140 u. 142); 1758: Johan Peter Schulte,
Tuchmacher und Tuchscherer; 1772: Johan Peter Seißenschmidt; 1777 besaß Leopold
Brockmann das Haus, 1788 und 1791 dessen Witwe; zwischen 1791 und 1805 hat Herman
Bernhard Lohmann das Haus von den Eheleuten W. Stader und Susanne Brockmann gekauft
und wieder an Bernhard Hanebeck verkauft; 1809 und 1817: Peter Bernhard Hanebeck;
1830: Bernhard Hanebeck, Lohgerber; 1834: E Schwiegersohn Gastwirt und Lohgerber
Wilhelm Küsterer; 1846: Schlächter Simon Isaac für 725 Tlr.; 1861: Ü.V. Metzger Jacob
Lennhoff (Sohn); 1876 Kohlenhändler C. H. Siepmann und Caroline geb. Tusch, geschiedene
Frau Karl Klinge; 1876: Kaufmann Friedrich Siepmann und Kohlenhändler Heinrich
Siepmann; 1903: Heinrich Siepmann; 1931: Kaufmann Friedrich Siepmann; 1936: Sattler
Albert Westhelle;
Nr. 87 Römers Haus (Nr. 149/154) (Pz 198/199); Es war belastet mit 7 Stüber und vier Hühnern
jährlich, je zur Hälfte an den luth. und ref. Pastor (8, 42a); 1725: Esselen-Haus, sel. Brgmstr. Esselen
Haus, darin Herman Vogt; wurde nach dem Brande von Adam Thomee und Langenbach
wieder aufgebaut; 1758 Teilung der Parzellen 198 und 199; Parzelle 198: 1758 Adam Thomee,
Tuchmacher und Gemeinheitsvorsteher; 1772: Christoph Thomee junior und Witwe Adam Thomee;
1775, 1783, 1788, 1791 und 1809: Gemeinheitsvorsteher Thomae; 1830 Tuchfabrikant Pet. Friedrich
Thomee; Parzelle 199: 1758 Joh. Died. Langenbach, Sensenschmied und Gemeinheitsvorsteher;
bis 1788: Vorsteher Langenbach; 1791 geteilt: Wwe. Bernhard Ohle 1/2 und Jobst Henrich Ohle 1/2;
1809: Jobst Ohle; 1817: Bernhard Sauerland; 1830 Erben Bernhard Sauerland; 1843 soll Stadtsekretär
und Gerichtsaktuar Julius Hölterhoff mit seiner Familie im Haus 87 gewohnt haben;
Nr. 88 Hagedorns Haus; 1725: Christoffel Hagedorn, Tuchmacher, Kirchmeister 1706, 1707
und 1709, gestorben Juli 1729; 1730 erbt der Schwiegersohn Johan Herman Hegman, Tuichmacher,
das Haus. Er hatte die älteste Tochter des Chr. Hagedorn zur Frau; 1744 hatte das Haus noch ein
Strohdach. Er wurde aufgefordert, sein Haus mit Ziegeln zu decken; 1775, 1783, 1788, 1791: Küster
Johan Wilhelm Thöne; 1862: Subhastation, meistbietend Wilhelm Kaiser; 1863: Subh. Gustav Klumpe;
1895: Witwe ?amenhändler Gustav Klumpe, Alwine geb. Stahlschmidt; 1909: Konditor Robert
Klumpe und Briefträger Ernst Klumpe; 1924: anstatt Ernst Klumpe die ledige Berta Klumpe;
1944: anstatt Bertha Klumpe der Lehrer a. D. Albert Klumpe, Halver; 1946: anstatt Robert Klumpe
dessen Ehefrau Hedwig Dresel;
Nr. 89 Hofmans-Haus (Pz 213); Servas Johannes Klumpe (+ 1690); Johan Peter Servas oder
Klumpe, gewinnt das Amt in der Tuchmacherzunft erst 1664; Witwe Klumpe, Maria geb. Steffens
und/oder Sohn Johannes liehen sich 1705 von der ref. Gemeinde 15 Rtlr. und setzten dafür ihr Haus
zum speziellen Unterpfand; 1725: Johan Clumpe (lt. Brandakte von 1725: Johann Rumpen Hauß),
Königlicher Grenadier zu Potsdam, 1707 Meisterstück der Tuchmacher-Zunft; 1856: K(äufer) Gerhard
Boedts, Kaufmann; 1868: E(rbe) Witwe zu 1/2 und Kinder; 1879: E Hugo und Alberts Boedts, Kaufleute;
1915: E Albert Boedts; 1940: Hans Hahn, Kaufmann; 1948: Witwe Hans Hahn geb. Lask und Sohn Hans
Friedrich Hahn;
Nr. 90 Borris-Haus (gehört zu 91, Vorgeschichte siehe dort); 1725: Christoph Betzler, Tuchmacher;
1901: Barbier Heinrich Wilhelm Seißenschmidt;
Nr. 91 Borris-Haus (Pz 210), Henrich Esselen gt. Borris; 1725: Caspar Essellen genannt Burris
(Borris), Tagelöhner; 1758, 1772, 1775, 1783, 1788 und 1791: Joh. Hermann Betzler, Tuchmacher (eine
Generalreparatur des Hauses erfolgte 1782 für 263 Tlr. 21 stbr. (XVII/1); 1873: Kauf durch Küfer Heinrich
Knepper; 1889 hatte das Kneppers-Haus einen starken Dachstuhlbrand; 1893: Winkelier Christoph Heinrich
Meister; 1900: seine Witwe Karoline geb. Solms und Kinder Elfriede, Emma, Martha und Paul Ewald; 1901:
Ehefrau Schuhmacher Johann Schmidt, Karoline geb. Solms verw. Meister; 1903: Lagerhalter Heinrich Solms;
1934: Schuhmachermeister Heinrich Solms und Krankenkassensekretärin Pauline Solms;
Nr. 92 Ohlen-Haus (Pz 200/201), 1662: Herman von Ohle; 1697: Witwe Johan von Ohle; 1709 und
1725: Joh. Diedr. Schulte, Tuchmacher; ab 1788 Trennung der Parzellen 200 und 201; Parzelle 200: 1902
Rendant Adolf Schöttler; Parzelle 201: Johannes Kern;
Nr. 93 Schauerten-Haus (Pz 202, 65 Tlr.), Diedrich Schauerte (S. 229, Nr. 5); zu diesem Haus gehörte
ein Spieker, wofür Diedrich Schauerte (später Wwe. Peter Rüdiger Wolff) jährlich 3 Stüberzur Hälfte an den
reformierten und dto. an en lutherischen Pastor zahlen mußte. Gleichzeitig gehörte dem Diedr. Schauerte das
Wortmann-Haus. Hierfür zahlte er 5 Stüber an die beiden obigen Pastoren; 1725: Christoffel Diedrich Schauerte,
Tuchmacher; Tausch von 1739: Joh. Diedrich Boeley; Wwe. Peter Rüdiger Wolff geb. Boeley; 1788, 1791, 1809
und 1830: Caspar Heinrich Schmalt;
Nr. 94 Wortmanns-Haus (9, 44), auch Neuheusers Haus (Pz 203, L.L.227, 4); 1725: Caspar Plettenberg,
Tuchmacher; 1809: Gerichtsaktuarius Plettenberg; 1830: Theodor Plettenberg; 1835: Winkelier
Friedrich Kühne, 1841: Heinrich Wilhelm Kühne, 1928: Wwe. Wilhelm Kämpfer/August Kämpfer.
Nr. 95 Der Wiedemhof m. Scheune, zus. 125 Tlr., 1. luth. Pastorat
Nr. 96 Haus "Unter den Linden" (Pz 204, 45 Tlr.); 1928: Heinrich Holthaus Ehefrau
Nr. 97 Kollbuß-Haus am Kirchhofe (Pz 209, 100 Tlr.); 1928: Kaufmann Albert Boedts, 1970: Hans Hahn
Nr. 98 gehört zu dem Benificio S. Stephani, Pz. 208; 1928: Wwe. August Lüsebrink
Nr. 99 Hauptmann Voßens-Haus, Johan Voß, Hauptmann (Pz 207, 60 Tlr.); 1830: Friedr. Hollmann
Nr. 100 Joh. Anthon Essellen, Tuchmacher (Pz. 132?, 232)
Nr. 101 Gerdis-Haus: Tuchmacher Christian Gerdis und Anna Dorothea Hammerschmidt (Häusgen, brannte 1725
ab, war mit 30 Tlr. versichert, Pz. 1535/205); 1725/26 Tuchmacher Peter Diedrich Seißenschmidt; 1758
Wollspinner Christoph Betzler Kinder, Pächter: Joh. Wilhelm Schmalt; 1772: Wilhelm Klumpe;
1775: Erben Betzler; 1928: August Betzler; 1940: Ehefrau des Kaufmanns Ernst Scholz, Helene geb. Betzler;
1970: Ruth Wolff
Nr. 102 "Romers Stette" (Pz 163,164,165, 65 Tlr.); 1928: Karl Voss (Pz 913/163), Fabrikant Albert Voss
(Pz 1853/163), Fabrikant Gustav Voss (Pz 1854/163), Küster Karl Voss (Pz 914/163);
Nr. 103 Lehrhagens-Haus
Nr. 104 Die Dullegos Hausstätte (Pz 161,162, 80 Tlr.); belastet mit 5 Stüber je zur
Hälfte an den luth. und ref. Pastor; 1689 baute Stoffel Eringhauß auf die Dullegos Hausstätte
wieder auf; 1725: Witwe Stoffel Eiringhaus (ohne Profession) - Haus brannte 1725 ab, versichert
mit 80 Taler; vor 1758 wurde das Haus geteilt; 1758: Tagelöhnerin Wwe. Ursula Eyringhaus 1/2
(104/1), Henrich Eyringhaus 1/2 (104/2); 1772: Wwe. Ursula Eyringhaus 1/2 (104/1), Henrich Bernhard
und Johan Wilhelm Eyringhaus 1/2 (104/2); 1775/1783: Wilhelm Eyringhaus 1/2 (104/2), Bernhard
Eyringhaus 1/2 (104/1); 1791: Wwe. Bernhard Eyringhaus 1/2 (104/1), Peter Diedr. Schlüchter 1/2
(104/2); 1809: Peter Stöcker 1/2 (104/1), Wwe. Pet. Diedr. Schlüchter 1/2 (104/2);
1817: aus König'scher Subhastation (Versteigerung)
Friedrich Kühne (104/1); 1834: Heinrich Wilh. Kühne (104/1); 1837: Peter Selle (104/1); 1855:
Schlosser Friedr. Wilh. Gregory (104/1); 1829: Wollspinner Joh. Peter Caspar Schlüchter und
Maria Cath. geb. Rasche (104/2); 1847: Wwe. J. P. C. Schlüchter mit 3 Kindern (104/2); 1862:
Christoph Heinrich Friedrich Schlüchter zu 5/6, und Pet. Wilh. Heinr. Schlüchter zu 1/6 (104/2);
ab 1869 Kaufmann Albrecht von Banchet, beide Teile zusammen; Wegener
Nr. 105 Häuslein oder Spieker (Pz 160/2121); 1725: Tuchmacher Diedrich Wiese;
das Häusgen brannte 1725 ab, es war versichert mit 40 Tlr.; 1758: Wollspinner Christoph Wiese;
1772: Wwe. Christoph Wiese; 1775: Wwe. Wiese et Langenbach; 1783/1809: Diedr. Langenbach
1817/1830: Moritz Becker und Maria Cath. Langenbach; 1843: Wwe. Moritz Becker; 1849: die Kinder
deren Tochter Sophie, verehelichte Weiß, nämlich Carl Wilhelm, Julie und Line Weiß; 1871:
Lohgerber Gustav Schulte und Julie geb. Weiß; 1876: Fabrikant Albrecht von Banchet; 1928:
Albrecht von Banchet Erben
Nr. 106 ein Viehhaus (vor 1667); 1667 Diederich Habbel; Johan Peter Klumpe vulgo Habbels; Christoffel Klumpe;
1725: Maurer Stoffel Habbel; Christo Kissing; 1772, 1775, 1783, 1788: Friedr. Kissing; 1791: Christoph Henrich Kissing
1809, 1817, 1830: Joh. Christoph Kissing (Förster);
Nr. 107 Diedrich Allhoff, Tuchmacher (1725), (Pz 157/158, 56 Tlr.); 1775: Wwe. Moritz
Allhoff; 1783/1791: Küster Christoph Allhoff; 1788 war Peter Arnold Stemper Mitbewohner des
Hauses; 1809/1830: Tuchfabrikant Christoph Friedrich Allhoff und dessen Sohn Christoph Ferdinand A.;
1832: Sophie Allhoff; 1845: Küster Carl Allhoff; 1861 verkaufte
der Küster seine Haushälfte an den Ziegelbrenner Friedrich Claus; 1874: des Küsters Kinder; 1891: Fabrikant
Albrecht von Banchet; 1918: Gustav Kniewel; 1928: Carl Cramer (Pz 157), Gustav Kniewel (Pz 158);
Nr. 108 Franz Twelcker (Pz 156, 45 Tlr.); 1928: Arnold Maas u. Ehefrau (Pz 156)
Nr. 109 Wittibe Peter Eyringhaus, Tuchmacher (1725), (Pz 155, 50 Tlr.); 1928: Arnold Maas u. Ehefrau (Pz. 155).
1758: Tuchmacher Friedrich Kissing
Nr. 110 Sturm-Haus (Pz 154, 125 Tlr.); 1725: das reformirte Pastorath-Haus; 1928: Evgl. Pfarrhaus ("Kinderlehre");
Nr. 111 Thoenenhaus (Pz 156, 95 Tlr.)
Nr. 112 adliges Haus Cobbenrod mit der Scheune (Pz 240, 125 Tlr.); 1725: Königl. Richter
des Amtes Plettenberg
Nr. 113 das kleine Häuschen, so zum Hause Cobbenrod gehörig (Pz. 239?), beim Stadtbrand
mit 20 Tlr. versichert; 1725 von einem Tagelöhner bewohnt;
Nr. 114 Der Fröhmißers (Frühmesse) Spieker (Pz 238), Beneficium Mariae Virginis, ein
Spieker am Kirchhoff. So genannt, weil der Vicarius, so die Frühmesse verrichtet, und
zugleich die Schule gehalten, darin hat gewohnt. - Hammerschmidt wurde gefragt, wie es
komme, dass der Spieker voritzo von einem Bürger hieselbst, Henrich Riße Erbe und
eigenthümblich bewohnt werde, da doch dasselbe an die Schule stößet und davon nicht gut
zu nutzen. - Respondetur - 1725: Henrich Riße (lt. Brandakte "Henrich Rissen Haußgen",
versichert mit 35 Thlr.), Bäcker, Tabakspinner und Schneider. "Das Gebau auf dieser Stette
hat mein Vater S. darauf ex pro priis erbauet, ohne Zweifel in Meinung, dass es zur Schule
hernechst bleiben könnte; allein die Gemeinde hat ihm seine exposita, so er in seinem
Rechenbuche notiert und von verschiedenen Quittung genommen gehabt, nicht wiedergegeben,
vielmehr Er dem Kellermann zu Dankelmert u. S. 91; 1758: Schneider u. Bäcker Henrich Riße;
1772, 1775, 1783, 1791 Albertus Mertens; 1809: Henrich Mertens 1/2 u. Joh. Henrich Hayn 1/2;
1815: Henrich Mertens; 1817: Henrich Mertens; 1830: Karl Mertens; 1889:
Fabrikant Wilhelm Seissenschmidt und Eleonore geb. Dunkel; 1901: Witwe Fabrikant Wilhelm Seissenschmidt;
1936: Dipl.-Ing. Egenolf Engelhard; 2003: Garage Fritz Sperber;
Nr. 115 Lutherische Schule, 1725 abgebrannt, war versichert mit 10 Tlr.
Nr. 116 Langen-Haus, Anthon Lange; 1725: Engelbert Lange, Brodtbäcker; 1830: Wwe. Quincke geb.
Kissing aus Iserlohn;
Nr. 117 Springops-Haus (Pz 236); 1725: Jobst Grüber, Schuster; 1830: Peter Bremicker; 1928: Wilhelm Rottmann
Nr. 118 Dören-Haus, (lt. Kataster 1689) Pz. 235, ein Spieker am Kirchplatz; seit
1710 Henrich König, Tuchmacher; 1725: Henrich König; 1758: Christoph König, Wollspinner;
1772 Witwe Christoph König; 1830: Gerhard Hermann Heinrich König nach Übertragung von seinem
Miterben; 1863: im Erbgang Apotheker Gustav Saalmann, oo1861 mit Constanze Hollmann; 1864
Julie Weiland; 1876 Schuhmacher August Schmidt; 1883: Bäcker und Wirt Heinrich Bettermann;
1919 Pfarrfond der Evang. Kirchengemeinde Plettenberg; 1931 Drogist Paul Kathagen;
Nr. 119 Das Obertor
Nr. 120 Das Untertor
Nr. 121 Das Rathaus
Nr. 122 Die Kirche (3022 Tlr.)
Nr. 123 2 Turm-Gefängnisse (45 Tlr.)
Nr. 124 erbaut 1722 von Joh. Peter Hanebeck, abgebrannt 1725;
Nr. 133 Am Offenborn, 1785 baute Joh. Christoph Korte dieses Haus
an seiner Mutter Haus (XXI/c 11/1; 1788, 1791, 1809, 1817,1830: Joh. Christoph Korte;
1832: Caspar Korte und Maria Catharina Siepmann; 1845: S Friedrich Arnold Korte;
1846: Schuhmacher Wilhelm Brücher; 1884: Schneider Heinrich Brücher 1/2 und Fabrikant
Wilhelm Brücher 1/2; 1897: FA. August Neuß; 1909: FA. Wilhelm August Klumpe; 1912:
FA. Peter Lerch; 1936: Elektriker Wilhelm Linde; 1946: Elektromeister Adam Brehmer;
Nr. 134 Am Offenborn Schmiede; diese Hausstelle war 1790 noch unbebauter
Gemeinheitsgrund und seine Größe betrug vorn 22 Fuß, hinten 31 Fuß, an Kortens
Hausseite nach Abzug des Grabens 24 Fuß, an Hillringhaus Seite 28 Fuß. Der
Schlossermeister Diedrich Becker wollte seine Schmiede aus seinem gegenüberliegenden
Haus auf diesen Platz verlegen und stellte daher beim Magistrat den Antrag, ihm
diesen gegen jährliche Zahlung von 15 stbr. zu überlassen. Der Nachbar Hilleringhaus
erhob dagegen Einspruch, da er bisher seinen Mist auf diesen Platz gelegt und
seitwärts eine Tür zu seinem Hause habe, die dann nicht mehr benutzt werden könne.
Sein Nachbar Joh. Christoph Korte wies darauf hin, dass ihm 1786 63 qm Quadratfuß
von diesem Platze vom Magistrat verkauft worden seien. Die Genehmigung erfolgte
Hamm, 05.04.1791; 1791: Schmied Diedrich Becker; 1809, 1817, 1830: Johann Christoph
Korte; Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Schmiede in ein Wohnhaus mit Stall
umgeändert; 1920: FA. Albert Huß zu Rosenthal bei Holthausen; 1934: Wwe. Briefträger
August Winkemann, Emma geb. Elhaus, der dieses Haus mit dem Haus Pz 135 vereinigte.
Angaben über einzelne Häuser
(Aus dem Protokollbuch des Presbyteriums der Evang. Kirchengemeinde Plettenberg,
übertragen von H. Hassel 25.11.2010)
18. October 1871
2. Nach der am 18. August c. präsentirten Benachrichtigung der hiesigen
Kreis-Gerichts-Commission vom 13. Mai c. hat die Direction der Provinzial-
Feuerversicherung das Wohnhaus No. 135 des Friedr. Claus von
1.000 r auf 700 r ermäßigt; es wird dadurch unsere Sicherheitsberechnung
vom 1. Februar c. um 150 r vermindert und genügt die Sicherheit für das
eingetragene Kapital von 473 r 32 stbr oder 363 r 13 sgr 10 Pfg nunmehr
nicht mehr; resp. die Genehmigung der Königl. Regierung vom 14. Februar
c. A. V. 829 wesentlich alterirt. -
ad 2. Der anwesende Presbyter H. Claus erklärt, diese Angelegenheit bis
zur nächsten Sitzung in Ordnung zu bringen.
3. Ebenso hat nach einer ähnlichen Benachrichtigung, welche mir
von dem Rendanten Claus vor einigen Wochen vorgelegt worden ist, dieselbe
Direction die Versicherungssumme des Wohnhauses der Wittwe Myrthe resp.
ihres Schwagers Rentrop - hierselbst - bedeutend ermäßigt, und ist dem Claus
von mir aufgegeben worden, das darauf eingetragene Kapital des Christoph
Potthoff-Vaters resp. Schwiegervaters der Genannten, wegen Insuffizienz
der Sicherheit sofort zu kündigen, welches auch geschehen ist.
ad 3. Die Kündigung wird gutgeheißen.
16. Juni 1873
12. Der Antrag des Theodor Panne, Schusters hierselbst, auf ein Darlehen von
350 r. Zur Sicherheit offerirt derselbe sein in hiesiger Stadt belegenes zu
850 r versichertes Wohnhaus No. 107. - Muss die Genehmigung
nach der noch erst zu bewerkstelligenden Umschreibung des Hauses auf
Panne nachgesucht werden.
ad 12. Genehmigt. Die Obligation resp. Cession ist bei Gericht aufgenommen
d 26/11 73.
Fortsetzung Häuser Pz. 135 ff.
zurück
|