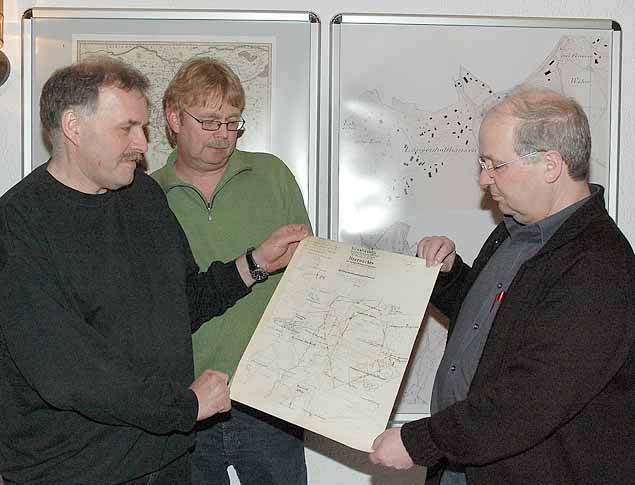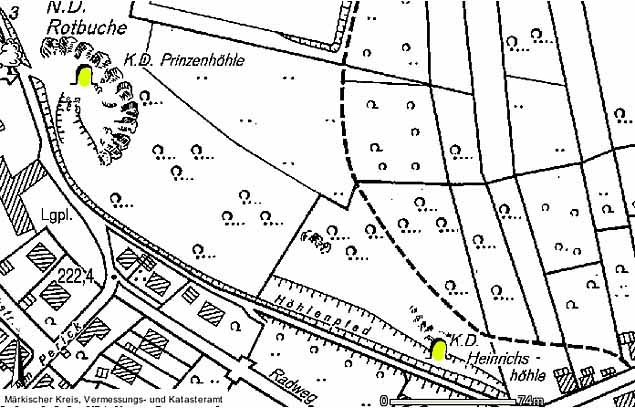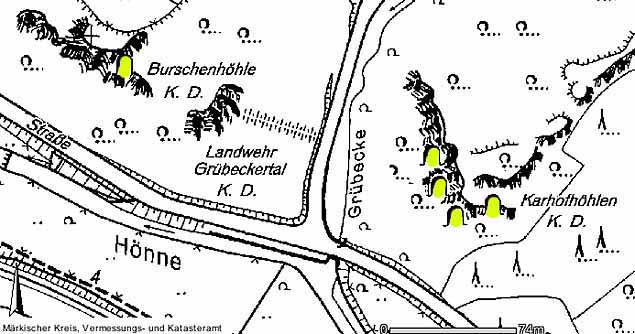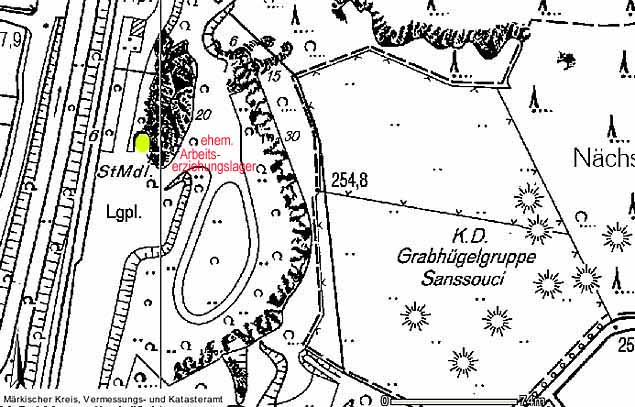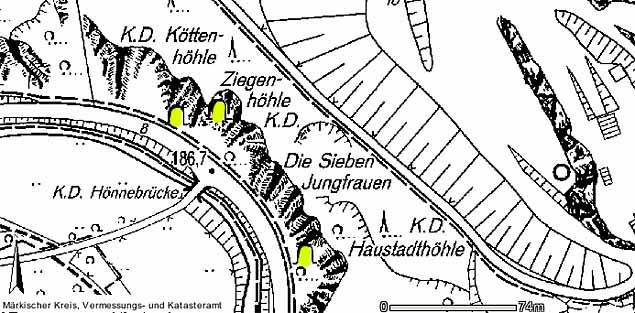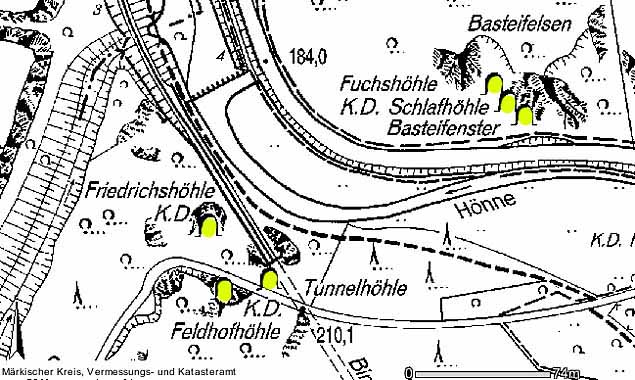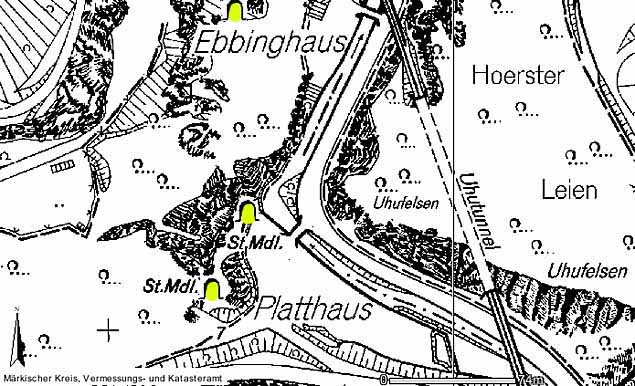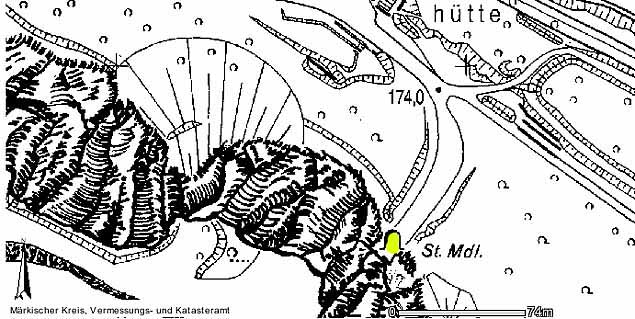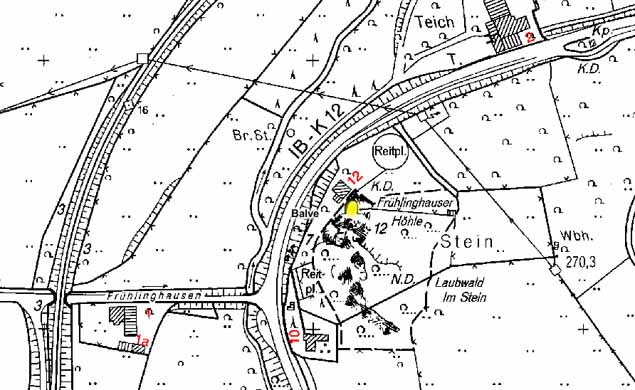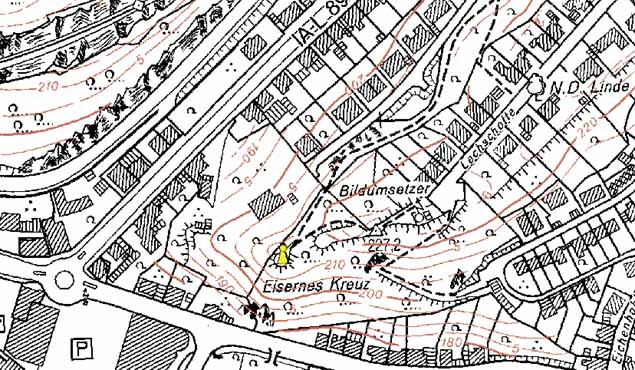|
Böingser-Höhle Dachs-Höhle Dahlmann-Höhle Karhof-Höhlen Leichen-Höhle Preuß-Höhle
Alte Höhle Burg-Höhle Tunnelhöhle Feldhofhöhle Reckenhöhle Honert-Höhle Otto/Christian
"Schwalbe 1" Volkringhauser Höhle Wocklumer Höhle Kehlberg-Höhlen Felsenmeer
Quelle: Westfalenpost vom 20.09.2006
Bergbau-Wanderweg
Langenholthausen. (sim)
Drei heimatverbundene Männer
haben sich die Aufgabe gestellt,
die Bergbaugeschichte
Langenholthausens zu erforschen
und ihre Erkenntnisse
der Nachwelt zugänglich zu
machen. Das größte Projekt
ihrer Arbeit ist der Bergbau-
Wanderweg rund um Langenholthausen.
Der ist mittlerweile
fertiggestellt und so können
Ronald Förster, Michael
Aßhoff und Engelbert Lazer
für Sonntag, 24. September,
zur offiziellen Einweihung des
Wanderweges einladen.
Für diese Einweihung, die
um 10.30 Uhr auf dem Barbara-
Träger-Platz beginnen soll,
haben die Mitglieder des Historischen
Vereins Langenholthausen
auch einen Vertreter
des Oberbergamts und
den Museumsleiter des Märkischen
Kreises, Stephan Sensen,
eingeladen. Ebenso die
Familien, die früher einmal
Bergbau im Gebiet von Langenholthausen
betrieben haben.
„Graf Landsberg musste
leider absagen, weil er am 24.
September im Ausland ist”,
berichtete Ronald Förster im
Vorfeld.
Auch die Stadt Balve wird
vertreten sein. Zwar hat der
Bürgermeister selbst keine
Zeit, er hat aber die Entsendung
eines Vertreters zugesagt.
An die Feier vor dem Hinweisschild
auf dem Barbara-
Träger-Platz soll sich eine
Führung über den Bergbauwanderweg
rund um Langenholthausen
anschließen. In
dieser Führung will Engelbert
Lazer die acht Gruben, den
Stollen, das Heiligenhäuschen,
das einmal von einem
Steiger gestiftet wurde, den
Platz der ehemaligen Eisenhütte
und die ehemalige Mühle
von Langenholthausen vorstellen.
Alle diese Punkte wurden
vom Verein mit Hinweisschildern
ausgestattet, so dass
der Wanderer eine genaue
Vorstellung von der früheren
Eisengewinnung in Langenholthausen
bekommen kann.
Der Bergbau-Wanderweg
in Langenholthausen weist
auch eine direkte Verbindung
zur Luisenhütte in Wocklum
auf, so dass alle, die an der
Technik-Geschichte des
Sauerlandes interessiert sind,
diese beiden Sehenswürdigkeiten
gut miteinander verbinden
können.
Quelle: WR Lüdenscheid vom 31.07.2006
Bergbau im Hönnetal "noch viel älter"
Märkischer Kreis. (pk) Die Höhlenforscher von Wolfgang Hänischs
Speläogruppe"Sauerland" haben vor Jahren bereits die tausendjährige
Geschichte des Bergbaus im Hemeraner Felsenmeer nachweisen können.
Jetzt liegen neue Erkenntnisse auf noch älteren Bergbau in dem
preisgekrönten Hemeraner Geotop und Naturschutzgebiet vor, das
doch auch ein von Menschenhand geschaffenes Kulturdenkmal ist.
Die Speläogruppe will ihr neues Wissen über die älter werdende
Kulturgeschichte des Felsenmeers der Öffentlichkeit demnächst
bekannt geben. Die Höhlenforscher, die ihr Domizil im Kulturbahnhof
Binolen haben, konzentrieren sich momentan noch sehr stark auf
das Naturschutzgebiet im mittleren Hönnetal. Mit Grundbesitzern
und Naturschützern gemeinsam haben die Speäologen eine
"Aktionsgemeinschaft Landschaftsschutz Hönnetal" gegründet,
wobei Hänischs Verein die Aufsichtspflicht vom Uhufelsen bis
nach Volkringhausen übernommen hat.
Die seit Jahren regelmäßigen Kontrollgänge mit Dienstausweisen
in dem empfindlichen Naturschutzgebiet finden mittlerweile als
konzertierte Aktion mit dem Werksschutz der Firma Rheinkalk statt.
Hänisch berichtet von "schlimmen Sachen", die jahrelang im Hönnetal
geschehen seien. Gemeint sind sind nicht nur die illegalen Bergsteiger,
sondern noch mehr esoterische Gruppen, die die Hönnetaler Höhlenwelt
für ihre Schwarzen Messen heimsuchen. Für Esoteriker gebe es
kommerzielle Reiseanbieter: "In der Grübecke standen drei Busse für
zwei Höhlen!".
Quelle: Westfalenpost Menden/Märkischer Kreis vom 13.05.2006
Felsenmeer gemeinsam
Hemer. Dem Hemeraner Felsenmeer
wurde gestern das
Prädikat National Geotop
verliehen. Die Preisverleihung
erfolgte im Rahmen des Geoforums
2006 „Die bedeutendsten
Geotope Deutschlands”
in Hannover. Die Urkunde
nahmen Bürgermeister
Michael Esken, Umweltsamtleiter
Edgar Schumacher und
Werner Weber von der Arbeitsgemeinschaft
Höhle und
Karst im Niedersächsischen
Landtag entgegen.
Damit reiht sich das
Kalksteingebilde in die Liste
von 77 Denkmälern ein und
wird in einem Atemzug mit
den Extersteinen, der Insel
Helgoland und dem Siebengebirge
genannt.
Das Felsenmeer ist ein in
Deutschland einmaliger Geotop.
An der Oberfläche des
hier anstehenden mitteldevonischen
Massenkalks hatte
sich im feuchtwarmen Klima
der Tertiär-Zeit eine Kegelkarstlandschaft
gebildet, die
mit ausgedehnten Höhlen im
Untergrund verbunden ist.
Dadurch, dass diese Karstlandschaft
während der Eiszeiten
durch Lössaufwehungen
plombiert wurde, blieb sie
bis heute erhalten. Sie wurde
erst in geologisch jüngster Zeit
durch Verwitterung und Abtragung
teilweise wieder freigelegt.
Seit 1968 steht das Felsenmeer
unter Naturschutz. Bis
zum Jahr 1988 war es aber frei
zugänglich. Bedingt durch die
zahlreichen Spaziergänger
und Kletterer konnte sich zwischen
den einzelnen Klippen
kaum Bewuchs bilden. Im
Jahr 1988 wurde das Gelände
umzäunt. Die Besucher nutzen
einen Rundweg, der außen
um das schluchtartige,
insgesamt drei Quadratkilometer
große Gebiet herumführt.
Bei den bedeutendsten
Geotopen handelt es sich um
herausragende geowissenschaftliche
Objekte in
Deutschland. Deshalb müssen
es Geotope sein, die erdgeschichtliche
Vorgänge, die
Entwicklung des Lebens, geologische
Prozesse, geomorphologische
Eigenheiten oder
geologische Sehenswürdigkeiten
von außergewöhnlicher
Ausprägung repräsentieren.
Quelle: Wikipedia
Die Heinrichshöhle . . .
. . . ist eine im Hemeraner Stadtteil Sundwig gelegene Tropfsteinhöhle.
300 Meter der Höhle sind für Besucher zugänglich und als Schauhöhle ausgebaut, was
allerdings nur ein Bruchteil der Gesamtgröße ist. Die Heinrichshöhle ist Teil des
Perick-Höhlensystems mit 3 Kilometer Ganglänge. Das benachbarte Felsenmeer ist Teil
des gleichen Karst-Gebietes aus dem Mittel-Devon, das sich von Hagen bis nach Balve
erstreckt. Weitere Schauhöhlen dieses Gebietes befinden sich in Iserlohn (Dechenhöhle)
und Balve (Reckenhöhle).
Das in der Heinrichshöhle gefundene Skelett eines Höhlenbären wird in der Höhle ausgestellt.
1804 wurden von den Paläontologen Georg August Goldfuß und Johann Jacob Nöggerath 18 komplette
Skelette in der Höhle entdeckt. Da keinerlei Bärenkot in der Höhle gefunden wurde, sind
die Knochen vermutlich bei Überschwemmungen in die Höhle gespült worden.
Die Höhle wurde offiziell zwar erst 1812 von Heinrich von der Becke entdeckt, war aber
den Anwohnern wohl schon lange zuvor bekannt. Bereits 1771 zeigt eine Karte den Höhleneingang.
Als Schauhöhle eröffnet wurde sie am 22. Mai 1904 auf Betreiben des Gastwirtes Heinrich Meise,
in dessen Saal nahe der Höhle auch zunächst das Höhlenbärskelett ausgestellt war. 1905 wurde
eine elektrische Beleuchtung eingebaut. Die Heinrichshöhle war damit die erste elektrifizierte
Westfalens. Die 110-V-Leitungen sind heute bereits teilweise mit Tropfsteinen überwachsen.
Eine neue Beleuchtung wurde 1976 eingebaut.
Quelle: www.7grad.org
Burschenhöhle und Karhofhöhlen
Die Burschenhöhle war schon in der menschlichen Frühzeit bewohnt. Die Menschen
bauten damals mit Hilfe von Mammutstoßzähnen und Fellen vor der Burschenhöhle
eine Art Vorhang, der vor Wind und Wetter schützte. Die Höhle gehört zu den
Höhlen mit paläolithischen Höhlenfunden im Hönnetal.
Die Burschen-Höhle
Die Burschenhöhle liegt oberhalb des Ortes Binolen im Hönnetal und erinnert
stark an die französischen Felsschutzdächer, die "Abris sous roches" im Tal
der Vezere. Sie ist 13 Meter breit, 5 Meter hoch, aber nur 7 Meter tief.
Den sonderbaren Namen erhielt die Höhle, weil des öfteren Wanderburschen
in ihr übernachten; darum wird sie auch vielfach "Monarchen-Höhle" genannt.
Kleine Burschen-Höhle
Etwa 20 Meter südlich der Burschen-Höhle liegt im gleichen Massiv die
Kleine Burschen-Höhle. Man braucht nur von der Burschen-Höhle an der
Kalkstein-Wand entlang zu schreiten, um diese Höhle, verdeckt durch einen
mittelgroßen Felsblock, zu erreichen. Beide Höhlen liegen dicht beieinander.
Länge der Höhle: 11 Meter. Eingang: Breite 0,80 Meter, Höhe 0,60 Meter.
Höhe über Talsohle 16 Meter und damit 3 Meter über dem Eingangsniveau der
Burschen-Höhle. Die Höhle ist trocken und eine Kluftfugenhöhle.
Die Karhofhöhlen sind ein Höhlensystem unter einer Felsengruppe in der
Ostflanke des Hönnetals. Bekannt sind die Karhofhöhlen für ihre reichhaltigen
Funde an Irdenwaren, Gefäßen mit Kreisstempelverzierungen und anderen Funden
der vorrömischen Eisenzeit. Die Höhle wurde bereits früh von Archäologen untersucht
und kartiert. Eine der ersten wissenschaftlichen Grabungen wurde im Jahr 1891
unter der Leitung von Emil Carthaus durchgeführt.
Ziegen-Höhle
Steht man auf der Schafsbrücke, die über die Hönne führt, zwischen
den Bundesbahnhaltestellen Binolen und Klusenstein, und schaut gegen
den Felsen "Sieben Jungfrauen", so erblickt man hoch oben im vierten
Felsen unter einer knorrigen Eiche ein kleines Felsplateau, hinter
welchem sich die Höhle versteckt. Nur so ist sie vom Tale her erkennbar.
Erreicht wird sie, indem man zwischen dem ersten und zweiten Jungfraufelsen
(von Norden gezählt) den Pfad ansteigt und über den zweiten und dritten
Felsen schließlich zur Ziegen-Höhle gelangt. Der Pfad führt scharf an
der Felskante entlang, weshalb größte Vorsicht geboten ist. Insbesondere
bei Nässe ist der Pfad sehr glitscherig und gefährlich.
Quelle: www.dechenhöhle.de
Die Friedrichshöhle liegt in den stark verkarsteten Massenkalken des oberen
Mitteldevon, am Westhang des Hönnetals in unmittelbarer Nähe der Feldhofhöhle.
Sie wurde Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts entdeckt (55 m). Im Jahr
1976 gelang Wuppertaler und Letmather Höhlenforschern (heute beide Speläogruppe
Letmathe) durch Bezwingung des Nacktschlufes und Freilegung des sogenannten
Steinchenschlufs ein Durchbruch in bis dahin unbekannte Teile. Die Gesamtganglänge
der Höhle liegt heute bei ca. 1500 Metern. Damit ist sie die mit Abstand längste
Höhle des Hönnetals. Die Friedrichshöhle zeichnet sich im vorderen Bereich durch
klare Gangprofile (Schlüssellochprofile) sowie ein reiches Vorkommen an
pleistozänen Tierknochen aus. An einer Stelle ist der Grundwasserspiegel in Form
eines kleinen Baches zugänglich.
Schlaf-Höhle
Etwa 50 Meter von der Kötten-Höhle, nördlich, im ersten Felsen der "Sieben
Jungfrauen", befindet sich auf gleicher Höhe die Schlaf-Höhle. Sie wird so
genannt, da in früheren Zeiten der hintere Raum als Schlafraum für
durchziehende Wanderburschen galt. Bei einer Eingangsbreite von 2,50 Meter,
Höhe 0,6 Meter, ist diese Höhle im dichten Gestrüpp schwer auffindbar.
Eingang fossilienreich, Länge der Höhle 6 Meter. Höhle ist nicht naturgeschützt.
(diese Aussage aus 1967 ist überholt, die Höhle ist geschützt)
Quelle: Balve, 1930, zur Tausendjahrfeier und 500. Wiederkehr der
Verleihung der Stadtrechte, S.35, von Dr. Clementine Lipperheide "Die Höhlen
um Balve"
Keppler Höhle
Als 1910 beim Bau der Hönnetalbahn die Ostseite des Kepplerberges abgeschnitten wurde, traten Höhlenverzweigungen ans Licht.
Erst 1919 wurde durch Sprengung der Kalkwerke die eigentliche, weitverweigte Höhle erschlossen, die fast ebenso schnell auf
immer wieder verschwinden sollte. Durch diese einmal gewesene Keppler Höhle machen wir die bequemste Wanderung, eine
Wanderung im Geiste. Was kümmern uns da die Engen, der schlammige Lehm, die scharfen Ecken und Zacken! Wir begeben
uns in die "Untere Höhle". Der enge Gang erweitert sich bald zu einer Grotte, die 14 Meter lang, 10 Meter breit und 7 Meter hoch ist.
Ihre Wände sind mit einem schneeig-schimmernden Prunkgewande bekleidet. Zarte Gardinen schmücken das Gewölbe, in
blitzendem Weiß zieren Tropfsteinüberzüge mit angewachsenen Säulchen die sonst grauen Wände. Wie eine Zauberhalle,
ein Märchenraum, mutet uns diese Höhle an. Zahlreich sind die dünnen, oft nur bleistiftstarken herabhängenden Röhrchen, die
einen geringeren Eindruck hinterlassen als die wuchtigen steinernen Kaskaden und die stumpfen Kegel am Boden, die oft
eine erstaunliche Größe erreichen. Die erweiterten Klüfte und schlauchartigen, nach oben verlaufenden Gänge der Unteren
Höhle führen zur Oberen Höhle, die im Durchmesser und in der Höhe 6 Meter misst.
Doch können wir nicht von dort her, sondern
durch einen Zugang von außen, der schon 1871 von Dechen bekannt war, in sie gelangen. Fast bis zur Decke ist sie mit Erdmassen
gefüllt. Durch diese Höhle und durch die Spalten der Unteren Höhle muss das Sickerwasser seinen Weg in die Tiefe gefunden
haben, so dass die "Grotte" der Unteren Höhle eine Sickerwasserhöhle, der lange Gang aber, der mit ihr in Verbindung steht,
eine typisch schlauchartige Flusshöhle darstellt. Am meisten erfreute uns auf dieser Wanderung die kleine Sickerwasserhöhle,
die Grotte, die mit ihren reichen Tropfsteingebilden eine zu einer Tropfsteinhöhle umgewandelte Sickerwasserhöhle geworden
ist. Ungleich schöner sind diese Gebilde in der bekanntesten Tropfsteinhöhle des Hönnetales, der Recken-Höhle, eine reich
geschmückte Flusshöhle.
Johannes-Höhle
Hinter dem einzeln stehenden Haus der Ortsgendarmerie Sanssouci im Hönnetal finden
wir das Kalksteinmassiv "Im Beil". In diesem Massiv befinden sich drei Höhlen:
Höhle "Im Beil"
Die Höhle "Im Beil" ist eine typische Spaltenhöhle mit 57 Meter Länge und
gefährlichen Engstellen (Schlufe). Der Eingang beträgt 0,80 Meter Breite,
die Höhe 1,20 Meter. Höhe über Talsohle: 13 Meter und damit nur 3 Meter
höher als die Dahlmann-Höhle, die in einer Entfernung von 70 Metern nördlich
im gleichen Massiv liegt. Die Höhle zeigt beträchtliche Fossilien, welche
dank ihrer Schlufe ziemlich erhalten geblieben sind. Die Höhle steht nicht
unter Naturschutz.
Höhle an der alten Schule
Die Länge der Höhle beträgt 9 Meter. Eingang: Breite 2,30 Meter, Höhe
3,00 Meter. Als sehr enge Spaltenhöhle lässt sie sich kaum befahren,
wie der Ausdruck Höhle hier auch nicht ganz treffend ist, da auf der
Länge von 9 Metern sehr häufig der freie Himmel sichtbar ist, womit
diese Höhle stellenweise den Charakter eines Kamins besitzt. In dem
gefährlichen Spalt finden sich viele Fossilien, ansonsten ist die
Höhle schmucklos. Sie steht nicht unter Naturschutz.
Quelle: "Unterirdische Zauberreiche des Sauerlandes", 1967, Heinrich Streich, S. 30
Frühlinghauser Höhle
Zwischen dem Gutshof Gransauer Mühle und dem Straßenabzweig Frühlinghausen,
südwestlich Balve, befindet sich in iner scharfen Linkskurve in einem
charakteristischen Kalksteinfelsen die Frühlinghauser Höhle. Vor der Höhle
ein einzeln stehendes Fachwerkhaus. Höhe über Talsohle: 10 Meter. Länge der
Höhle: 18 Meter. Einen eigentlichen Eingang besitzt die Höhle nicht,
vielmehr kann sie als ein Großraum bezeichnet werden mit etwa 10 Meter
Höhe am Eingang, welcher nach hinten abflacht. Vorne rechts hat man während
des letzten Weltkrieges zwei Seitengänge gesprengt, die den Anwohnern als
Luftschutzraum dienten.
Vieles deutet darauf hin, dass die Höhle als Kulturhöhle angesprochen
werden kann, was durch Ausgrabungen nachgewiesen werden müsste. Tropfstein
und Versinterung finden sich nicht mehr, dagegen zieren die Wände
Versteinerungen des Devons.
Quelle: "Höhlen des Sauerlandes", Walter Sönnecken, 1966, S.80-81
Die Kreuz-Höhle
Auf einem zwischen dem Grüne-Tal und Iserlohn gelegenen hohen und sehr
steilen Kalksteinfelsen, dem Düsing, befindet sich ein Denkmal in Gestalt
eines riesigen eisernen Kreuzes. Unterhalb dieses Denkmals liegt der
durch mächtige Steinbrocken fast verdeckte Zugang zu einer Höhle. Der
Eingang zeigt nach Süden und kann den ganzen Tag von der Sonne beschienen
werden.
Über angesetzte Grabungen oder sonstige Besonderheiten konnte bisher
nichts in Erfahrung gebracht werden. Lediglich ein Bericht aus dem Jahre
1477 nimmt Bezug auf eine Höhle bei dem Städtchen Iserlohn; es wird
aber nicht gesagt, welche Höhle gemeint ist. Da von einer nur kleinen
Öffnung die Rede ist, kann es sich meiner Meinung nach nur um die
Kreuz-Höhle gehandelt haben. Der Bericht lautet wie folgt:
"In demselben Jahr geschah in dem Lande Mark in Westfalen bei dem
Städtchen Iserlohn ein gefährliches Abenteuer. Ein Jäger nämlich jagte
da in den Bergen, und die Windhunde kamen auf die Spur eines Fuchses,
der entlief ihnen in die Höhle eines Berges, vor der ein großer Stein
lag (Foto). Davor standen die Hunde und bellten. Der Jäger kam dazu,
stieg vom Pferde und guckte in die kleine Öffnung. Da schien ihm, als
ob in dem Berge was hause. Deshalb brachte er wohl 40 Mann zur Stelle,
die mit großer Mühe den Stein von der Öffnung brachten.
Da war der Berg hohl in die Höhe und ebenso in die Länge. Darauf
gingen sie hinein mit Fackeln und sahen da Totengebein von ungeheurer
Größe liegen. Armknochen und Beinknochen so dick wie der achte Teil
einer Tonne, und einen Kopf so groß wie ein Scheffel. Sie konnten
aber zu dem Ende der Höhle nicht gelangen, denn als sie einen kleinen
Steinwurf weit darin waren, gingen alle Fackeln und Lichter aus. Da
dies der Herzog von Cleve hörte (in dessen Grafschaft Mark die Höhle
lag) gebot er bei Geldstrafe, es solle niemand hineingehen, denn er
vermutete wahrscheinlich einen Schatz von Gold darin zu finden (Quelle:
Die Lübecksche Chronik von Detmar aus dem Jahr 1477).
Weitere Quellen:
Bleicher, Wilhelm: Funde aus dem sogenannten "Kieferloch" bei der Feldhofhöhle
im Hönnetal. In: Hohenlimburger Heimatblätter für den Raum Hagen und Iserlohn.
52.1991, S. 200-202 und 211-214.
Perkuhn, Egon: Die Höhlen des Hönnetals und des Felsenmeergebietes; 10. Beitrag
zur Landeskunde des Hönnetals, Menden 1973, Hrsg.: Verein der Freunde und Förderer
des Städt. Museums Menden e.V., 38 Seiten
Pielsticker, Karl-Heinz, Hemer: Die Alte Höhle am Perick bei Hemer-Sundwig; Sonderdruck
aus Mitt. Verb. Dt. Höhlen- u. Karstforscher, 10/1964, S. 103-107
Pielsticker, Karl-Heinz, Hemer: Neue Aufschlüsse in der Kreuzhöhle bei Iserlohn;
Sonderdruck aus Mitt. Verb. Dt. Höhlen- u. Karstforscher, 10/1964, S. 81-84
Scheller, Klaus; Westhoff, Uli: Die "Keppler-Höhle" im Hönnetal als Torso. In:
Antiberg. Nr. 17(1980), S. 5-8.
Sönnecken, Walter: Höhlen des Sauerlandes, 1966, I. Teil: Kulturhöhlen, II. Teil:
Allgemeine Höhlen und Tropfsteinhöhlen, 115 Seiten
Weber, Heinz-Werner: Heinrichshöhle und Felsenmeer - Hemers faszinierende
Sehenswürdigkeiten; Hemer 1997, Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Sauerland/Hemer,
20 Seiten
Zygowski, Dieter W.: Die Höhlen im Kehlberg (Hönnetal bei Volkringhausen): ein
karsthydrologisches System en miniature. In: Dortmunder Beiträge zur Landeskunde.
21.1987, S. 79-95. |