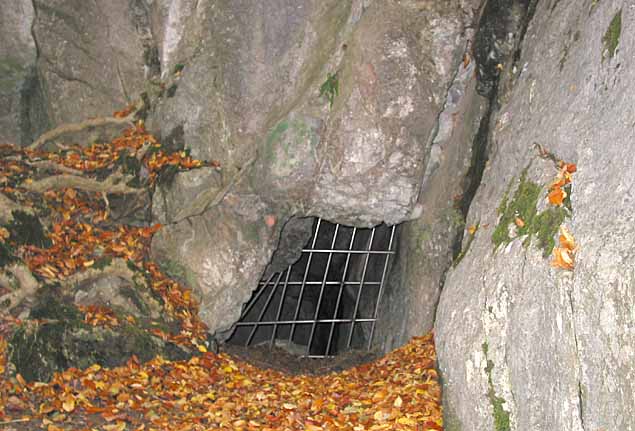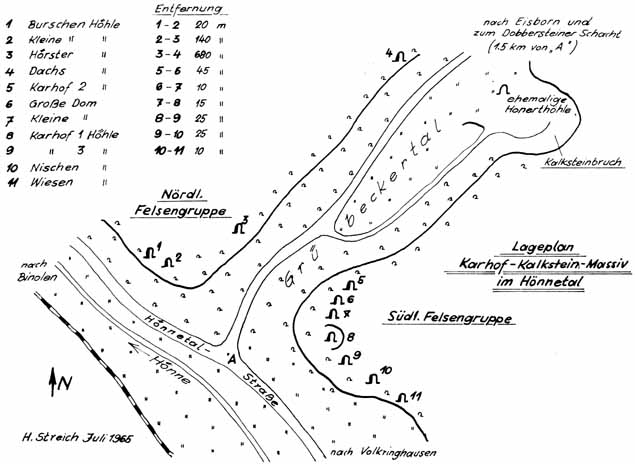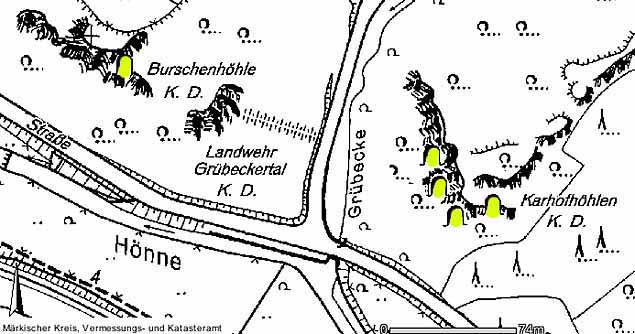|
Quelle: "Unterirdische Zauberreiche des Sauerlandes", 1967, Heinrich Streich, S. 77/78
Karhof-Höhle
Etwa 800 Meter südlich des Bahnhofes Binolen im Hönnetal zweigt von der Talstraße
nach Nordosten die Landstraße ins Grübeckertal nach Neheim-Hüsten ab. Hier am
Abzweig finden wir zu beiden Seiten der Grübecker Landstraße das Karhof-Kalkstein-Massiv.
In der südlichen Felsengruppe befinden sich allein 7 Höhlen, drei davon
bilden die Eingänge zum Karhof-Höhlen-System. Es sind: Der Große Dom, der Kleine
Dom, Nischen- und die Wiesen-Höhle. Die Gesamtlänge der Karhof-Höhle: 125 Meter. Eingänge:
Ein besonderes Einfallen hat das große Höhlensystem der Karhof-Höhle nicht. Vielmehr
verläuft dieses im großen und ganzen waagerecht. Typische Spaltenhöhle, trocken,
doch zeigen größere Auswaschungen, dass sie einst eine bedeutende Flußhöhle war.
Wie alle Höhlen des Hönnetals gehört auch die Karhof-Höhle zum großen Gebirgsstock
des Massenkalkes. Die Befahrung ist im allgemeinen leicht bis mittelschwer. Doch
Vorsicht, die Höhle ist seit Jahren starken Veränderungen unterworfen. Versturz!
Die Karhof-Höhle gehört zu den ältesten Kulturhöhlen Westfalens. Als vor vielen
Jahren ein Profil durch die Ablagerungsschichten gelegt wurde, zeigte sich
der Querschnitt einer tadellos erhaltenen Herdstelle aus dem Neolithikum.
Die Herdstelle wurde vorsichtig ausgegraben, und heute ist ihr Inhalt im
Museum zu Menden zu besichtigen. In dem damals freigelegten Feuerloch befanden
sich ferner Tonscherben, Reste von Holzkohle, gebranntes Getreide und
Knochenschichten verschiedener Art.
In der Asche des Herdes fanden sich Reste von 22 verschiedenen Pflanzen.
Unter anderem waren Reste von Weizen, Roggen und Zwergweizen ermittelt
worden. Aber auch Spuren von Saathafer wurden gefunden. Diese in der
Karhof-Höhle gefundenen Körner sind wahrscheinlich die ältesten Haferfrüchte
aus Nordwestdeutschland.
Quelle: "Unterirdische Zauberreiche des Sauerlandes", 1967, Heinrich Streich, S. 80
Wiesen-Höhle
Die Wiesen-Höhle ist die südlichste im Karhof-Kalkstein-Massiv, mit Öffnung
zum Hönnetal, etwa 10 Meter von der Nischen-Höhle entfernt. Eine
Verbindung zum Karhof-Höhlensystem hat die Höhle, wie auch die Nischen-Höhle,
nicht. Länge der Höhle: 15 Meter. Das Eingangsportal ist schmal und hoch.
Breite: 1,00 Meter, Höhe 3,50 Meter, Höhe über Talsohle 22 Meter. Die Höhle
ist trocken, die Anordnung waagerecht; eine typische Spaltenhöhle.
Nischen-Höhle
Wandert man von der Karhof-Höhle 3 weiter um das Massiv in südlicher Richtung
herum, erreicht man nach etwa 25 Metern die Nischen-Höhle, welche hinter
einer kleinen Felsnase versteckt liegt. Die Höhle hat ihre Bezeichnung von
den vielen kleinen Nischen, die ringsherum um eine Grotte, dicht hinterm
Eingang, verteilt sind.
Dachs-Höhle
Wenn wir im Hönnetal vom Bahnhof Binolen südlich wandern, erreichen
wir nach 800 Metern das Grübecker Tal. Wandern wir in diesem aufwärts,
so sehen wir nach 830 Meter linke Hand im schönen Buchen- und
Eichenbestand eine mit Moos bewachsene kleine Kalksteinwand. In dieser
Wand liegt die wenig bekannte Dachs-Höhle, etwa 7 Meter über Talsohle
(Grübecke). Die Höhlenbezeichnung rührt von der Losung des Dachses
her, der vor dem Höhleneingang seine Abtritte hat.
Sie liegt fernerhin unmittelbar über dem Kilometerstein 3/4. Gegenüber,
auf der anderen Talseite, liegt der noch in Betrieb befindliche
Steinbruch, in welchem sich bis vor wenigen Jahren die Honert-Höhle
befand (siehe obigen Lageplan zum Karhof-Kalkstein-Massiv).
Um den Charakter der Höhle festzustellen, bedarf es eingehender
Forschungsarbeit. Die Lage der Höhle an sich, als auch die in
unmittelbarer Nähe verschwundene Honert-Höhle lassen verraten,
dass in der Dachs-Höhle fossile Knochenreste und Artefakte verborgen
sind. Versinterungen sind nur im hintersten Teil der Höhle
sichtbar. Die Höhle untersteht nicht dem Naturschutz.
Hörster-Höhle
Etwa 800 Meter südlich Binolen im Hönnetal zweigt das schöne
Grübecker Tal in Richtung Neheim-Hüsten ab. Wandern wir in diesem
letztgenannten auswärts, erblicken wir nach etwa 150 Metern
links zurückliegend im Buchenbestand die erste aufragende
Kalkstein-Wand. In dieser befindet sich die Höster-Höhle (siehe
auch Lageplan zum Karhof-Kalkstein-Massiv).
Länge der Höhle: 8 Meter (vorläufiger Wert). Eingang: Breite 2,00
Meter, Höhe 1,00 Meter. Höhe über Talsohle: 20 Meter (Grübecke).
Die kleine Höhle verläuft waagerecht und gehört zum Massenkalk,
wie alle Höhlen des Karhof-Kalkstein-Massivs. Die einzigartige
Lage dieser Höhle spricht dafür, dass während der Eiszeiten auch
hier Mensch und Tier einen Unterschlupf fanden. Tropfstein und
Versinterungen weist die Hörster-Höhle nicht auf. Sie steht nicht
unter Naturschutz.
Quelle: Balve, 1930, zur Tausendjahrfeier und 500. Wiederkehr der
Verleihung der Stadtrechte, S.32, von Dr. Clementine Lipperheide "Die Höhlen
um Balve"
Karhof Höhle - ein unterirdisches Felsenmeer
Bald ändert sich das Bild von Schritt zu Schritt. Nach sieben Metern stehen wir
vor einem mächtigen Felsblock, der den Weg zu versperren scheint. Doch führen zwei
enge Spalten rechts und links um ihn herum. Links steigt der unbequeme schale Pfad
über herabgestürzte, in einem wirren Durcheinander liegende große und kleine Felsen
aufwärts.
Wir umgehen sie und steigen dann hinab in die Tiefe, bis wir am Anfange des großen,
nach oben spitz zulaufenden südöstlichen Haupthöhlenraumes (17 Meter lang, 7 1/2 Meter
breit, 6 1/2 Meter hoch) stehen, den unser Bild (S. Abb.) zeigt. Um den Verlauf der
ganzen Höhle kennen zu lernen, lassen wir uns den engen, mit scharfen kleinen
Kalkgesteinen mehr oder weniger angefüllten Gang hinunter zu der tiefsten Stelle
der Höhle, die auch zugleich die engste und unbequemste ist. Wir müssen uns flach
auf den Boden legen, um in den schmalen, aber hohen Gang kommen zu können, der das
Nord-Ost-Ende der Höhle bildet.
Hier bietet sich dem Auge ein ganz anderes Bild. Die Wände und alleinstehenden
Felsen scheinen poliert zu sein und schimmern in den buntesten Farben. Der Rückweg
führt wieder in den Haupthöhlenraum. Ein dort entzündetes Feuer gibt erst die
genügende Beleuchtung des hohen Raumes. Unsere kleinen Bergmannslampen reichen
nicht aus. Der Boden ist sehr uneben und mit Lehm und großen und kleinen Geröllen
bedeckt. Wände und Decken zeigen Spuren gewaltiger Veränderungen. Sie sind von
kreuz- und querziehenden Spalten und Klüften, die teils mehr, teils weniger
erweitert sind, durchzogen.
Diese durch die Gebirgsbildung bedingten Klüfte
erhielten ihre Umgestaltung durch das Wasser. Im Niederfallen auf die von verwesenden
Pflanzenresten durchsetzte Erdoberfläche hat der Regentropfen Kohlensäure
aufgenommen. Dann führte ihn die Schwerkraft auf den Klüften des Kalksteins
erdeinwärts. Infolge seines Kohlensäuregehaltes löste das Wasser den Kalk und
erweiterte hier und da eine Kluft, wie sie massenhaft das Gestein durchziehen. So
schuf stetig auf Kluftflächen abfließendes Wasser eine nach der Tiefe zunehmende
Erweiterung einzelner Spalten, schuf eine Spaltenhöhle, deren spitzes Dach und
unebener Boden diese Entstehung kundgeben. Schneiden sich bei solchen Höhlen
mehrere Spalten, die erweitert werden, so entsteht ein größerer Raum als der
eigentlich typische.
Im Haupthöhlenraum der Karhof-Höhle ist das der Fall. Auch das wirre Durcheinander
in der Karhof-Höhle, diesem unterirdischen Felsenmeer, findet seine Erklärung.
Durch die Erweiterung der Spalten verloren manche Felsen ihren Halt und stürzten
auf den Boden der Höhlung, andere sind so sehr aus dem Schichtenkomplex losgelöst,
dass sie jeden Augenblick herunterzustürzen drohen. . .
|