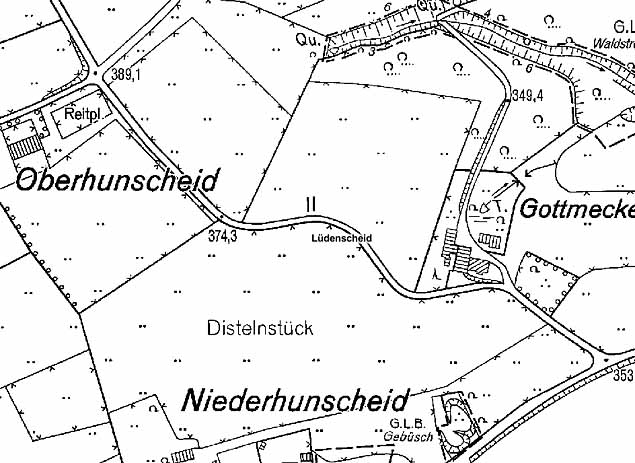|
Gruben im Bereich des Amtsgerichtes Lüdenscheid
Quelle: Westfaelische Rundschau LUEDENSCHEID vom 19.11.2002
Für Bergbau Seilbahn ins Rahmedetal geplant
Lüdenscheid. Mit 16 Mitgliedern der ehemaligen Tübinger
Studentenvereinigung erkundete jetzt Reiner Assman vom Lüdenscheider
Geschichtsverein das alte Bergbaugebiet Tweer, Oberhundscheid, Helle und
Drehscheiderhagen. Zahlreiche sehr interessante erdgeschichtliche Zeugnisse im
Lüdenscheider Gebiet wurden während der dreistündigen Exkursion vorgestellt.
Am Tweerweg konnten 380 Millionen Jahre alte Meeresablagerungen in Form der
Gesteine der Ihmert-Schichten beobachtet werden.
Ein weiterer Aktionspunkt war der Große Tagebau der Erzgruben Alex II
und III. Die Lagerstättenbildung der Eisenerzgruben Alex II und III bei
Tweer beruht im Wesentlichen auf der Verwitterung der Gesteine der
Ihmert-Schichten im Tertiär-Zeitalter. Korallenkalksteine und eisenreiche
Tonsteine verwandelten sich vor ca. 15 Millionen Jahren in Brauneisenerz und
blieben bis in die heutige Zeit vor Abtragung verschont.
Der Abbau von Erzen dauerte mit Unterbrechungen bis etwa 1900, eine
Dampfmaschine zur Wasserhaltung und Fördergerüste, wie man sie aus dem
Ruhrgebiet kennt, waren zu dieser Zeit vorhanden. Die Förderschächte
hatten eine Teufe von 86 m. Eigens sollte eine Seilbahn bis in das
Rahmedetal gebaut werden, um die geförderten Erze besser
mit der Bahn abtransportieren zu können. Diese Grube war Lüdenscheid
ältestes und ergiebigstes Bergwerk.
Der Weg führte weiter über die Hundscheiderflächen, die ebenfalls
durch Verwitterung der Ihmert-Schichten in der späten Tertiärzeit vor ca.
drei Millionen Jahren geformt worden waren. An zahlreichen Findlingen wurde
die Geologie erläutert. An alten Pigenfeldern vorbei ging es zum Hellstück,
wo man das Rahmedetal überblicken konnte. Das engräumige Talrelief beruht
hier ebenfalls auf den Gesteinskomponenten der Ihmert-Schichten.
Letzter Punkt der Exkursion war eine alte Kupfergrube unterhalb
Hellstück aus dem 17 Jahrhundert. Die am Drescheiderhagen vorkommenden
Kupfererze sind an Quarz - und Schwerspatgänge gebunden, wie anhand
gefundener Lesesteine erläutert wurde. Die bescheidene Menge von einigen
Tonnen Kupfermetall, die einst gewinnbar war, entstammte auch
verwitterungsbedingten Erzanreicherungen in den ansonsten kupferarmen
Erzgängen während des Tertiärzeitalters.
Quelle: Westfaelische Rundschau LUEDENSCHEID vom 03.12.2002
"Großer Dank an Karsten Binczyk und Volker Haller"
Betr.: WR-Bericht "Für Bergbau Seilbahn ins Rahmedetal geplant" vom
20. November.
Lüdenscheid. "In der Westfälischen Rundschau vom 20. November wurde
über eine Suche nach verborgenen Schätzen im bergigen Gelände vor den Toren
von Lüdenscheid im Raum Tweer - Drescheiderhagen in Gestalt einer
bergbaukundlichen Exkursion durch Angehörige einer Tübinger studentischen
Verbindung berichtet. Voraus ging eine vormittägliche Führung durch die
Knopfsammlung und die Ausstellung ,Verborgene Schätze im Museum durch den
Museumsleiter Dr. Eckhard Trox. Hervorzuheben ist, dass diese Exkursion
unter Führung von Karsten Binczyk und Volker Haller von der
Naturwissenschaftlichen Vereinigung Lüdenscheid stattgefunden hat.
Bereits im Juli im Rahmen der Veranstaltungen des Heimatvereins zur 50-Jahrfeier
hatten die beiden jungen Nachwuchsforscher Karsten Binczyk und Volker Haller
von der NwV diese Exkursion durchgeführt. Die Exkursion kam so gut an, dass
ich um eine Wiederholung bat. Karsten Binczyk und Volker Halter überzeugten
abermals durch ihre große, mit Bescheidenheit vorgetragene Fachkompetenz. Es
ist wirklich erstaunlich, welche Geheimnisse in und um Lüdenscheid ergründet
werden können. Jedem Verein und jeder Gruppe kann empfohlen werden, sich
Karsten Binczyk und Volker Haller anzuvertrauen. Eine schöne Wanderung auch
für Ungeübte ist im Programm selbstverständlich enthalten. Daraufhingewiesen
sei ergänzend, dass die NwV hervorragende Wegbegleiter ,Lernwandern im
Märkischen Kreis mit Karten für geringes Entgelt herausgibt (Wilhelmstraße
47, Tel: 02351/26429).
Bei der genannten studentischen Verbindung mit lebenslanger
Mitgliedschaft handelt es sich um das in Tübingen bestehende Corps Rhenania.
Diesem ursprünglich schwäbischen Corps gehörten in der Frühzeit zu Beginn
des 19. Jahrhunderts u.a. der große preußische Schulreformer Adolf
Diesterweg aus Herborn an, aus Lüdenscheid im 19. Jahrhundert u.a. Ernst de
Maizieré und im 20. Jahrhundert Angehörige der Familien Assmann, Möller und
Noelle. Ernst de Maizieré war von 1873 bis 1876 Kreisrichter in Lüdenscheid.
Der spätere Bundeswehr-Generalinspekteur de Maizieré ist sein Enkel, der
letzte Ministerpräsident der DDR de Maizieré sein Urenkel. Deren Beziehung
zu Lüdenscheid dürfte bisher wohl nicht bekannt gewesen sein." Rainer Assmann Breslauer Straße 54 Lüdenscheid
Quelle: Lüdenscheider Nachrichten vom 21.12.1979
Warum sich Bergbau
(-gg-) Lüdenscheid. In der Jubiläumsausgabe zum 125-jährigen
Bestehen der "Lüdenscheider Nachrichten" brachten wir auch einen
Beitrag, der einige überraschende heimatgeschichtliche Aspekte
enthielt. LN-Mitarbeiter Willy Binczyk berichtete darin, dass
Lüdenscheid nicht nur eine Bergstadt, sondern auch eine Bergwerkstadt
war. Mehr als drei Dutzend Gruben gab es hier, in denen die
verschiedensten Metalle gefördert wurden. Aus Platzgründen ging
die Lagerkarte mit den genauen Standpunkten der Bergwerke nicht mit,
ebensowenig wie ein Teil seines Artikels. Hier nun die Ergänzung:
Der Aufschwung des Bergbaues im 17. Jahrhundert wurde in unserer
Gegend durch den 30-jährigen krieg unterbrochen (1618-1648). Die
räuberischen Einfälle der Franzosen, Holländer und Spanier überhäuften
das Land mit Kriegselend. Seuchen führten zur sittlichen Verwirrung
und zum Niedergang der Kultur, wie man es sich schlimmer kaum vorstellen
kann. Das Sauerland ist zwar nicht Schauplatz wichtiger Entscheidungsschlachten
gewesen, aber das fortgesetzte Ertragen von Einquartierungen und
Plünderungen, das Zahlen unerschwinglicher KOntributionssummen vertilgten
den vorhandenen geringen Wohlstand, brachten Kummer und Not über die
friedlich lebende, arbeitsame Bevölkerung der stillen heimatlichen
Täler und Höhen.
Ende des 17. Jahrhunderts, nach dem Abklingen der ganzen Wirren, kam
es im Bergbau wieder zu einem allgemeinen Aufschwung. Die bis dahin
bekannten Hilfsmittel zur Bearbeitung der harten Gesteine waren Schlegel,
Eisen und das Feuersetzen. Das Schwarzpulver war schon erfunden, aber
die Erkenntnisse noch nicht bis in unsere Gegend vorgedrungen. Anfang
des 17. Jahrhunderts nahm das Schwarzpulver erst Einzug in unseren
Bergbau. Zwar gab es noch Schwierigkeiten mit den Verschlüssen der
Bohrlochmündungen. Diese wurden dann aber im Lehmbesatz gefunden. Die
neue Einführung des Sprengens beim Stollenvortrieb ermöglichte eine
erhebliche Beschleunigung und Verbilligung der Gesteinsarbeit.
Das Auffinden abbauwürdiger Gänge oder Lager in unseren Bergen erwies
sich als schwierig. Es mussten viele Suchstellen oder Gräben angesetzt
werden. Oft wurde durch das Vortreiben einer Strecke oder das Abteufen
eines Suchschachtes ein spärlicher Erzgang oder eine Lagerstätte
gefunden. Eine Verwertung oder ein Ausklingen des Lagers bedeutete
aber schon das Ende des Stollens.
Als dann im 18. Jahrhundert der Höhepunkt der Muthungsanträge erreicht
war, und durch das Fortschreiten des Bergbaues die Gruben tiefer wurden,
drängten die Verhältnisse zur Vereinigung. Es bildeten sich Gewerkschaften
(Gewerke).
Quarzige Bleierze werden nicht so gerne angekauft und bezahlt wie Flußspat
mit Bleierz, weil man Flußspat besser von Blei trennen kann als Quarz
von Blei. Quarz ist zu strengflüssig, darum teurer in der Verhüttung.
Bei uns in den Bergen treten meist mehr Quarz-Blei-Verbindungen in Gängen
oder Nestern auf. 70 bis 90 Prozent taubes Gestein müssen abgebaut werden,
um einem Erzgang zu folgen. 1874 kostete die Tonne Schwefel in den Hafenorten
noch 150 Lire (120 Mark), während 1900 nur noch 70 Lire (56 Mark) gezahlt
wurden. Durch diesen Preissturz kamen die Grubenbesitzer in eine üble
Lage. Der Betrieb war nicht mehr lohnend, zumal die Besitzungen sehr
zersplittert waren, sowie auch die Gruben und Verhüttungbetriebe.
Vielfach wurde das Erz und taube Gestein in Säcken oder Körben auf dem
Rücken der Arbeiter oder mit der Schiebkarre zutage gefördert. Es fehlte
in den Gruben an geeigneten Abbaumethoden, so dass viel Erz verloren ging.
Das sind alles Merkmale, warum der Bergbau sich nicht halten oder bestehen
bleiben konnte. Im Gegensatz zu den Nachbarländern, wo die Erzgänge
mächtiger anstehen und z. T. im Tagebau abgebaut werden. Damit kann unser
Erzbergbau nicht mithalten.
Es sind im Raum Plettenberg - Herscheid - Lüdenscheid rund 150 Erzgruben
namentlich bekannt. Der Höhepunkt der Mutungen im 17. bis 18. Jahrhundert
ging aber dann rapide bergab. Man kann die Gruben, die um 1900 noch in
Betrieb waren, an einer Hand abzählen.
Die vielen zugefallenen Mundlöcher und Schächte der Erzgruben in den
Bergen unserer Heimat zeugen noch von reicher Bergbautätigkeit. Das
geschulte Auge des Wanderers kann sie überall erblicken, aber der Lauf
der Zeit rafft auch sie zusammen. Es werden immer weniger.
"Auguste I", durch einen nahe gelegenen Steinbruch infolge Sprengarbeiten
zusammengefallen und nicht mehr befahrbar. In der Grube "Rencontre" ist
im Laufe der Jahre die Türstockzimmerung total verfault. Das das Deckengebirge
klüftig ist, und das Stollenwasser den Lehm aus den Rissen schwemmt, kann
es nur noch Jahre dauern, bis sie endgültig zusammenbricht. Über die "Grube
Möllhoff am Stein" ist eine Straße gebaut worden und sie ist daher nicht
mehr befahrbar. Andere Gruben werden als Aschenkippe benutzt oder werden
durch Häuser zugebaut.
So kann man noch viele Gruben aufzählen, denen es ähnlich ergeht. In ein-
bis zweihundert Jahren könnten unsere Kindeskinder nur noch in den
Büchern darüber lesen, was sich in unserer Heimat zugetragen hat. Bi.
Zeichnung: Die eingezeichneten Punkte auf dem Grubenplan zeigen die
Stellen an, wo in früherer Zeit Bergbau betrieben wurde (in und unmittelbar
an der Stadtgrenze von Lüdenscheid). Die Bergwerksbesitzer - ob es sich
nun um ein Konsortium oder aber um Einzelbesitzer handelte, welche die
Muthungsfelder verliehen bekamen - entstammen allen Bevölkerungsschichten.
Außerdem waren die damaligen Muter auch Lüdenscheider und kamen sonst
aus der näheren oder weiteren Umgebung Lüdenscheids wie Plettenberg,
Herscheid, Hagen, Schalksmühle, Iserlohn, Bonn, Dortmund. Zu den
eingezeichneten Gruben ist weiter zu sagen, dass die heutige Stadtgrenze
die Mehrzahl der Grubenfelder durchläuft oder knapp anschneidet. So
kam es desöfteren also vor, dass die bergmännischen Aufschlussarbeiten
(Stollen) unter der Stadtgrenze in die Nachbargemeinde vorgetrieben wurden,
oder aber ein Schacht lag diesseits, der zweite dazugehörige jedoch
jenseits der Stadtgrenze. Bei den knapp angeschnittenen Mutungsfeldern
lag der Fundpunkt aber meistens außerhalb der Stadtgrenze. Zeichnung: Binczyk
Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, E. Dössler, Bd. I, S. 77
Eisenbergwerke zu Hunscheid
1464, Juni 12. - 1471, Dez. 20. Nr. 1
Zusatz: Desgl. hat Henneken Weylant (Weylent) einen Brief für sich und
seine Erben "op den berch, geheiten die Zonthelden in dem kerspel van
Mynershagen". - D.: 1471, in vigilia Thome apostoli. - StAD, MR. V.,
f. 104b. - Ebd. VI, f. 152.
Nach dem Bericht des Jak. am Ende von 1688 hat Leopold von Neuhoff
vor 1636 das Eisenbergwerk zu Hunscheid gemutet, jedoch war in den
letzten 50 J. nichts an Bergzehnten abgegeben worden (Meister, Gft. Mark
II, 82, vgl. Dortmunder Beiträge XVII, 180). - Bei dem Bergwerk zu
Sundhellen handelt es sich wohl um ein Kupferbergwerk (vgl. v. Steinen,
Westph. Geschichte II, 250). - Voye (II, 240) vermutet hier Schürfung
nach Blei und Silber.
Ein Huttenhenneseken wird 1486 als Hausbesitzer zu Lüdenscheid erwähnt
(vgl. ob. Kap. II / Fehdeschädenliste, Nr. 5)
Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, E. Dösseler, 1954 Bd. I, S. 78-79
Bergwerk Heilige Dreifaltigkeit (b. Lüdenscheid)
1524, Febr. 18 - Nr. 4
1) Nach frdl. Auskunft des Stadtarchivs Nürnberg
waren Wolf Erckel und sein Bruder Ulrich 1513 an Bergwerken zu Annaberg und
Schneeberg im Erzgebirge beteiligt (Stadtarchiv Nürnberg, libri lit. 14, f. 76f.).
Die Brüder Erckel, Söhne Ulrich Erckel des Ält., Bürger zu Nürnberg, besaßen
auch umfangreichen Grundbesitz in Nürnberg und Umgebung (libri lit., 14, f.
150f; 15, f. 86f; 16, f. 43, 194; 27, f.21-24; libri conservatorii 6, f. 126.-;
1515-1525).
Quelle: "Bergbau im Bereich des Amtsgerichtes Lüdenscheid", Fritz Bertram,
1952/54, S. 162-220
D. Eisenstein- und Eisen-Manganerzgruben
Dieses Aufteilen in verschiedene Felder und damit verbunden geradezu künstlerische
Ineinanderschachtelungen werden wir besonders im Gebiet Meinerzhagen wiederholt
antreffen, dort habe ich auch an einer Stelle eine Lagezeichnung verschiedener
Felder eingefügt.
|