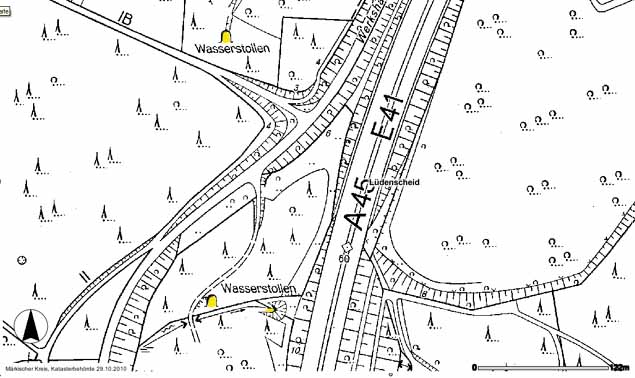|
Quelle: Lüdenscheider Nachrichten vom 25.09.2010
"Die Natur holt sich alles zurück"
Von Olaf Moos
Lüdenscheid. An einem Tag im Frühjahr 1887 war es, nahe
der Ortschaft Ruck, nicht weit von der Homert. Wie der Bauer hieß,
der da seinen Acker pflügte, ist nicht überliefert. Sicher ist
aber, dass er Opfer einer mutmaßlichen Pfuscherei wurde. Ein
Jahr zuvor hatten Arbeiter im bergmännischen Vortrieb einen
Stollen gegraben, um eine Quelle zu fassen. Der felsige Untergrund
war wohl klüftig. Der Verzicht auf eine Ausmauerung war ein
Fehler, der Stollen brach ein. Der Bauer und sein Pflug versanken
im Erdboden. So erzählt es Horst Schöppner, bis 1996 Betriebsingenieur
bei den Stadtwerken und Kenner der Geschichte des Lüdenscheider
Wasserbaus.
Das waren damals die schlechten Erfahrungen mit der modernen
Wasserversorgung für Lüdenscheid. Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte.
Und führt heute in den dichten Wäldern rings um die Homert zu fast
vergessenen Relikten vormalig revolutionärer Errungenschaften, zu
Eingängen in ein mehr als zweieinhalb Kilometer langes begehbares
Stollensystem - zu "verborgenen Orten".
Auf der Suche nach den rotziegeligen Portalen geht es über feuchten
Waldboden, der nach Pilzen riecht und weich ist von der Rotte
ungezählter Laubschichten. "Die Natur holt sich alles zurück",
sagt Horst Schöppner, und es klingt kein Bedauern mit. Obwohl der
Ingenieur, früher Abteilungsleiter für Gas und Wasser, fasziniert
ist von der Kunst der frühen Wasserbauer.
In diesem Fall von dem Geheimen Baurat Henoch aus Gotha. 1879 hatte
dieser der Stadt Neuss angeboten, "für eigene Rechnung und Gefahr
eine Wasserleitung in hiesiger Stadt anzulegen." Doch der Bochumer
Unternehmer Heinrich Scheven schnappte ihm den Auftrag vor der Nase
weg. Aber als sich 1881 die Lüdenscheider Wassergenossenschaft
gegründet hatte - vier Jahre zuvor war bereits die Zisterne in der
Oberstadt fertig, es gab 140 Einzelbrunnen für die etwa 15.000
Einwohner -, unterschrieb Henoch aus Gotha einen Vertrag. Er sollte
aus dem Brenscheider Tal, von der Höh und von der Homert Wasser
in die Stadt leiten. Gebraucht wurden 1.000 Kubikmeter pro Tag.
Dirk Schmidt, heute Leiter der Betriebsstelle Gas und Wasser bei den
Stadtwerken, lehnt an der Stahltür zum Eingang I des Stollens und
stemmt sich gegen den Stiel des Spitzhammers. Nur langsam gibt die
Tür nach. Und als sie sich endlich schwerfällig aufdrücken lässt,
dringt kühle, modrige Luft ins Freie.
So mag es auf der Homert gerochen haben, als Henoch aus Gotha sich
mit Bergbauexperten aus dem Ruhrgebiet ins felsige Eingeweide des
Sauerlandes wühlte. Es gab ein großflächiges Hochmoor hier. Gute
Voraussetzungen, um genug Wasser zu gewinnen und in die Stadt zu
spülen. Ein 400 Kubikmeter Hochbehälter auf der Höh und das Rohrnetz
hinunter in die Stadt waren schon fertig. Zwischen Homert und Höh
liegen nur 6 Meter Höhenunterschied - von 467 aus 461 über Normalnull.
Der Haupttunnel und seine Seitenarme sollten den Behälter und die
Brunnen dauerhaft füllen. Wasser war nun vermehrt nicht nur zum
Durstlöschen oder für die Körperpflege wichtig. Die wachsende Industrie
dürstete nach "Triebwasser", wie Horst Schöppner sagt. Also Wasser,
mit denen die Fabriksken-Besitzer unter Druck ihre Pumpen und
Transmissions-Maschinen antreiben konnten.
Eine Spundwand wird sichtbar, wenn die Augen sich an die Dunkelheit
gewöhnt haben. Eine Lampe leuchtet das dahinter liegende Tonnengewölbe
aus. Ein paar Meter weiter hinten eine Wand. "Das ist ein Quergang",
sagt Dirk Schmidt. Glasklares Wasser steht in der Schlammrinne in
der Mitte des Ganges. Zahllose Tröpfchen fallen und spielen ein
Konzert. "Das ist Oberflächenwasser." Durchgeleitet wird hier schon
lange nichts mehr.
Und gereinigt auch nicht. Seit dem Fall der Berliner Mauer nicht mehr.
Einmal im Jahr waren Stadtwerker zuvor mit Schaufeln und Eimern in
dem Tunnelsystem unterwegs gewesen. Als die DDR aufhörte zu existieren,
war auch der "Kalte Krieg" vorbei. Und die Gefahr, dass Militärs
die sauerländischen Talsperren vergiften, war Vergangenheit. Die
Szenarien für den schlechtesten Fall verschwanden in Schubladen. In
ihnen war von der Wiederbelebung der alten Wasserbauanlage die Rede,
von Rationierung des Trinkwassers. Zwei Liter pro Tag pro Person.
Und von zentralen Abgabestellen.
Es hätte sicher funktioniert. Der Geheime Baurat Henoch aus Gotha und
seine Bergleute haben für die Ewigkeit gebaut - vom Einsturz des
Stollens nahe der Ortschaft Ruck abgesehen. Ein Viertel der Gesamtstrecke
ist ausgemauert. Alle Quelleinfassungen haben trotzdem nicht überlebt.
Einige fielen dem Bau der Sauerlandlinie (A 45) zum Opfer. Anfang der
1970er-Jahre haben die Stadtwerke durch das Tunnelsystem noch einmal
Wasser abgezapft und zur A 45 geliefert, für den Bau zweier Brücken.
Seither liegt das Wasserbauwerk an der Homert brach.
Dirk Schmidt und Horst Schöppner stapfen durch das Unterholz und
suchen den nächsten Zugang. Ihr Blick bleibt an einem unnatürlich
wirkenden Hügel hängen, der sich wie eine bewaldete Landzunge
über den Boden erhebt. Zugang gefunden. "Das ist eine Abraumhalde",
sagt Horst Schöppner. Beim bergmännischen Vortrieb haben die
Hauer Schienen in dem Stollen verlegt und Erdreich und Felsbrocken
mit kleinen Kipploren ins Freie geschoben, vor dem Eingang aufgehäuft
und liegengelassen.
Zwei Jahre nach Ende des Baus - ein Arbeiter hatte dabei sein Leben
gelassen - war das Hochmoor weitgehend entwässert. Die Lieferzahlen
sanken von 1.000 auf 550 Kubikmeter pro Tag. Die Wasserbauer fassten
eine neue Quelle im Versetal ein. Von Treckinghausen - Standort des
heutigen Wasserwerks - drückten riesige dampfgetriebene Pumpen das
Wasser hoch zum Piepersloh. Etwa dort, wo heute der Kreisverkehr
liegt, traf sich diese Leitung mit dem Hauptrohr von der Homert.
Die Wassermenge reichte dann wieder aus.
Über den Stahltüren in den Portalen zur Unterwelt fehlt jeweils
ein Stein. Deshalb ist Dirk Schmidt einmal pro Jahr hier. Dann
schließt er den Fachleuten vom Naturschutzbund NABU die Türen auf.
Sie zählen und wiegen die Fledermäuse, die die Lücke über der Tür
als Einflugschneise in den Stollen nutzen. Nahezu gleichbleibende
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind für die empfindlichen Tierchen
wichtig. Je mehr es von ihnen gibt, desto besser ist der Zustand
der Natur. Dirk Schmidt sagt: "Es werden von Jahr zu Jahr merh,
das ist schön."
|