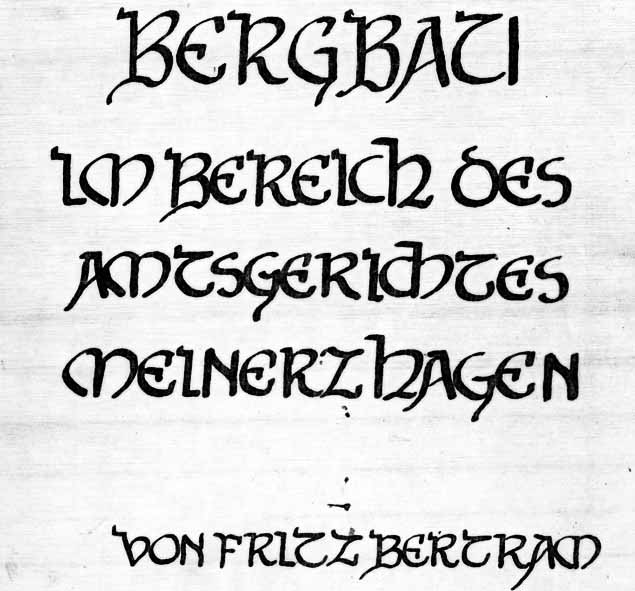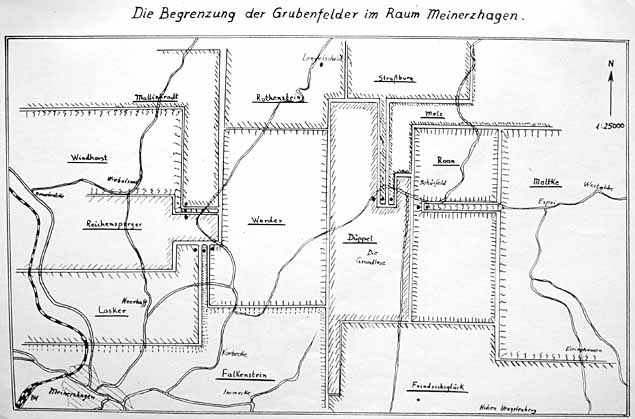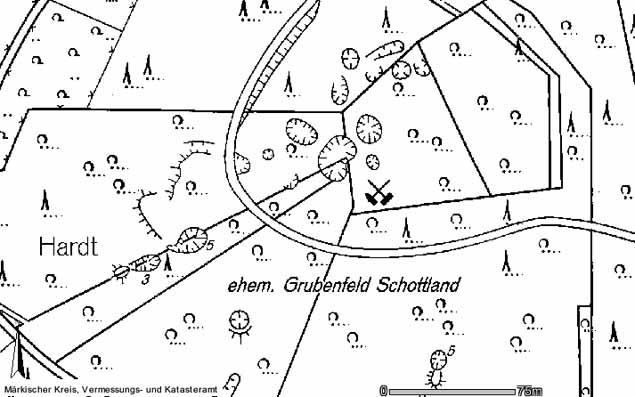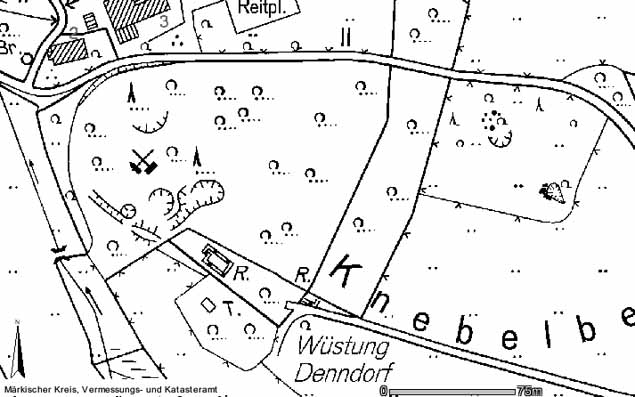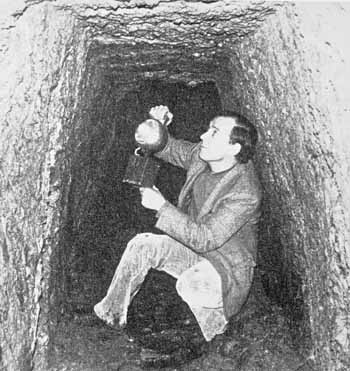|
Constantin III Gute Hoffnung Helberg I Hörde III Lasker
Lena Otto XVII Sebastopol I Schottland III Schottland XIII Sieg
Quelle: Bergbau im Amtsgerichtsbezirk Meinerzhagen, Fritz Bertram, 1952/54, S.221-259
A. Allgemeine Einleitung:
Genau wie die vorherigen Abschnitte (Plettenberg, Lüdenscheid, Altena) so
gehört auch dieses Untersuchungsgebiet zum Bereich des Bergamtes Sauerland
in Arnsberg und dem Oberbergamt Bonn; früher waren dies Dienststellen in
Witten bzw. Dortmund. In früherer Zeit wurde es zu dem Besitz von Cleve-
Mark und Ravensburg gerechnet.
B. Topographisch-geologische Übersicht
3. Bergverwaltung
Der Bergvogt war Vertreter des Landesherrn, er hatte zu wachen über die
Beachtung der Bergordnung und war daher mit Straf- und Befehlsgewalt
ausgestattet. Der Bergmeister sollte die Mutungen auf die Metallbergwerke
erteilen, er hatte eine gewisse Oberaufsicht über den technischen Betrieb,
denn ihm sind die Geschworenen unterstellt, die alle 14 Tage die Zeche zu
befahren haben und Mängel rügen und Verbesserungen vorschlagen. Die
Schichtmeister wurden nicht vom Staat, sondern von den Gewerken ernannt,
jedoch unter Zustimmung des Bergvogtes. Sie wurden vom Staat in Pflicht
genommen und mussten eine Kaution stellen. Der Schichtmeister hatte die
lokale Aufsicht über Steiger, Hauer und Schlepper, und zwar sollte er
nicht mehr als 6 Zechen gleichzeitig überwachen. Die Einrichtung von
Zehntnehmern, Schreibern, Gegenschreibern, Schmelzern und Probierern
sollte eine gewisse Ordnung im Kassenwesen und Schriftwechsel, sowie eine
Kontrolle über die Schmelz- und Siedeprodukte verbürgen.
Dieses Beamtentum wurde aber niemals in die Tat umgesetzt, es bestand
nicht mehr, als Brandenburg die Herrschaft übernahm. Der erste Bergvogt
war Cronenberg, ihm folgte 1632 Dietrich von Dienst, der sich Bergvogteiverwalter
und Bergmeister nannte, ein Zeichen dafür, dass in seinem Amt der Nachdruck
auf die Tätigkeit des Bergmeisters gelegt wurde und eine völlige Verschmelzung
der Stellung des Bergvogtes und der des Bergmeisters nicht beabsichtigt war.
Unter den hervorragenden Persönlichkeiten finden wir 1663 den Bergmeister
Kutschauer. Bis 1715 war dann die Stelle des Bergmeisters nicht besetzt.
Dagegen taucht um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein neuer Titel auf:
Bergwerksdirektor, der an höhere Militärpersonen vergeben wurde.
Erst am 30. Juni 1681 wurde die ursprüngliche Bergvogtstellung wieder
hergestellt. Dr. jur. Peter König zu Schwerte wurde damit unter dem Titel
eines Oberbergvogtes damit betraut. Auf ihn folgte sein Sohn in derselben
Stellung. Vater und Sohn hatten zugleich auch das Richteramt in Schwerte
zu versorgen. Der Nachfolger war ab 15.08.1730 der Oberbergvogt und Richter
zu Schwerte, Caspar Mark. Später wurde die Stelle des Oberbergvogt nach
Hagen verlegt. 1715 finden wir u. a. den Bergmeister Paul Heinrich Weiss
und 1756 den Bergmeister Heintzmann.
Die Mark wurde bereist von Kutschauer Mitte des 17. Jahrhunderts (vergl.
S. 159-161 dieser Arbeit), 1709 war es der Wettiner Bergmeister Friedrich
Nikolaus Voigtel, der die Inspektionsreise durchführte. 1720 war dann
die nächste Revision. Im Jahre 1734 hatte dann der Kriegs- und Domänenrat
Richter von der Salz- und Bergwerksdeputation zu Halle mit dem klevischen
Kriegsrat Franke die märkischen Bergwerke untersuchen müssen, und im
folgenden Jahr 1735 fand sich im Auftrage des Generaldirektoriums Berlin
der Wettiner Bergmeister Decker zugleich mit dem Bergmann Christian Scholl
in der Mark ein zur Vornahme einer umfassenden Untersuchung des ganzen
märkischen Bergwesens.
Über diese und andere Bereisungen unserer Heimat in bergbaulicher Hinsicht
gibt es im Staatsarchiv Münster eine umfangreiche Aktensammlung unter dem
Sammelbegriff "Oberbergamt Dortmund" bzw. "Fürstentum Siegen". Es konnte
aber an dieser Stelle nicht auf alle Akten eingegangen werden, es seien
hier nur die Quellen angegeben, damit sich interessierte Kreise gleich
orientieren können.
. . .
B. Spezieller Teil
. . .
Quelle: Meinerzhagen - Märkischer Kreis, Festschrift zum Kreisheimattag 1980, S. 34-37
Der Bergbau in Meinerzhagen und Valbert
Von Jürgen Pietsch und Rainer Bischoping
Aus neurer Zeit kennen wir die "Valberter Hütte" (Haus Schulte)
in Oesterfeld, ein Name, der unter den Einheimischen heute noch
gebräuchlich ist. Hier wurde vor 150 Jahren das aus der Grube
"Morgenröte" bei Hösinghausen geförderte Eisenerz verhüttet.
Unlängst hat der Valberter Tiefbauunternehmer Friedhelm Abel
bei Echternhagen einen alten Stollen, die "Silberkuhle" freigelegt,
ein sauber in den Fels gehauener Gang, etwa 30 Meter bis zu
einer Einbruchsstelle begehbar, gibt uns ein ausgezeichnetes
Bild von der schweren Aufgabe der Bergleute.
Die erste Urkunde über den Eisenbergbau im Kirchspiel Valbert
ist heute fast 500 Jahre alt. Am 29. Mai 1487 berichtet
Johann van Valbert (Velbert), Freigraf im Süderlande und
im Dienste des Herzogs von Kleve stehend, von einem
Zeugenverhör zur Feststellung der grundherrschaftlichen
Rechte am Eisenbergwerk "to Valbrecht vor dem dorpe". Zu
diesem Termin erschienen "die Merckschen des Kerspels van
Valbrecht alt und jong", darunter Heinrich op dem Haigen,
Clais van Westebbe, Hans Wever, Heyne to Eseloe, Kerstygen
to Wylkenbert, Diderich to Rynkenschede, Wilhelm to
Spedinghusen und Hans op der Borch.
Sie haben "mit handen und monde to gade und den hilligen
geswoeren" (mit Hand und Mund zu Gott und den Heiligen
geschworen), dass sie von ihren Eltern gehört hätten,
das Eisenbergwerk sei stets märkisch gewesen und "wan
dairop Merckschen gueden yserenstein wurde gewonnen,
dat dey theynde dan oick Mercksch syn suelde" (der
Zehnte dann auch märkisch sein sollte).
Diese Aussage sei im Beisein der "Coelschen" desselben
Kirchspiels gemacht worden, "die dit myt getyget (bezeuget)
und bekannt hebn."
Der Hintergrund dieses Zeugenverhörs waren die zum Teil
unklaren Besitzverhältnisse im Kirchspiel Valbert. Es gab
keine eindeutige territoriale Grenzziehung, und märkische
und kurkölnische Grundherrschaft wechselten miteinander ab.
Akten der Cleve-Märkischen Regierung geben uns darüber
Auskunft, dass zur Mitte des 17. Jahrhunderts ein Doktor
Schardius und nach ihm der Rentmeister zu Hörde, Macharell,
ein Eisenbergwerk bei Valbert betrieben haben. 1674 wurde
Caspar Göckel damit belehnt und betrieb es bis zum Jahre
1684. Acht Jahre später nahm ein Bergmann Juncker die
Arbeiten dort wieder auf.
Dieselben Akten berichten auch von einer Eisenhütte im
Kirchspiel Meinerzhagen, die dem damaligen Amts-Kammer-Präsidenten
von Ley gehörte. Die Hütte war allerdings zu diesem
Zeitpunkt schon außer Betrieb.
Im Staatsarchiv Münster befinden sich in den Cleve-Märkischen
Regierungsakten Berichte von Grubenbereisungen aus den Jahren
1755 - 1759. Die von der Regierung mit der Überprüfung der
Gruben beauftragten Bergmeister beschreiben hier sehr ausführlich
Zustand und Betrieb des Eisenbergwerks Bracht im Kirchspiel
Valbert (an der Grenze zu Meinerzhagen und Lieberhausen).
Besitzer war der Freiherr von Nagel zu Listringhausen.
Der Bergmeister Spörer berichtet im Jahr 1757 von dem schwierigen
Bemühen, einen Luftschacht zum Stollen vorzutreiben. Außerdem seien
die Arbeiten im Schacht durch starke Wasser behindert worden (ein
Problem, mit dem übrigens alle Gruben bis ins 19. Jahrhundert
hinein nur schwer fertig wurden). Ursache für den schlechten
Betrieb des Eisenbergwerks sei schließlich die Tatsache gewesen,
dass nur ein Steiger und ein Arbeiter dort arbeiteten. Im Schacht
selbst sah er ein weißliches Ganggebirge "mit vielen Kupferfunden
darinnen". Auf der Halde vor der Mine habe ein Vorrat von 160
Kübeln "teils armen, teils reichen Eisengesteins" gelegen.
Der letzte Bericht über dieses Bergwerk stammt vom 2. Juli 1759
und trägt die Unterschrift des Bergmeisters F. Heintzmann. Er
gab dem Besitzer von Nagel den Rat, das Gestein nach Siegen zu
dem Silberschmied Johann Philipp Engels zu senden, "um diesselbige
auf Eisen (Brauneisenstein), Stahl und Kupfer zu probieren, damit
man von dem eigentlichen Gehalt dieses Gebirges gesicherte
Kenntnis bekommen möge".
Heintzmann bemängelt wie vordem schon Spörer, dass das Bergwerk noch
immer von einem Steiger und einem Arbeiter betrieben werde und der
bereits 1756 in Angriff genommene Luftschacht "noch nicht mit dem
Stollen durchschlägig" sei. Er schreibt dann von der Notwendigkeit,
"dass nunmehr dieser Steiger in Pflicht genommen und gehörig
instruieret werde."
Warum nach 1759 im Bergwerk "Bracht" kein Erz mehr gefördert wurde,
ist nicht bekannt. Mangelnde Ergiebigkeit muss nicht unbedingt
der Grund für die Einstellung des Betriebes gewesen sein, denn
der Eisengehalt des heimischen Erzes liegt durchschnittlich bei
30 Prozent und mehr.
Wahrscheinlich machten in den regenreichen Monaten widrige Wasserverhältnisse
die Arbeit im Stollen unmöglich. Ferner wird die allgemeine
wirtschaftliche und finanzielle Zerrüttung des Landes als Folge
des Siebenjährigen Krieges ihre Auswirkungen gehabt haben. Kapitalarmut
und der Niedergang von Handel und Gewerbe haben sich auch in der
Zeit der Napoleonischen Herrschaft über Deutschland ungünstig auf
den heimischen Bergbau ausgewirkt.
Einem Bericht des Maire vom Ebbe (Meinerzhagen und Valbert gehörten
von 1806 bis 1815 zum napoleonischen Großherzogtum Berg. Valbert
und Herscheid bildeten darin das Dorf Ebbe) aus dem Jahre 1810
können wir entnehmen, dass zu dieser Zeit im gesamten Valberter
Raum nur noch ein Bergwerk (Kupfer und Kobalt) betrieben wurde.
Die Gewerke seien aber schwach gewesen, heißt es im Bericht, was
nur mit großem Kapitalmangel der Bergwerksbesitzer erklärt werden
kann.
Mit einem gewissen Erfolg wurden im 19. Jahrhundert bei uns eigentlich
nur zwei Bergwerke betrieben, nämlich "Morgenröte" in Hösinghausen
(Gemarkung Valbert) und "Gute Hoffnung" am Hahn im Listertal (Gemarkung
Meinerzhagen). In Hösinghausen, wo nach Berichten des Rentmeisters
zu Altena schon 1676 die Gebrüder Bossenii (Busenius) ein Bergwerk
angelegt hatten, wurde 1824 der Abbau des Erzes wieder aufgenommen.
Betreiber waren Wilhelm Trommershausen aus Elminghausen, Johann
Wilhelm Ihne aus Ingemerter Mühle, Johann Peter Reininghaus aus
Langenohl und Johann Casper Lück aus Valbert.
Aber auch in Hösinghausen scheiterte ein wirtschaftlicher Abbau an
der unzureichenden Kapitalausstattung der Besitzer und an der
Tatsache, dass die technisch noch unzulänglichen Pumpen mit den
starken Wassereinbrüchen nicht fertig wurden.
Das Bergwerk "Gute Hoffnung" - von 1852 bis 1863 wurde hier Braunkupferkies,
Kupferkies, Bleiglanz und Malachit gefördert - gibt uns von der
Eigentumsseite her einen interessanten Einblick in die Wirtschafts-
und Sozialgeschichte unserer Gemeinde. Der folgende Auszug aus der
Liste der im Berggrundbuch eingetragenen Anteilseigner macht dies
schon auf den ersten Blick deutlich und braucht daher an dieser
Stelle nicht näher untersucht werden.:
Initiatoren des Unternehmens waren Friedrich Sessinghaus aus dem
Listertal, der Hammerschmied Cordt aus Herscheid und der Premierleutnant
d. Res. Diepold aus Dortmund. Grund für die Einstellung des Bergwerks
im Jahr 1863: Wasserfülle.
Quelle: Valbert - 400 Jahre Schützenverein - 1000 Jahre Kirchspiel, Karl-Hans Nübel, 1982, S. 273-276
Das Wirtschaftsleben im Kirchspiel
Die erste urkundliche Erwähnung über den Eisenbergbau im Kirchspiel
Valbert ist heute fast 500 Jahre alt. Am 29. Mai 1487 berichtete Johan
von Valbert, Freigraf im Süderlande und im Dienst des Herzogs von Kleve
stehend, von einem Zeugenverhör zur Feststellung der grundherrschaftlichen
Rechte am Eisenbergwerk "to Valbrecht vor dem dorpe". Zu diesem Termin
erschienen "die Merckschen des Kerspels van Valbrecht alt und jong",
darunter Heinrich op dem Haigen, Clais van Westebbe, Hans Wever, Haeyne
to Eseloe, Kerstygen to Wylkenbert, Diderich to Rynkenschede, Wilhelm
to Spedinghusen und Hans op der Borch. Sie haben "mit handen und monde
to gade und den hilligen geswoeren" (mit Hand und Mund zu Gott und den
Heiligen geschworen), dass sie von ihren Eltern gehört hätten, das
Eisenbergwerk sei stets märkisch gewesen und "wan dairop Merkschen
gueden yserenstein wurde gewonnen, dass dey theynde dan oick Mercksch
syn suelde" (der Zehnte dann auch märkisch sein sollte). Diese Aussage
sei im Beisein der "Coelschen" desselben Kirchspiels gemacht worden,
"die dit myt getyget (bezeuget) und bekannt hebn". (E. Dösseler:
"Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen", Bd. II, Nr. 8)
Nach einem Reisebericht des Bergmeisters Hans Kutschauer aus dem Jahre
1663 (Siehe Quelle v. E. Dössler: Band III, IV Nr. 372) ist von ihm auf
dem Echterhagen im Reisbruck ein mächtiger Eisenstein (14 bis 21 Schuh
breit) gefunden worden. Er berichtet von weiteren Funden von Eisenstein
auf dem Breiterfeld an der Wulbecke (mächtiger Gang, 4 - 14 Schuh breit),
auf dem Stockhagen an der Host (5 Schuh breit) und an der Gleyer "über
Bonenhammerhitte" (1 1/2 - 4 Schuh breit) "setzet über 200 Lachter ins
felt".
Der Rentmeister zu Altena berichtet am 8. Dezember 1676 von einem "Bergwerk
bei Husinghausen in der Rohrbach, Kirspels Valbert". Hier hatten die
Gebrüder Bossenii (Busenius) ein "Neuwerk" gefunden und sich dieses als
Belehnung "angemaeßt".
In der Folgezeit scheint im oberen Listertal und im Ebbegbirge, nach den
aufgeschütteten Halden zu urteilen, lebhaft geschürft worden zu sein.
Akten der Clevisch-Märkischen Regierung geben uns darüber Auskunft, dass
zur Mitte des 17. Jahrhunderts ein Doktor Schardius und nach ihm der
Rentmeister zu Hörde, Macharell, ein Eisenbergwerk bei Valbert betrieben
haben. 1674 wurde Caspar Göckel damit belehnt und betrieb es bis zum
Jahre 1684. Acht Jahre später nahm ein Bergmann Juncker die Arbeiten
dort wieder auf. Dieselben Akten berichten auch von einer Eisenhütte im
Kirchspiel Meinerzhagen, die dem damaligen Amts-Kammer-Präsidenten von
Ley gehörte. Die Hütte war allerdings zu diesem Zeitpunkt schon außer
Betrieb.
Im Staatsarchiv Münster befinden sich in den Clevisch-Märkischen Regierungsakten
Berichte von Grubenbereisungen aus den Jahren 1755 - 1759. Die von der
Regierung mit der Überprüfung der Gruben beauftragten Bergmeister
beschreiben hier sehr ausführlich Zustand und Betrieb des Eisenbergwerks
Bracht im Kirchspiel Valbert (an der Grenze zu Meinerzhagen und
Lieberhausen. Besitzer war der Freiherr von Nagel zu Listringhausen.
Der letzte Bericht über dieses Bergwerk stammt vom 2. Juli 1759 und
trägt die Unterschrift des Bergmeisters F. Heintzmann. Auch er bemängelt,
dass das Bergwerk noch immer von einem Steiger und einem Arbeiter
betrieben werde und der bereits 1756 in Angriff genommene Luftschacht
"noch nicht mit dem Stollen durchschlägig" sei. Warum nach 1759 im
Bergwerk "Bracht" kein Erz mehr gefördert wurde, ist nicht bekannt.
Mangelnde Ergiebigkeit muss nicht unbedingt der Grund für die
Einstellung des Betriebes gewesen sein, denn der Eisengehalt des
heimischen Erzes lag durchschnittlich bei 30 Prozent und mehr.
Wahrscheinlich machten in den regenreichen Monaten widrige
Wasserverhältnisse die Arbeit im Stollen unmöglich.
Im Jahre 1810 berichtet der Maire vom Ebbe an Eversmann, dass
keinerlei Mineralien gewonnen würden und dass "der gute Eisenstein
bei Höhsinghausen wegen vormaliger Gemeindestreitigkeiten, wegen
Geldmangel und wegen Bergordnungsverbot, den Stein nicht außerhalb
des Landes zu verkaufen, unbenutzt bleibe".
Erst in den 50er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts sind neue
Gerechtsame erworben worden. Im Berggrundbuch des Amtsgerichts
Meinerzhagen sind außer den in der Gemarkung Meinerzhagen
gelegenen Erzgruben 22 Eisenerzgruben von Valbert eingetragen:
Morgenröte bei Hösinghausen (1835)
Unlängst hatte der Tiefbauunternehmer Friedhelm Abel bei Echterhagen
einen alten Stollen, die "Silberkuhle", freigelegt. Ein sauber in
den Fels gehauener Gang, etwa 30 m bis zu einer Einbruchstelle
begehbar, gibt uns ein ausgezeichnetes Bild von der schweren
Arbeit der Bergleute.
Mit einem gewissen Erfolg wurde im Raum Valbert das Bergwerk
"Morgenröte", das die Gebrüder Bossinii im Jahre 1676
schon betrieben hatten, zum Abbau des Eisenerzes wieder
aufgenommen. Betreiber waren Wilhelm Trommershausen aus
Elminghausen, Johann Wilhelm und Friedrich Wilhelm Ihne aus
Ingemerter Mühle, Johann Peter Reininghaus aus Langenohl
und Johann Caspar Lück aus Valbert. Laut Grubenbetriebsbericht
wurden in den Jahren 1824 - 1825 etwa 6000 Scheffel Eisenstein,
1832 2680 Scheffel und im folgenden Jahr 4398 Scheffel Eisenstein
gefördert. Aber auch in Hösinghausen scheiterte ein wirtschaftlicher
Abbau an der unzureichenden Kapitalbeschaffung der Besitzer
und an der Tatsache, dass die technisch noch unzulänglichen
Pumpen mit den Wassereinbrüchen nicht fertig wurden.
1831 erbauten die Betreiber des Bergwerkes "Morgenröte" in
Oesterfeld einen Hochofen: die Eisenhütte "Glückauf". Eine
Steintafel mit den Namen der Erbauer am Hause Schulte-Koch
in Oesterfeld gibt heute noch Kunde vom Bau der Eisenhütte
"Glückauf". Man kann jetzt noch das Mauerwerk des Hochofens,
der über drei Stockwerke hoch war, im Hause Schulte-Koch
erkennen. Hier wurde das in Hösinghausen geförderte Erz
verhüttet.
Aber im Laufe der Jahre konnten die Besitzer die Hütte nicht
mehr halten. In den 1840er Jahren gingen "Morgenröte" und
"Glückauf" an den Fabrikinhaber Friedrich Gottlieb von der
Becke zu Hemer und an den Gewerke Theodor Ulrich zu Bredelar.
Beide verkauften ihre Gerechtsame an dem Eisensteinbergwerk
und der Eisenhütte 1852 an den Fabrikanten Ludwig Schleiffenbaum
zu Sieghütte bei Siegen. Er legte in der Eisenhütte eine
Eisengießerei an. 1896 verkauft sein Sohn Karl das Anwesen
Eisenhütte an den Schreinermeister Schulte aus Hardenberg
und baute am Bahnhof in Meinerzhagen eine größere Eisengießerei. . . |