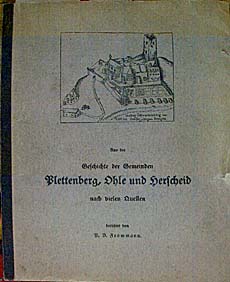Vorwort
Das Suchen nach Stoff zu einer Familienchronik brachte manche Schriftstücke
in meine Hände, die mir bis dahin unbekannte wichtige Tatsachen aus der
Vorzeit meiner Heimat enthielten. Das trieb mich zu weiterem Forschen in
Bibliotheken und Archiven, wo ich fast überall etwas Wertvolles fand, das in
den bisher veröffentlichten Büchern auf diesem Gebiete nicht berücksichtigt
worden ist.
Die in früherer Zeit erschienenen heimatgeschichtlichen Bücher sind den
meisten Lesern nicht mehr zugänglich. Hierhin gehören:
Die beachtenswerte Chronik der Stadt Plettenberg von dem Gerichts-Sekretär
Julius Hölterhof zu Plettenberg aus dem Jahre 1843 ist nie im Druck
herausgegeben worden und wird als Handschrift im Stadtarchiv aufbewahrt.
Diese Umstände führten mich zu dem Entschlusse, alles bisher Gedruckte und
Ungedruckte aus der Geschichte der Heimat zu bearbeiten und es dann einem
größeren Leserkreise vorzulegen.
In dem so entstandenen vorliegenden Buche ist von dem sonst in Büchern
ähnlicher Art üblichen Verfahren insofern abgewichen, als statt einer, hier
drei Gemeinden zusammenhängend behandelt worden sind. Das hat seinen Grund
darin, daß zwischen diesen drei Gemeinden außergewöhnliche Zusammenhänge
bestehen, namentlich bezüglich der Herscheider Mark, des Kirchen-, Schul-,
Gerichtswesens usw.
Manchen Lesern werden die Darbietungen trocken erscheinen. Diese mögen aber
bedenken, daß ich mir nicht die Aufgabe gestellt hatte, spannend und
hinreißend zu erzählen, vorhandene Lücken phantasievoll auszugestalten,
sondern geschichtliche Tatsachen unverändert und unverfärbt wiederzugeben.
Darum sind denn auch die benutzten Quellen nicht selten wörtlich, oft sogar
buchstäblich übernommen worden, weil auf diese Weise Sprache und Eigenart
unserer Vorfahren trefflich veranschaulicht werden.
Viele nebensächliche Einzelheiten mögen als überflüssig und störend
empfunden werden, sie sind eingefügt worden, um auch den Bewohnern kleinerer
Orte etwas aus der Geschichte ihrer nächsten Umgebung zu bieten. Dagegen
wurde von einem Abdruck wichtiger ganzer Urkunden und Schriftstücke
abgesehen, weil sie das Buch zu umfangreich und damit zu teuer gemacht haben
würden. Zudem sind solche auch schon in den in den letzten Jahren
entstandenen Heimatzeitschriften, besonders in den "Heimatblättern des
mittleren Lennegebietes" abgedruckt worden und werden auch in Zukunft noch
weiter veröffentlicht werden.
Daß bei der Bearbeitung des ungeheuer umfangreichen Stoffes hin und wieder
auch Unvollkommenheiten und selbst Unrichtigkeiten unterlaufen sein können,
ist ganz selbstverständlich und zum Teil auf die einander widersprechenden
Quellen zurückzuführen.
Obwohl der Stoff aus der letzten Zeit ganz unbegrenzt ist, mußte diese doch
recht kurz abgetan werden; denn wir sind noch zu sehr mit ihr in Verbindung,
sie gehört noch nicht völlig der Geschichte an.
Bei der Beschaffung der Quellen zu der vorliegenden Geschichte haben
zahlreiche Herren bereitwilligst Handreichung geleistet. Darum ist es mir am
Schlusse meiner Arbeit aufrichtiges Bedürfnis, allen, die mir irgendwie
behülflich gewesen sind, auch an dieser Stelle herzlichen Dank zum Ausdruck
zu bringen, vor allen den Herren in der Verwaltung der Universitäts-Bibliothek
zu Münster, den Herren an der Spitze der Staatsarchive zu Münster, Düsseldorf,
Wetzlar und des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin, den Herren Pfarrern, den
Herren im Dienste der Gemeindeverwaltungen und der Schulen.
Ganz besonderer Dank gebührt auch denen, die zu dem Bilderschmuck des Buches
verholfen haben, nämlich Herrn Rechtsanwalt Dr. Jur. Schneider, der die nach
den von seiner Frau Gemahlin hergestellten vorzüglichen photographischen
Aufnahmen angefertigten Klischees mir in uneigennützigster Weise geliehen
hat, in gleicher Weise auch Herrn Walther Brockhaus, der mir gleichfalls
Klischees gütigst zur Verfügung stellte, und endlich auch dem Herrn
Provinzial-Konservator Körner, der die Anfertigung von Auto-Galvanos zu
9 Bildern bereitwilligst gestattete.
Neujahr 1927 P. D. Frommann
Vom Landschaftsbild der Gemeinden Plettenberg,
Ohle und Herscheid
In unmittelbarer Nähe des Ebbegebirges und inmitten himmelanstrebender Höhenzüge und Berge hat
das nimmer rastende Wasser in Verbindung mit den Einflüssen der Witterung im Laufe von
Jahrtausenden einige herrliche Täler geschaffen, deren größtes das durch romantische
Naturschönheiten und hervorragende Fruchtbarkeit begünstigte Lennetal ist, in dem das Auge
erfreut wird durch den Anblick lieblicher, kleiner Siedlungen und mehrerer größerer Dörfer.
Diese sind: das freundliche Pasel, das gewerbreiche Eiringhausen, das ländliche
Böddinghausen und das durch herrliche Lage und reiche geschichtliche Erinnerungen in
gleicher Weise ausgezeichnete Ohle.
Das wichtigste und breiteste Seitental ist das mit ertragreichen Feldern und
Wiesen reich gesegnete, breite Elsetal mit einer Reihe stattlicher Dörfer: dem in
den letzten Jahrzehnten schnell emporgeblühten, betriebsamen Holthausen, dem geschützt
und versteckt liegenden Bremcke, dem malerischen Frehlinghausen, dem volkreichen
Hüinghausen und dem schon von dem berühmten Geschichtsschreiber von Steinen wegen
seiner guten Getreidefelder als die Krone des Amtes Plettenberg bezeichneten
Köbbinghausen an der gegenüberliegenden Seite.
Oberhalb Hüinghausens mündet das im allgemeinen enge Ahetal, das aber da, wo es sich
der Elsequelle am meisten nähert, durch seine flachen Abhänge und Breite zur Ansiedlung
in größerem Maße lockte und einen vorzüglich geeigneten Raum für das alte, freundliche
Kirchdorf Herscheid bot, das der Mittelpunkt der gleichnamigen Gemeinde ist mit ihren
zahlreichen Gehöften und Höfen in den engen, romantischen Tälern der Ebbecke, Verse,
Ahe und auf den zwischen ihnen emporragenden Höhen.
Fast parallel mit dem Elsetal erstreckt sich das in seiner Mitte kesselartig erbreiterte
Oestertal, das belebt wird von den Dörfern Himmelmert und Kückelheim inmitten einer
großen Feldflur und weiter auf Plettenberg zu von den mehr industriellen Orten Lettmecke
und Dankelmert. Das schmale Grünetal gewährte nur in seinem Oberlauf hinreichend Platz
für größere Ansiedlungen; hier entstanden die Dörfer Landemert und Hülschotten.
Dort, wo Oester und Grünetal ins Elsetal münden, am Treffpunkt von vier Straßen und
dazu in nächster Nähe der wichtigen Lennestraße, mußte naturgemäß ein größerer Ort
entstehen, die Stadt Plettenberg, die infolge ihrer zentralen Lage erhöhte Bedeutung
erlangt hat, indem sie Sitz der Amtsverwaltung und ihre alte Kirche die Mutterkirche
sämtlicher Kirchen des Amtes Plettenberg geworden ist. Das Amtsgericht zu Plettenberg
schlingt sogar ein gemeinsames Band um die Gemeinden Plettenberg, Ohle und Herscheid,
von denen man rühmen darf:
Wie lieblich sind hier Berg und Tal,
die Fluren wie so schön,
wie lockend auch im Sonnenstrahl
die waldbedeckten Höh'n.
Die Heimatgegend gewinnt beträchtlich an Reizen für den, der ihre Geschichte kennt, die
in den folgenden Kapiteln dargeboten werden soll.
I. Aus der Zeit der alten Sachsen und Franken
Während in der von dem fränkischen Volksstamm bewohnten Gegend südlich vom Rothaargebirge
die Menschen in Dörfern geschlossen zusammenwohnen, ist in dem Gebiete nördlich davon
die Besiedelung vorwiegend in der Form von Einzelhöfen erfolgt. Dabei ist auffallend,
dass in den Gemeinden Plettenberg, Ohle und Herscheid neben den vielen Einzelhöfen und
Gehöften auch zahlreiche dorfartige Ansiedlungen entstanden sind. Als solche können
gelten: Pasel, Eiringhausen, Böddinghausen, Ohle Landemert, Himmelmert, Plettenberg,
Holthausen, Bremcke, Köbbinghausen, Hüinghausen, Herscheid und Rärin. So viele größere
Ortschaften auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche kommen im märkischen Sauerlande
sonst nirgends vor.
In den vier Gemeinden Plettenberg, Ohle und Herscheid ist der Dialekt nicht überall
genau derselbe. Am meisten unterscheidet sich die Aussprache der Städter von der in
den andern Gemeinden gebräuchlichen. Ähnlich wie im nördlichen Kreise Hagen spricht
man in Plettenberg Hei für Heu, Beil für Böl, anbeiten für anzünden usw. Die Sprache
und die Art der Ansiedlung erwecken den Anschein, daß unsere Vorfahren nicht Glieder
einer einzigen, sondern verschiedener Völkerschaften gewesen sind.
Zu der Zeit, als die Römer Herren des Landes zwischen Rhein und Weser waren, bewohnten
die Sigambrer das Gebiet zwischen Ruhr und Sieg. Nachdem Tiberius, der Stiefsohn des
Kaisers Augustus, 40.000 dieses Stammes zur Ansiedlung an den Rheinmündungen veranlaßt
hatte, sind Teile anderer Stämme in die entvölkerten Bezirke nachgerückt. Am Ende des
ersten Jahrhunderts nach Christo hatten die Angrivarier oder Engern ihre Marken südlich
fast über den ganzen westfälischen Boden erweitert (Quelle: Wormstall,
Landeskunde der Provinz Westfalen).
Ein Zweig derselben, die Ampsivarier, soll nach den Ausführungen des Professors Vogt
zu der Zeit am Ebbe, an Lenne und Volme gewohnt haben. Im vierten Jahrhundert drangen
aus dem nördlichen Deutschland die Sachsen nach Süden bis in unsere Gegend vor, wo sie
einen Teil der früheren Bevölkerung in Hörigkeit oder auch wohl frei wohnen ließen.
Den Ampsivariern wird die Gründung der Orte zugeschrieben, die auf "ohl" und "scheid"
enden. Danach sind Pasel, Siesel, Ohle, Teindeln, Leinschede, Selscheid, Herscheid
und Brenscheid uralte Ortschaften.
Noch größer ist die Zahl der mit "husen" endenden Ortsnamen. Diese Orte sind
altsächsische Gründungen. Zu ihnen gehören auch diejenigen in der Gemeinde Herscheid,
denen man das im 18. Jahrhundert noch wenigstens im Hochdeutschen gebräuchliche
Grundwort "husen" später ganz abgestreift hat, wie Alfrin, Rärin, Waldmin, Stöpplin
u. a.. Demnach haben die allermeisten Orte ein Alter von 1500 bis 1700 Jahren.
Nach den Angaben des Sprachgelehrten Woeste, Iserlohn, waren die Sigambrer schwarzhaarig.
Bis in die heutige Zeit hinein kommen unter den ums Ebbe herum wohnenden Menschen
verhältnismäßig viele dunkelhaarige vor. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß
die von Norden eindringenden Ampsivarier und die hellblonden Sachsen die Reste der
Sigambrer in die unwirtlichen Gegenden zurückgedrängt haben. Anscheinend wohnten
diejenigen unserer Vorfahren, die einen Teil der Orte im Elsetal angelegt haben,
vorher an der mittleren Wenne; denn dort gibt es talaufwärts in derselben Reihenfolge
auch ein Holthausen, Bremcke und Frehlinghausen, sowie in einiger Entfernung von der
Wenne auch ein Grimminghausen, Dormecke, Kückelheim, Valbert u. a..
Die Art der Ansiedlung war aber wohl weniger von den Eigentümlichkeiten des betreffenden
Stammes abhängig als von den Bodenverhältnissen. Die engen Tälchen und manche Höhen
gestatteten nur eine Besiedlung in Einzelhöfen. Dagegen boten die weiten Talmulden
mit ihrer günstigen Bewässerungsgelegenheit vorzügliche Weiden und daneben die
besten Vorbedingungen zum Betriebe des Körnerbaues, zwangen gleichzeitig aber auch die
Menschen zu gemeinsamer Arbeit gegenüber der Verderben bringenden Gewalt des Wassers
und damit auch zum Zusammenwohnen in Dörfern und dorfartigen Ansiedlungen.
Zu der Zeit, als eine Völkerschaft die andere aus ihren Wohnsitzen schob, sind Jagd,
Fischfang und besonders Viehzucht die Erwerbsquellen der Menschen gewesen. Als die
Ortschaften entstanden sind, waren schon Anfänge des Ackerbaus vorhanden. Aber nur
ein kleiner Teil der Weidenflächen wurde umgepflügt und mit Gerste und Hafer bestellt.
Obst- und Gartenbau kannte man noch nicht. Recht viel kleine, struppige, aber ausdauernde
Pferde wurden gezüchtet, manche derselben den Göttern geopfert und zum Teil bei der sich
an das Opfer anschließenden Mahl verzehrt. Sämtliches Vieh blieb auch im Winter draußen.
Die kleinen, fensterlosen Fachwerkhäuschen dürftigster Art boten nur
Raum für die Familie. Nicht weit vom Hause befanden sich die zu demselben gehörenden
Weiden und Felder. Die Säume der großen Waldungen waren im Besitz der einzelnen
Bauerschaftsgenossen, denen sie Brand- und Bauholz lieferten. Dorfartige Ansiedlungen
hatten sich daneben wohl noch nicht weit entfernte Waldungen zu gemeinschaftlicher
Benutzung, z. B. zur Viehweide angeeignet. Die weiter von den menschlichen Wohnstätten
gelegenen Holzungen wurden von niemand weiter beansprucht.
Wenn die Behauptung richtig ist, man habe zur Zeit der Einführung des Christentums
dorthin Kirchen gebaut, wo früher Stätten heidnischen Kultes gewesen sind, dann kämen
als solche Herscheid und Plettenberg in Frage. Wahrscheinlich waren die alten Eichen,
die nachweisbar früher auf dem hohen Hemberg und auf der Molmert gestanden haben,
noch Erinnerungen an jene Zeit, in der man dort dem Donar opferte. Auch auf dem
Heiligenstuhl, am Hillenborn bei Köbbinghausen, bei dem "Heiligen Busch" in der
Duvenhard (zwischen Sechtenbecke und Erkelze) und auf dem Heiligenbrunn bei Herscheid
wird man zur Zeit des Heidentums die Götter verehrt haben.
In den altsächsischen heimischen Verhältnissen trat in wirtschaftlicher und religiöser
HInsicht ein folgenschwerer Umschwung ein, nachdem unsere Vorväter in langwierigen und
erbitterten Kämpfen von ihren fränkischen Nachbarn unterworfen worden waren. Herrenlos
gewordene Höfe und der Allgemeinheit gehörende Waldgebiete, die Marken, fielen nach
fränkischer Sitte dem Frankenkönige zu, der manche von ihnen wohl an vornehme Sachsen
oder an die auch zu der Zeit gegründeten Kirchengemeinden verschenkte. Die Marken
wurden von den Forestarii, den Beamten der fränkischen Könige, abgegrenzt, in dem sie
mit der Lockaxt 2 Meter breite Grenzwege schlugen und die Grenzen auch noch durch mit
dem Kreuzeszeichen versehene Locksbäume kennzeichneten, deren Entfernung mit der
Todesstrafe bedroht war. Marken gab es am Ebbe, Kleff, Offenborn, Heiligenstuhl, Mattenhagen,
Hemberg, Reckenberge, an der Molmert, im Jauberge, Voirhage und Renscheid.
|