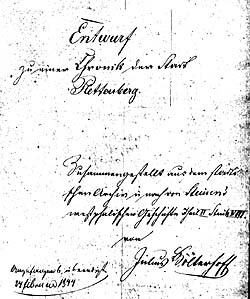| Chronik der Stadt Plettenberg
zusammengestellt aus dem städtischen Archiv und nach von Steinens
westfälischer Geschichte von
Julius Hölterhoff, 1844 (über 400 Folio-Seiten)
1. Geschichte von der ältesten Zeit bis 1843
A. Allgemeine äußere Geschichte
Bei der Lage der Stadt Plettenberg, an der Grenze zwischen der Grafschaft
Mark und den ehemaligen Herzogtümern Engern in Westfalen, läßt
sich annehmen, daß sie in den Zeiten, in welchen die Herrschaft und das
Recht hauptsächlich in der Hand der Gewalt ruhte, bei der Behauptung der
Ersteren nicht selten Zeugin oder Teilnehmerin der Anstrengungen war, welche
angewandt werden mußten.
Aber weder die allgemeine Geschichte berichtet hierüber etwas, noch hat
sich irgendeine Tradition aus diesen älteren Zeiten erhalten von so viel
historischer Bedeutung, daß an ihr bestimmtes oder mutmaßliches
Datum für eine Geschichte der Stadt geknüpft werden könnte.
Dies scheint überhaupt an der Geschichte der verflossenen Jahrhunderte
nur als integrierender Teil des Landes Anteil und Erfahrung genommen zu haben,
da sich nirgendwo Spuren von Einzelhandlungen oder abgesonderter Selbständigkeit
vorfinden, weshalb denn auch die Geschichte der Stadt bis auf die neueste Zeit,
mit Ausnahme der Gestaltungen ihrer inneren Verhältnisse, in die Geschichte
des Landes und der Landesherrschaft verschmolzen ist.
Der Ursprung der Stadt ist völlig dunkel - ihre Erhebung als
solche mit den Umständen unter welchen unbekannt und nach dem
Zeitpunkte, in welcher sie geschehen, zweifelhaft.
Die im Archiv der Stadt vorhandenen, aus dem Brande 1725 geretteten
ältesten Urkunden reichen bis in das 14. Jahrhundert. Bis
jetzt sind sie aber noch nicht alle entziffert, weshalb eine Ordnung ihrer
Nachrichten untereinander, auch für den Gebrauch rücksichtlich
späterer Zeiten und Verhältnisse, nicht hat ausgeführt werden
können.
Wir haben nur eine einzige Zusammenstellung der größtenteils nur
aus jenen Urkunden geschöpften Nachrichten, und zwar bei von den Steinen
im zweiten Teil der Westfälischen Geschichte; und der vorliegende
Entwurf muß sich hier an die Mitteilung des verdienten Geschichtsforschers
halten, um so mehr, als die übrigen von dem letzteren nicht benutzten
Dokumente des Archivs dem Verfasser unlesbar sind.
Nur über den Ursprung des Namens kann man sich mit dem Gewährsmann
nicht einverstanden erklären, da derselbe gegen dessen Ableitung
eigentlich geradezu in die erste Geschichte der Stadt hineinzuführen scheint.
Wenn von den Steinen den Namen des Ortes von einem in der Nähe desselben
gelegenen Berge, noch jetzt die "Bracht" geheißen, ableitet, weil die
Stadt auf einer Ebene vor diesem Berge, "Plat vor der Bracht", angelegt sei,
so folgt er hierin gewiß weniger den Forderungen der Historie, als
irgendeiner der Mitteilungen städtischer Zeitgenossen, welche vielleicht
aus einem kleinlichen Beweggrunde der Zeit den Namen der Stadt lieber von
einer zufälligen örtlichen Lage herleiten möchten, als, was
der Wahrheit gewiß näher lag, von dem Einflusse, welche eine
anerkannt schon in der Kindheit des Ortes blühende Ritterfamilie, die
"von Plettenberg", auf die Entwicklung derselben ausüben mußte.
Welche Bedeutung der in der Gegend häufig vorkommende Name "Bracht"
als Wurzelwort auch immer haben mag, so ist doch der Flächenraum bei der
Stadt, welche diesen Namen führt, an sich und im Verhältnis zu
anderen gleich nahe gelegenen, mit Eigennamen versehenen, gar zu unbedeutend,
als daß derselbe hätte Veranlassung geben können, den Namen
des Ortes in der vom Geschichtsschreiber angedeuteten Art zu bilden.
Zweifelsohne ist die Niederlassung der Familie von Plettenbracht,
Plettenbrecht, Plettenbergh oder welche Endformen der Name erlitten haben mag,
älter als die erste Ansiedlung für die jetzige Stadt um diesen
Stammsitz; und es erscheint schon deshalb ungezwungen, wenn der Name des Ortes
von der ältesten und gewiß (ohne andere Beziehungen) bedeutendsten
Familie abgeleitet werde.
Diese Ableitung wird dem Beweise nahegebracht, wenn man mit von Steinen
es als eine kundliche Wahrheit voraussetzt, daß die meisten Güter in und um
Plettenberg Besitztum der Herren von Plettenberg bis in das 14. Jahrhundert
gewesen seien. Läßt man hierfür den Mitteilungen von Steinen aus einem Register
der um das Jahr 1410 gesammelten Märkischen Briefschaften, die Beweiskraft
alter Kopien, nach welchen
1.) Henderich von Plettenberg und sein Sohn dem Grafen Engelbert die Vogdie
zu Plettenberg zur Hälfte verkauften,
2.) Johann von Plettenberg dem Grafen Engelbert den Gemahl des Hafers in der
Mühle zu Plettenberg,
3.) die Söhne Duderichs von Plettenberg, Henrich, Heidenreich, Aleff und
Johann von Plettenberg, dem Grafen Engelbert von der Mark ihre Landleute und
Untersassen verkauften,
4.) Gert von Plettenberg, Gerdes Sohn vorscheiden ist (geschieden ist)
mit Greve Engelbert von dem Dorpe und Luiden to Plettenberg und Landebert das
Dorp, so erscheint jene Behauptung mit nicht unwichtigen Beweismitteln versehen.
Außerdem befindet sich im städtischen Archiv als älteste Urkunde aus
dem Jahre 1362 ein Vertrag zwischen Heidenreich zu (von ?) Plettenberg und
dem Kapitel St. Andreae zu Cöln über den großen Zehnten zu Plettenberg; von
Steinen teilt diesen Brief nicht mit und es findet sich auch keine Übersetzung
vor, aus der der Grund zur Zehntverpflichtung zu entnehme wäre.
Das Kapitel St. Andreae hat aber nach der im Archiv befindlichen
Urkunde vom Jahre 1555 diesen (großen und schmalen) Zehnten dem Rat der Stadt
Plettenberg verkauft und benennt denselben ausdrücklich als zur Kirche St.
Andreae gehörig: Erbpacht und Lehngut.
Man muß daher annehmen, daß Heidenreich von Plettenberg im Jahre 1362
Lehnträger der mit diesem Zehnten belasteten Grundstücke war. In den Jahren
1810 bis 1818 ist dieser Zehnten als ein Garbenzehnten ausgekauft und kapitalisiert
worden und die Verhandlungen weisen nach, daß ein großer, ja fast der größte
Teil der städtischen Feldmark, die sicherlich vorgekommenen Verdunkelungen
außer Acht gelassen, diesem Zehnten unterworfen war.
Es läßt sich daher dem Schlusse: daß früher und noch bis zum Jahre 1362
außen den vielen noch bis in die neueste Zeit der Familie von Plettenberg
zuständig gewesenen Gütern des Amtes Plettenberg, auch die Stadt und deren
Feldmark Eigentum der Ritter von Plettenberg war oder unter ihrer Herrschaft
stand, wohl nichts erhebliches einwenden. Denn wenn auch das Archiv aus dem
Jahre 1498 noch eine Urkunde besitzt, nach welcher Hermann Kobbenroth demselben
Kapitel St. Andreae mit dem schmalen Zehnten (einen halben Goldgulden jährlich)
pflichtig war, die Übertragung des großen und schmalen Zehnten an den städtischen
Rat, im Dokumente vom Jahre 1555 aber keiner Ausnahme gedenkt, in der Zeitfolge
aber eine solche auch nicht herausgestellt hat - so schließt dieses Dokument
für jene Behauptung weiter nichts aus, als daß Hermann Kobbenroth mit Bewilligung
des lehnherrlichen Kapitels, teilweise Zwischenlehnsträger war.
Eine vollständige Übersetzung der Urkunde vom Jahre 1362 würde vielleicht
die frühesten Besitzverhältnisse aufhellen.
Hiernach rechtfertigt sich nicht allein die Ableitung des Namens der
Stadt Plettenberg (von) den früheren Besitzern des Teritorii, sondern es beginnt auch
die Geschichte der Stadt mit der Zeit, in welchem die Familie von Plettenberg
sich des Eigentums oder der Herrschaft über derselben entäußerte.
Im städtischen Archiv befindet sich noch ein Brief vom Jahre 1433, laut
dessen Gert von Plettenberg viele Dienstleute der Dienstbarkeit entläßt, dessen
Inhalt aber zu der Geschichte der Stadt in keinem Verhältnis steht.
Hiermit schließt, so weit alle Nachrichten reichen, die Verbindung
zwischen der Familie von Plettenberg und der Stadt ab, mit den Ausnahmen, daß
ihre Stammburg in derselben vielleicht noch längere Zeit bestanden hat, daß
sie noch in den Jahren 1830 zur Hälfte Eigentümerin der bei der Stadt gelegenen
Wahlmühle (Walkmühle?) war, nur daß das Haus Schwarzenberg, im Amte Plettenberg,
das letzte adlige Besitztum der Familie in hiesigen Grenzen, die bei Eiringhausen
über die Lenne führende Brücke mit der Stadt gemeinschaftlich (jetzt jeder Teil
zur Hälfte mit gleichen Anrechten an dem Brückenzoll) bauen und unterhalten
muß.
Die Geschichte der Stadt Plettenberg beginnt also in der Zeit, in welchem
der Ort aus der Privat-Dienstbarkeit, oder der Spezialherrschaft der Ritter von
Plettenberg im 14. Jahrhundert, teils durch Verkauf, oder nach den oben angeführten
urkundlichen Mitteilungen, teils, nach der von Steinen sagenhaften Mitteilung
(pag. 16) durch Einziehung eines Teils der Güter infolge eines blutigen
Bruderzwistes, an den Grafen von der Mark mit mehrerer oder minderer Selbständigkeit,
unter landesherrliche Hoheit kam.
Der Graf Engelbert von der Mark erteilt im Jahre 1387 dem Dorfe Plettenberg
das Recht, Bauen und Zaunen innerhalb und außerhalb des Ortes, welches Straßen
und Plätze schädigen möchte, selbst zu strafen. (Die Strafen verfallen nicht
dem Landesherrn) Hier kann man also schon ein geordnetes inneres Regiment annehmen.
Das Dorf Plettenberg erhält in demselben Jahr das Recht, für die
dazugehörigen Waldungen einen eigenen Holzrichter zu setzen, der (sich) nach den der
Stadt Iserlohn verliehenen Marken-Rechten und den dort üblichen Gewohnheiten
richten möge. Also eine Privat-Jurisdiction.
Nach einem Briefe bei von Steinen (Nr. 3 Pag. 54) erteilt der Graf
Diedrich von der Mark der Stadt Plettenberg 1397 ein besonderes Gericht, wie
zu Lüdenscheid; einen freien Wochenmarkt; Heimfall der Erbabfindung zu dem
Stammhause; eheliche Gütergemeinschaft; die Befreiung von anderen als den
gewöhnlichen Schatzungen der Städte. Ferner das Recht zwei Bürgermeister und
acht Ratsleute aus den Bürgern zu wählen, welche alljährlich je zur Hälfte
neu erwählt werden.
Im Archiv ist dieses Dokument nicht, weder im Original, noch in einer
authentischen Abschrift, auch nicht ein altes Statuten- oder Kopiarbuch, nach
welchem das Datum des Dokuments, welches gemäß einer Mitteilung der Königlichen
Regierung vom 21. Dezember 1835 fehlerhaft sein soll, berechtigt werden könnte.
Im Jahre 1400 bestätigt Graf Adolph von Cleve und Mark (nach von Steinen
pag. 58) die der Stadt verliehenen Rechte und Freiheiten, und im Jahre 1423
Graf Adolph von Cleve und von der Mark in Ravensburg, Herzog von Berg, die
von seinen Neffen von Cleve und von der Mark und deren Vorfahren der Stadt
verliehenen Freiheiten.
Das Datum des Dokuments vom Jahre 1397 in Zweifel gezogen, fällt also
die Erhebung des Dorfes resp. der Freiheit Plettenberg zu dem Range einer
Stadt in den Zeitraum von 1387 bis 1400.
Das Wappen der Stadt ist ein Wappenschild zwischen zwei Türmen, geziert mit vier
Querbalken und 25 Feldern, welche mit den märkischen Farben Rot und Silber
abwechseln, und einem über demselben geschlungenen Bande.
Diesem Wappen entsprechen auch die ältesten wie die neuesten Siegel. Bei der
Grafschaft Mark ist die Stadt auch durch allen Wechsel der Herrschaften und
Regenten-Familien hindurch verblieben, wie von diesen von Zeit zu Zeit und nach
der jüngsten vorhandenen Urkunde am 20. Oktober 1689 von Friedrich III., Markgrafen
von Brandenburg (v. d. Cleve), die Rechte in Freiheiten der Stadt teils bestätigt
worden sind.
Wie die Familie von Plettenberg, so haben auch wohl die übrigen in der Stadt ansässig
gewesenen freien Lehnsmänner, von denen außer dem noch vorhandenen und mit seinen
Gütern als adelig behandelten Hause Cobbenroth von Steinen noch des Starckenhauses
erwähnt, auf dieselbe seit ihrer Selbständigkeit wenig Einfluß gehabt, da derselbe
nirgendwo bemerkbar ist.
Die Stadt ist früher befestigt gewesen, wie noch heute an den zu Gärten umgewandelten,
den Namen "Damm" führenden Resten der Umwallung ersichtlich ist. Nach von Steinen ist
die Ringmauer mit sieben Türmen versehen gewesen, von denen einer, der Gefängnisturm,
und die beiden im Süden und Norden der Stadt gelegenen Tore zur Zeit des
Geschichtsschreibers (1755) noch vorhanden gewesen sind.
Die Befestigung mag teils zur eigenen Sicherheit der Stadt geschehen sein; sie hat
aber großenteils als Grenzschutzwehr des Landes gedient. Dies anerkennt schon das
Privilegium des Herzogs von Cleve vom Jahre 1510 mit den Ausdrücken, daß die Stadt
als an den Grenzen (Kanten) zunächst des Stifts (Gestifts) Cöln gelegen, mehr als
andere Orte von Widerwärtigen und Feinden des Landes zu leiden haben, sonderlich
in der jüngsten Zeit ihres Notdürftigsten beraubt worden, deshalb der erbetenen Gnade
würdig sei, mit der Erwägung: daß der Flecken "eyn vürpael des Landtz eyn den Huyck
gelegen von noiden to bevesten iß" - also: daß in dieser Zeit die Stadt als ein
Vorwerck, ein Vorschutz an dieser Grenze für das Land anzusehen war.
Gleichwohl berichtet weder die Geschichte noch die Tradition keine einzelne bestimmte
Tatsache; und mit den Räubereien und Raufereien zu den Zeiten des Faustrechts, welche
mit den Geschichten des Tages untergingen, scheinen auch die Wechselfälle der Zeiten
und des Krieges auf die äußeren Schicksale der Stadt nur wenig Einfluß gehabt zu haben,
wie denn auch von Steinen bei den widrigen Schicksalen aus dem 30jährigen Kriege nur
eine Plünderung am 27. und 28. Dezember 1632 erzählt und dann einen Einfall der
Franzosen im Jahre 1672 und 1679 erwähnt.
So würde dann, wie bereits im Eingange gedeutet worden ist, die äußere Geschichte der
Stadt Plettenberg von der älteren bis auf die jüngere Zeit mit der Geschichte des
Landes und der Regenten erzählt werden.
So innig aber in angeborener Treue die Stadt dem angestammten, größtenteils in
friedlicher Erbfolge sich fortpflanzenden Herrscherhause angehangen hatte, mit
immerfertiger Bereitswilligkeit, behufs der Herrscherheerzüge und der vaterländischen
Kriege, zum Kriegsschatz steuerte und ihre Söhne den ruhmgekrönten Fahnen folgen ließ,
- so widerwärtig wirkte auf sie die Besitzergreifung der Franzosen im Jahre 1810.
Zwar mußte gewiß auch das Städtchen Plettenberg sich der Gewalt der Eroberung beugen
und in den Umsturz ihrer Rechte und Freiheiten, in die Abänderung aller Regierungs-
und Verwaltungsformen mit Geduld sich fügen; aber die Schmach der Unterdrückung wurde
tief empfunden und erfüllte, weit entfernt von dem Jubel anderer Orte, die Herzen mit
bitterem Haß gegen die Unterdrücker.
Fortsetzung nächste Seite
|