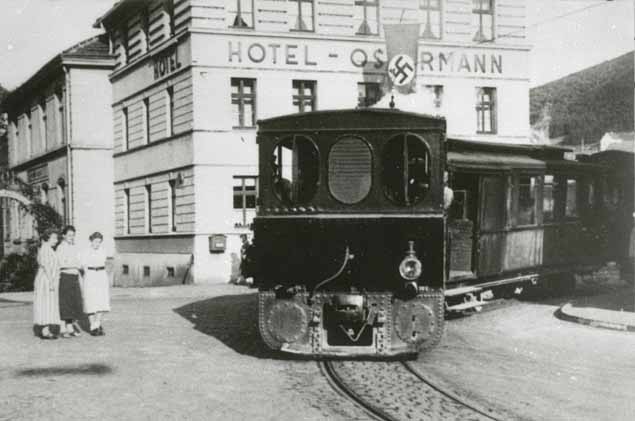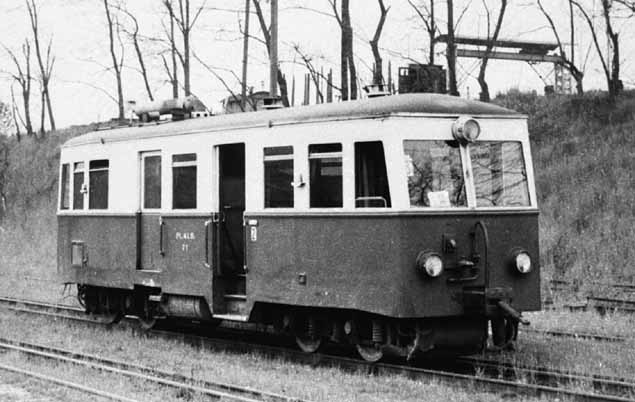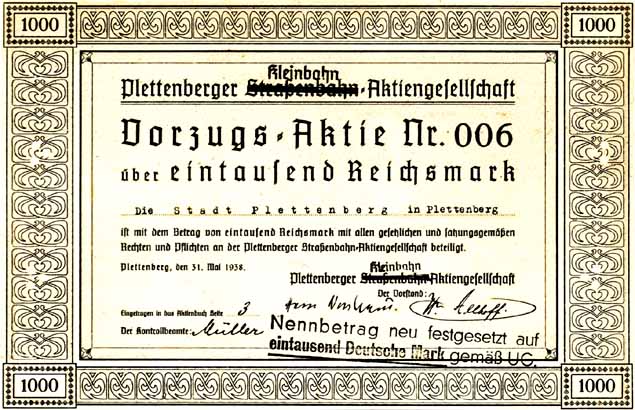|
Elektrifizierung erneut im Gespräch
Auf der Oestertalbahn erfolgte im Jahre 1927 eine weitere Streckenverlegung.
Im gleichen Jahr wurde auch das bereits vor Jahren erörterte Projekt für
eine Elektrifizierung wieder ernstlich aufgegriffen. Anlass hierzu war die
Erkenntnis, dass die technische Verbesserung des Betriebes in Anpassung
an die neuen Verkehrsverhältnisse zwingend notwendig waren. Diese im Jahre
1927 noch nicht abgeschlossenen Überlegungen scheiterten aber schließlich
einmal an der Höhe des Kostenaufwandes für die Elektrifizierung und zum
anderen an der in 1929 - 1932 zunehmenden Wirtschaftskrise mit ihrer
anhaltenden Verkehrsminderung.
Die im Jahre 1924 begonnene Erneuerung der Gleisanlagen mit teilweiser
Streckenbegradigung im Oestertal konnte bis zum Jahre 1941 fortgesetzt
werden. Durch die zunehmenden Kriegseinwirkungen musste allerdings in
den Kriegsjahren von weiteren Gleiserneuerungen abgesehen werden. Das
gilt auch für die Erneuerung von Weichen und für Verschweißung von
Schienenstößen. Entsprechend dem Vorgehen der Reichsbahn schaffte die
Kleinbahn am 15. Januar 1929 die 4. Wagenklasse in ihrem Personenverkehr
ab und führte von diesem Zeitpunkt an nur noch die 2. und 3. Wagenklasse.
Im Jahre 1935 errichtete sie anstelle eines alten Wohngebäudes ein neues
Zweifamilienwohnhaus für 17.800 Mark in ihrem Betriebsbahnhof Plettenberg-Eiringhausen.
Im Betriebsbahnhof Plettenberg-Oberstadt wurden die Anlagen und Einrichtungen
der Lokomotivwerkstatt erweitert. Diese Erweiterungen wurden in den Jahren
1940 und 1941 fortgesetzt.
Der im Jahr 1938 in Auftrag gegebene dieselelektrische Triebwagen wurde
durch kriegsbedingte Erschwernisse erst im Jahre 1941 angeliefert. In
Betrieb genommen wurde er am 17. Dezember 1941. Mit diesem Triebwagen
hat die Kleinbahn zunächst freilich wenig Freude gehabt. Abgesehen davon,
dass der 200 PS-Motor erhebliche Kraftstoffmengen verbrauchte, ohne dass
ein entsprechender Nutzen bei 33 Sitzplätzen in dem Fahrzeug erzielt
werden konnte, war die Maschinenanlage des Triebwagens, die fast 2/3
des Fahrzeug-Innenraumes einnahm, sehr störungsanfällig. Das Fahrzeug
war daher in den ersten Jahren nur wenig im Einsatz. Erst nach dem Einbau
eines luftgekühlten Klöckner-Humboldt-Deutz-Motors mit 165 PS in den
Jahren 1954-1955 konnte der Triebwagen ab 27. März 1955 mit besserem
Erfolg und längeren Laufzeiten für den Personenverkehr der Kleinbahn
eingesetzt werden.
Von Wiesenthal nach Westerland
Die Entwicklung ihres
Eisenbahnverkehrs und die aus kriegsbedingten Gründen notwendige
Zusammenarbeit mit dem Bahnhof der Reichsbahn erforderten jedoch eine
räumlich engere Verbindung dieser Kleinbahn-Betriebs- und Verkehrsstellen
zur Reichsbahn. Der Betriebsdienst wurde von Inbetriebnahme der Bahn an
bis zum Auslauf ihres Strecken-Eisenbahnbetriebes ausschließlich von
einer Betriebsstelle aus gelenkt (Zugleitverfahren). Dieses den
Betriebsverhältnissen der Kleinbahn angepasste vereinfachte Zugleitverfahren
hatte sich bis zur Einstellung des Eisenbahnbetriebes, abgesehen von
einigen kleineren Betriebsunfällen, bewährt.
Noch in den Kriegsjahren 1941, 1943 und 1945 konnte die Kleinbahn bei
der Bedeutung ihres Güterverkehrs neue Rollwagen beschaffen. Auf Weisung
des Reichs- und Preußischen Verkehrsministers beschloss die Hauptversammlung
am 28. Mai 1942 das bisher unter dem Namen "Plettenberger Straßenbahn
Aktien-Gesellschaft" geführte Unternehmen in "Plettenberger Kleinbahn
Aktien-Gesellschaft" umzubenennen, weil nach den neuen gesetzlichen
Bestimmungen Bahnen, die in öffentlichen Straßen mit Dampflokomotiven
betrieben werden, nicht mehr als Straßenbahn rechtlich bezeichnet waren.
Der im Jahre 1904 errichtete und in den Folgejahren weiter ausgebaute
Güterbahnhof der Kleinbahn in Eiringhausen lag mit seinen Gleisanlagen
in dem Überschwemmungsgebiet der Lenne. Im Jahre 1928 wurde daher bereits
die Höherlegung der Gleisanlagen für notwendig gehalten, musste aber
aus wirtschaftlichen Gründen zurückgestellt werden. Erst im Jahre 1944
konnte diese Höherlegung der gefährdeten Gleisanlagen um 45 cm durchgeführt
werden. Außerdem wurde die Entwässerungsanlage des Bahnhofes erweitert
und verbessert.
Im Jahre 1945 wurde die Bahn vom Kriege überrollt. Am 12. April musste
der gesamte Betrieb bei Besetzung der Stadt Plettenberg durch amerikanische
Truppen (Anm. HH: 75th + 86th Inf Div) eingestellt werden, wurde jedoch
bereits am 7. Mai mit Genehmigung des amerikanischen Stadtkommandanten
für den Personenverkehr wieder aufgenommen. Der Güterverkehr lief erst
im Jahre 1946 wieder an, er war zunächst sehr schwach.
Wegen des erheblichen Mangels an Arbeitskräften musste die Kleinbahn
im Jahre 1947 auf fremde Arbeiter von Unternehmen für die dringendsten
Arbeiten in der Bahnunterhaltung und Werkstatt zurückgreifen.
Die Güterabfertigung der Kleinbahn musste im Jahre 1951 infolge der
Einbeziehung in die durchgehende Frachtberechnung und Abrechnung erweitert
werden. Die Zunahme der Verwaltungsarbeiten im Zuge der Verkehrsausweitung
machte im Jahre 1952 den Umbau des nicht mehr benötigten Güterschuppens
am Verwaltungsgebäude in Büroräume erforderlich.
Bereits vor dem erstmaligen Ablauf der Genehmigung für den Eisenbahnbetrieb
am 20. April 1956 wurde immer nachdrücklicher die Beseitigung des Eisenbahnbetriebes
in den Stadtstraßen wegen des ständig zunehmenden Kraftverkehrs nach
Ablauf der Genehmigung verlangt. Wenn es auch gelang, zunächst den
Eisenbahnbetrieb mit kurzfristigen Verlängerungen der Genehmigung noch
zu erhalten, so erschien es jedoch nicht mehr zweckmäßig, größere Aufwendungen
für Erneuerung und Modernisierung des Eisenbahnbetriebes in den Folgejahren
vorzunehmen. Es wurden daher nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten
am Oberbau und an den Betriebsmitteln durchgeführt.
Die Kleinbahn setzte zwar mit Unterstützung der Deutschen Bundesbahn ihre
Bemühungen um die vorläufige Erhaltung ihres Eisenbahnbetriebes fort, musste
aber zur Entlastung der innerstädtischen Straßen vom 1. Dezember 1958 an die
Güter für die obere Stadt (besonders für das Else- und Oestertal) nicht mehr
von Eiringhausen, sondern von Oberstadt aus zustellen. Ein Teil der dadurch
der Kleinbahn entstehenden Einnahmeausfälle und erhöhten Betriebskosten
wurden von der Bundesbahn erstattet. Diese Maßnahmen konnten zwar die
schwierige Verkehrssituation in der Innenstadt entlasten, nicht aber das
Problem lösen und die Forderung auf Beseitigung des Eisenbahnbetriebes
abzuwenden. Seit 1958 befasste sich die Kleinbahn daher mit Fragen einer
zweckmäßigen Umstellung ihres Ladungsgüterverkehrs von der Schiene auf die
Straße. Dabei war aus wirtschaftlichen Überlegungen anzustreben, den bisherigen
Verkehr weitestgehend zu erhalten.
Planung und Durchführung der Maßnahmen für die Betriebsumstellung werden noch
an anderer Stelle näher dargelegt. Der in den letzten Jahren bereits zunehmend
auf Omnibusse umgestellte Personenverkehr wurde am 1. Januar 1959 mit der
Stilllegung auch im Oestertal endgültig eingestellt. Ihm folgte am 23. Februar
1959 der Stückgutverkehr der Kleinbahn, der bisher noch etwa zur Hälfte auf der
Schiene durchgeführt worden war. Von diesem Zeitpunkt an wurde nur noch der
Ladungsgüterverkehr auf der Schiene befördert. Dieser restliche, allerdings
beachtliche Eisenbahnbetrieb wurde durch einen Brückenneubau im Zentrum der
Stadt (Maiplatz) ab 15. Juli 1959 weiter erschwert, weil das durchgehende
Betriebsgleis zwischen den Betriebsbahnhöfen Plettenberg-Oberstadt (zugleich
Lokomotivbahnhof der Kleinbahn) und Plettenberg-Eiringhausen unterbrochen
wurde. Hinzu kamen weitere Erschwernisse durch Beschränkung der Betriebszeiten
für den Zugverkehr.
|
58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de