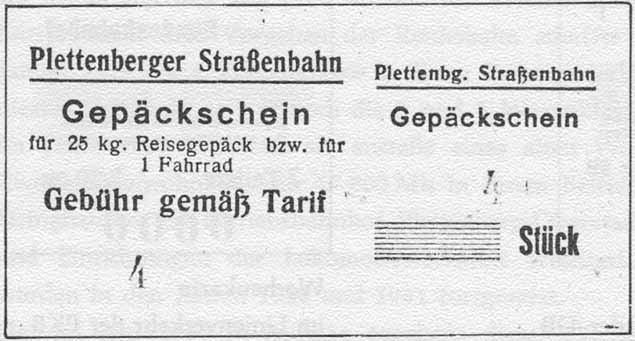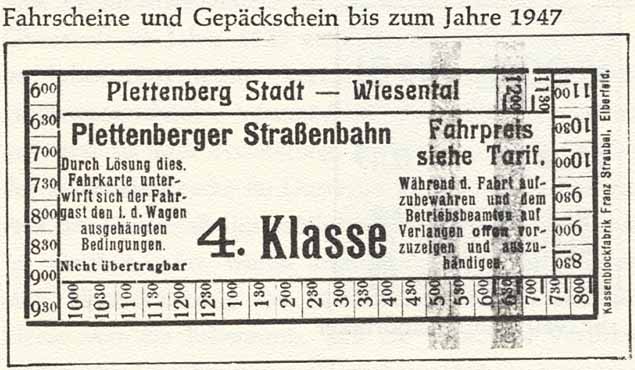|
1958: Beschäftigungshöchststand mit 117 Mitarbeitern
Gerade die Verkehrsunternehmungen sind von allgemeinwirtschaftlichen
Schwankungen besonders abhängig. Als ausgesprochene Dienstleistungsbetriebe
ohne eigene Produktion unterliegen sie Kriegsereignissen und Wirtschaftsdepressionen
ebenso wie auch Konjunkturschwankungen mehr als Wirtschaftsunternehmen.
Auch die Plettenberger Kleinbahn hat zwei große Kriege und ihre wirtschaftlichen
Stagnationen als Folge der Niederlage mit ihren unerfreulichen wirtschaftlichen
Auswirkungen, aber auch verkehrsbelebende Wirtschaftskonjunkturen in der
Vergangenheit erlebt.
Quelle für den kursiven Einschub: 1912-13, Bericht über den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten der
Stadt Plettenberg für die Zeit vom 1. April 1912 bis 31. März 1913
"Auf der Strecke Plettenberg - Holthausen wurde mit Genehmigung des Herrn
Regierungspräsidenten vom 25. Juni 1912 der Sonntags-Personenverkehr am
14. Juli 1912 eingestellt. Auf der Oesterstrecke wurde vom Anfang bis zum
Anschluss Oesterhammer der Oberbau vollständig erneuert. Es wurde hierzu
das Staatsbahnprofil 6 e auf eisernen Schwellen Profil 51 verwandt. Mit
dem Umbau der Strecke von Oesterhammer bis Oesterau soll so lange gewartet
werden, bis die Schwierigkeiten mit der Firma Brockhaus bezüglich der
Verfrachtung ihrer Güter behoben sind.
(Foto: P.Hauswald 08.1960)
Wenn sie dennoch ohne Substanzverlust ihren Eisenbahnbetrieb, wenn auch
zeitweilig mit kriegs- und krisenbedingten Einschränkungen, über schwierige
Zeiten aufrecht erhalten konnte, so hat sie ihre Bedeutung und enge
Verpflechtung mit der Wirtschaft in ihrem Verkehrsbereich damit bewiesen.
Das gilt ebenso für die in den Jahren 1961 und 1962 durchgeführte
Betriebsumstellung, auf die besonders wegen ihrer verkehrsbedingten Eigenart
später noch einzugehen sein wird.
Der Belegschaftsstand unterlag im Laufe der Jahre erheblichen Schwankungen
und bewegte sich in den Jahren 1896 bis 1918 zwischen 30 und 47. Von 36
Betriebsangehörigen im Jahre 1918 schnellte die Zahl der Betriebsangehörigen
auf 52 im Jahre 1919 als Folge der mit Ausgang des ersten Weltkrieges
begonnenen sozialen Strukturwandlung (Arbeitszeitverkürzung usw.) empor.
Die bis auf 58 Betriebsangehörige im Jahre 1925 angestiegene Belegschaftszahl
ging nach einigen Schwankungen mit der zunehmenden Wirtschaftskrise in den
Jahren 1930 - 1932 auf 42 zurück, um ab 1933 wieder bis auf 65 in den Jahren
1941 und 1942 zu wachsen. Sie sank jedoch durch den Krieg in den Jahren 1943
bis 1945 auf 38 ab. Mit dem Jahr 1946 nahm sie wieder ständig zu, nicht zuletzt
durch den planmäßigen Ausbau des seit 1932 begonnenen Kraftverkehrs und erreichte
im Jahre 1958 ihren Höchststand mit 117 Betriebsangehörigen.
sank die Belegschaftszahl vom Jahre 1959 an als Folge des fortschreitenden
allgemeinen Arbeitskräftemangels in der gesamten Wirtschaft ständig bis
auf 95 Betriebsangehörige im Jahre 1961 ab. Die fehlenden Arbeitskräfte
und die weiter zunehmenden Verkehrs- und Betriebsaufgaben führten daher
zur Vermehrung der Überarbeit und zu einer entsprechenden Kostensteigerung
des Betriebes.
Der Eisenbahnbetrieb der Kleinbahn wurde seit seiner Aufnahme im Jahre 1896
von Jahr zu Jahr in seinen Anlagen und seiner Abwicklung ständig erweitert,
weil die an die Kleinbahn gestellten Verkehrsanforderungen dies notwendig
machten. In den Jahren 1903 und 1904 stellte der Bau der Oestertalsperre
erhöhte Betriebsanforderungen an die Kleinbahn. Im Jahre 1907 wies die
Kleinbahn bei ihren 3 Bahnen 10,417 km durchgehende Gleise, 2,295 km Umlaufgleise
und 3,179 km Anschlussgleise, zusammen also 15,891 km Länge und 82 Weichen auf.
Von der Gesamtlänge entfielen 7,507 km auf Vignolschienen mit Eisenschwellen
und 8,384 km auf Rillenschienen, die auf Packlage und zum größten Teil mit
Spurstangen verlegt waren. Nicht einbezogen in diese Angaben ist die
Privatanschlussbahn. Im Jahre 1908 wurden weitere 4 Anschlüsse verlegt. Die
Gesamtlänge der Gleise stieg damit auf 17,130 km und 88 Weichen bei 49 Anschlüssen.
Im Frühjahr 1909 erlitt die Kleinbahn erhebliche Hochwasserschäden.
In den Jahren 1912 - 1915 erhielt die Kleinbahn ihren zweiten Anschluss an die
Staatsbahn in Plettenberg-Oberstadt. Die Plettenberger Straßenbahn-Gesellschaft
hatte bekanntlich im Jahre 1901 dem Ansinnen des Landrates in Altena, die
"Straßenbahn" bis Herscheid zu verlängern, aus wirtschaftlichen Überlegungen
nicht entsprochen. Nun hatte sich die Staatsbahn zu dem Bahnbau von Plettenberg
nach Herscheid entschlossen in der Absicht, diese normalspurige Nebenbahn bis
Lüdenscheid weiterzuführen. Durch den ersten Weltkrieg von 1914 - 1918 und die
ihm folgende Wirtschaftskrise bei der in der gleichen Zeit beginnenden Expansion
des Kraftwagens im Verkehr wurde allerdings der im Jahre 1915 bis Herscheid
durchgeführte Bahnbau in den späteren Jahren nicht mehr bis Lüdenscheid
weitergeführt.
Für ihren an den neuen Staatsbahnhof Plettenberg-Oberstadt vorgesehenen Anschluss
erwarb die Kleinbahn im Jahre 1912 den erforderlichen Grundbesitz für 22.000 Mk.
Sie wendete für diesen neuen Anschluss im Jahre 1913 weitere 17.200 Mk und im
Jahre 1914 wiederum 29.000 Mk auf. Der neue Betriebs- und Anschlussbahnhof in
Plettenberg-Oberstadt wurde mit der Eröffnung der Staatsbahn-Nebenbahn
Plettenberg - Herscheid am 8. Juli 1915 in Betrieb genommen. Durch die
Inbetriebnahme dieser Nebenbahn erlitt der Güterverkehr der Kleinbahn einen
fühlbaren Rückschlag.
Die Kriegsjahre brachten durch eine starke Zunahme der Verkehrsanforderungen
auch eine beträchtliche Verstärkung des Betriebes, die jedoch nach dem
Zusammenbruch im Jahre 1918 bei empfindlichem Verkehrsrückgang und zunehmenden
Betriebsschwierigkeiten durch Personalmangel und Betriebsstoffschwierigkeiten
beendet wurde. Es mussten Betriebseinschränkungen vorgenommen werden. Die
Besetzung des Ruhrgebietes und die zunehmende Inflation im Jahre 1923 führten
bei der Kleinbahn zu einer weiteren Verkehrsminderung und zu einer Steigerung
der Betriebskosten. Vom 10. März ab verkehrte daher der Stückgüterzug nur noch
jeden zweiten Tag. Der Güterdienst wurde vom 1. August 1923 an nur mit einer
Lokomotive durchgeführt, der Personenverkehr am 22. September sogar erheblich
eingeschränkt und ab 8. November ganz eingestellt.
Erst mit der Stetigkeit der im November 1923 eingeführten Goldmarkwährung
besserte sich auch für die Kleinbahn allmählich die wirtschaftliche Lage.
Der Personenverkehr konnte am 1. März 1924 in beschränktem Umfang und bis
zum 30. November 1924 wieder voll aufgenommen werden. Im Jahre 1924 wurden
außerdem neue Schienen sowie 9 Weichen, eine neue Heißdampflokomotive und
10 neue Rollwagen beschafft. Die Kleinbahn war also gleich nach der
Währungsreform bemüht, ihre Rückstände bei der Erneuerung von Betriebsanlagen
und Betriebsmitteln in den letzten Jahren nun wieder aufzuholen. Zugleich
zeigte dieses Beschaffungsprogramm, dass die Kleinbahn aus den Wirren der
letzten Jahre dennoch als wirtschaftlich gesundes Unternehmen hervorgegangen
ist.
Eine Personenwagenhalle aus Wellblech wurde auf dem Bahnhof Plettenberg-Oberstadt
im Jahre 1925 errichtet. Sie wurde erst bei der Betriebsumstellung im Jahre
1961 wieder beseitigt. Die am 30. Dezember 1925 aufgetretenen Hochwasserschäden
verursachten der Kleinbahn einen erheblichen Kostenaufwand zu ihrer Beseitigung.
Im gleichen Jahr wurden für eine Begradigung der Eisenbahnstrecke im Oestertal
20.850 Mk aufgewendet. |
58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de