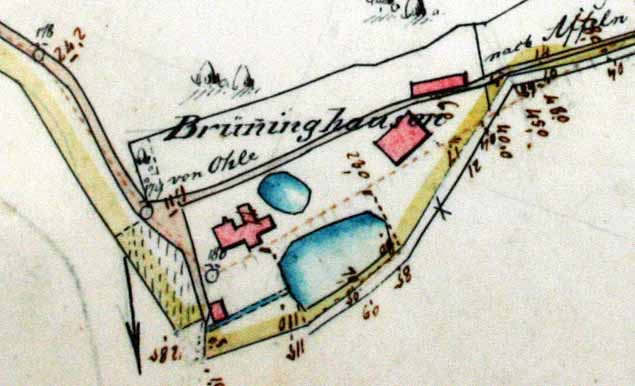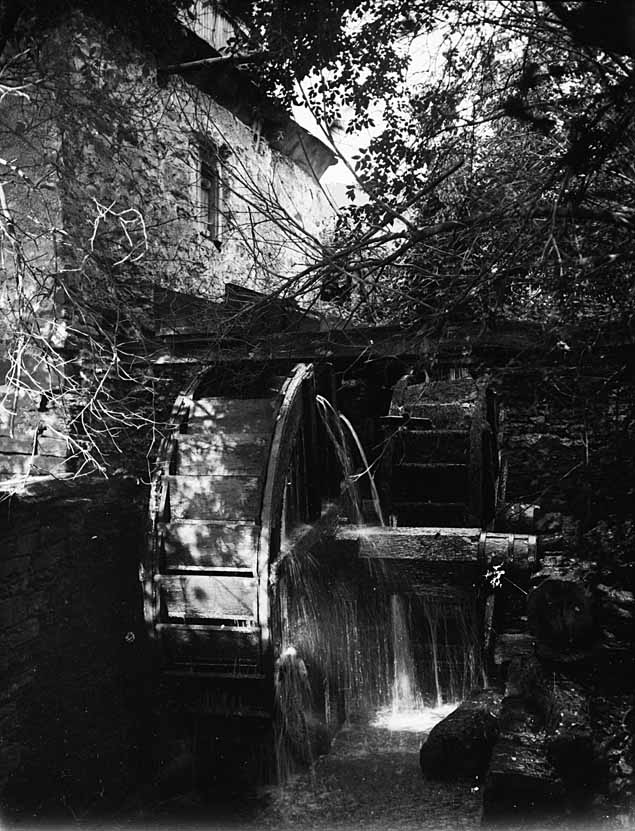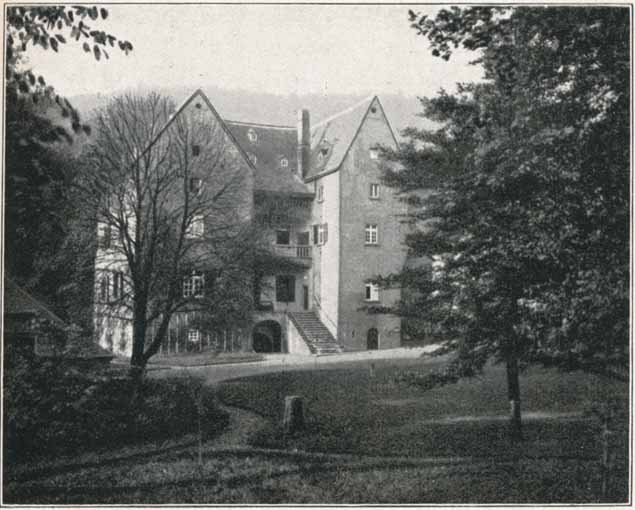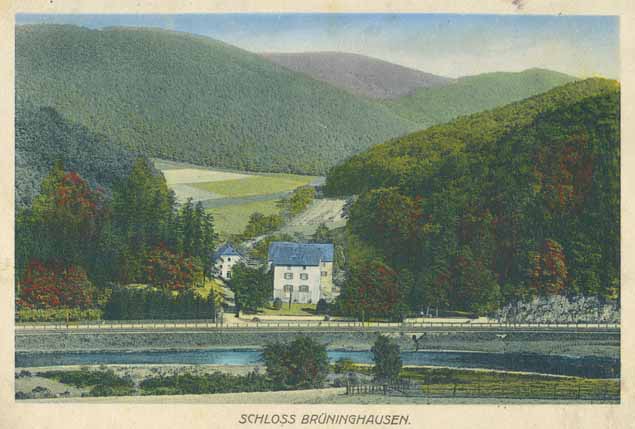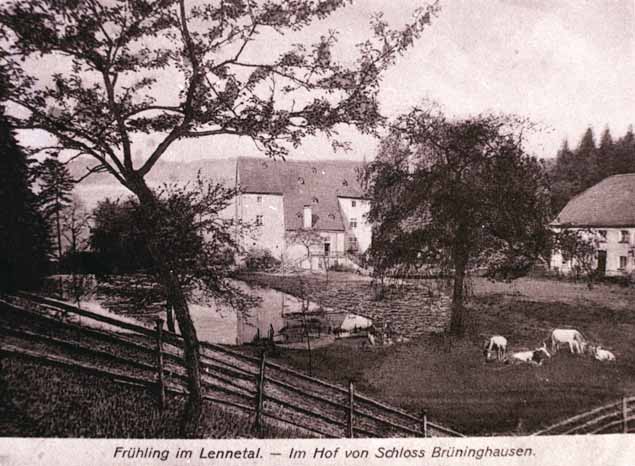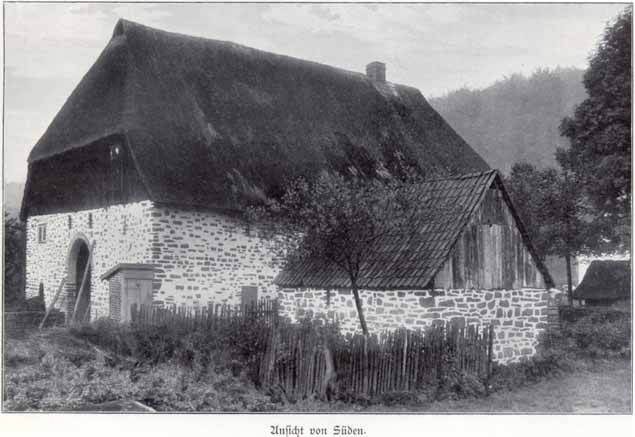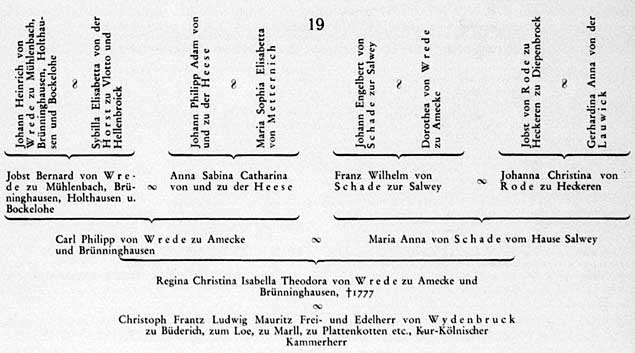WR Plettenberg: Blick hinter 700-jährige Schlosskulisse
Schloß Brüninghausen - einst ein Wasserschloss

Quelle: Kunst- und Geschichtsdenkmäler im Märkischen Kreis,
Heimatbund Märkischer Kreis, 2. verbesserte Auflage 1984, S. 629 ff.
Plettenberg-Brüninghausen
Brüninghausen 1
13.3 Schloß Brüninghausen
Seit Mitte des 14. Jahrhunderts urkundlich nachweisbar, wahrscheinlich
aber schon Jahrhunderte früher, sind die von Ohle (auch Ole, Ol, Oill)
auf zwei adligen Gütern in Brüninghausen, 1 km lenneabwärts, auf dem
sogenannten Mühlengut und dem sogen. Turmgut ansässig. Das Turmgut
nannte sich nach dem mehrfach in Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts
erwähnten Turmhaus, das der älteste Teil eines ursprünglich einheitlichen,
erst durch Erbteilung (1370) in zwei Teile gespaltenen Rittergutes war.
Das Turmhaus erheiratete um 1400 Eberhard von Rüspe, während das Mühlenhaus
vorläufig im Besitz des anderen Zweiges der von Ohle blieb.
In der Folgezeit wechselte das Mühlenhaus mehrfach den Besitzer und wurde
in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts wegen Verschuldung auf dem Marktplatz
zu Schwerte öffentlich versteigert. 1519 erwarb es die Familie von Rüspe.
Die beiden auf diese Weise wieder in einer Hand vereinigten Güter gingen
1622 durch Heirat der Erbtochter von Rüspe an Arnold von der Horst.
1651 wohnten noch zwei erbberechtigte Schwestern von der Horst, Sibylla
Elisabeth und Johanna Maria, auf dem Rittergut. Die erste heiratete Johann
Heinrich von Wrede, die zweite dessen Bruder Ferdinand von Wrede. Damit
gelangte Brüninghausen an die ursprünglich im Balver Lande (Mellen,
Langenholthausen) beheimateten von Wrede, in deren Hand es sich heute noch
befindet.

Jobst Heinrich von Wrede, kaiserlicher Rittmeister und kurkölnischer
Geheimer Rat und Kämmerer, ist als Bauherr des erweiterten Schlosses
bekannt. Von seinem ältesten Sohn Jobst Bernhard von Wrede leitet sich
später die in den Freiherrenstand erhobene Linie Brüninghausen-Amecke
ab.
Das heutige, über hohem Kellersockel dreigeschossige Herrenhaus, eine
aus zwei Seitenflügeln und einem beide verbindenden Mittelteil bestehende
unregelmäßige Baugruppe, läßt schon in der äußeren Erscheinung darauf
schließen, dass es in mehreren Bauphasen entstanden ist. Da das schon
im vorigen Jahrhundert nicht mehr vorhandene sogenannte Mühlenhaus in
der Nähe der in beträchtlichem Abstand südlich des Herrenhauses gelegenen
ehemaligen Wassermühle zu lokalisieren ist, kann der im Herrenhaus
aufgegangene mittelalterliche Rechteckbau, im Folgenden als Kernbau
bezeichnet, nur das im 14. Jahrhundert ersterwähnte sogenannte Turmhaus
sein.
Die Bezeichnung als Turmhaus war bei der Dreigeschossigkeit des über
hohem Kellergeschoss errichteten Giebelhauses durchaus zutreffend; als
charakteristisches Attribut hatte es einen aus dem südwestlichen Giebelschild
vorkragenden Altan, der die Überwachung des Lennetales und in friedlichen
Zeiten den Genuß der reizvollen Flußpartie gestattete. Der mit einem Brunnen
ausgestattete Keller hat ein längsgerichtetes Tonnengewölbe. Der Kaminschacht
war nach Art der Kemenatenkamine in der Mitte der nordöstlichen Giebelwand
ausgespart.
Im Dreißigjährigen Krieg verlor das Turmhaus durch Kanonenbeschuss die
beiden Obergeschosse der Nordosthälfte mit dem halben Dachstuhl. In diesem
desolaten Zustand traf Johann Heinrich von Wrede, seit 1652 Herr auf Haus
Baukloh, wahrscheinlich das Haus an, als er drei Jahre nach dem Großen Krieg
das Gut Brüninghausen übernahm. Offenbar hat er sofort mit der Instandsetzung
und Erweiterung des Turmhauses begonnen. Zunächst dürfte, quer zur Achse des
Turmhauses, der südöstliche Erweiterungstrakt mit der durch einfachen
Richtungswechsel gekennzeichneten Innentreppe entstanden sein - vorher gab
es wahrscheinlich nur Außentreppen - und anschließend auf seiner verlängerten
Achse der nordwestliche Erweiterungstrakt.
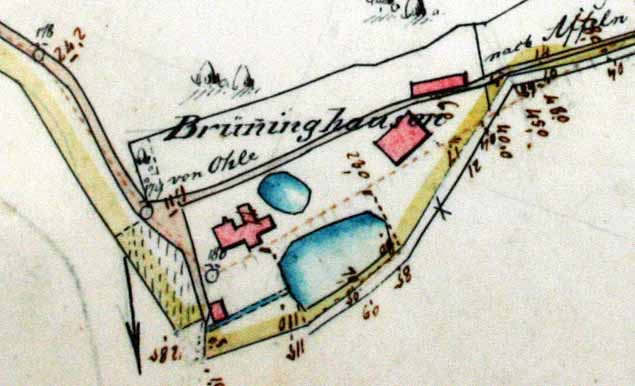
Ausschnitt aus dem Urkataster von 1830. Quelle: Archiv H. Hassel
Durch den Zusammenschluss der beiden Erweiterungsdachzonen zu einer einheitlichen
Dachfläche, die die noch intakte Hälfte des Kernbaus überdeckt, ergab sich
die Gestalt des heutigen Nordflügels, aus dem die reduzierte andere
Kernbauhälfte mit dem Stumpf des Kemenatenkamins wie ein eingeschossiger
Anbau mit Schleppdach vorspringt. Im Dachraum sind der bruchsteinerne
Altangiebelschild des Kernbaus und der Rest seines Dachstuhls mit den alten
Dachsparren nebst zugehörigen Auflagern erhalten.
Als nächste Erweiterung ist der heutige Verbindungstrakt auf der verlängerten
Achse des Kernbaus anzusehen. Die bemerkenswerte Stärke seiner Südwestwand
lässt darauf schließen, dass sie als Abschluss der bisher beschriebenen
Baumaßnahmen gedacht war, deren Gesamtheit wahrscheinlich mit dem in einem
Pachtvertrag von 1658 erwähnten "Neuen Haus" identisch ist.
Zehn Jahre später ist den Mauerankern zufolge der nächste große Bauabschnitt
mit dem breiten lenneseitigen Flügel, parallel zum Nordostflügel, abgeschlossen.
Während die übrigen Bauteile, abgesehen vom Nordwesttrakt des anderen
Seitenflügels, dessen Keller flach gedeckt ist, mit einschiffigen Tonnengewölben
unterkellert sind, hat dieser Seitenflügel im Kellergeschoss ein interessantes
Kreuzgewölbe mit ährenförmig gemauerten Graten, für das eigens Bauleute aus
Köln verpflichtet wurden. An der Lenneseite befand sich ein Abtritterker.
Zwei Abtrittschächte stecken im Außenmauerwerk.
Was die Baustoffe betrifft, war der Bauherr weitgehend unabhängig. Der Stein
wurde in nahegelegenen Grauwackebrüchen gewonnen, der ebenfalls in der Nähe
gebrochene Kalkstein in eigenen Kalköfen gebrannt, für bestes Bauholz standen
die eigenen Forsten zur Verfügung.

Das "eiserne Kellerken". Foto: Martin Zimmer, März 2002
Das Haus stand in einem vom Brüninghauser Bach gespeisten Hausteich, dessen
Wasserlinie offenbar erheblich unter dem Niveau des Kellers lag. Bei der
Trockenlegung bald nach der Wende zum 19. Jahrhundert ist der Boden im
Umfeld des Hauses so beträchtlich angehoben worden, dass südlich der heutigen
Zufahrt von der Lenneseite noch die Gewölbe einer Steinbrücke unverrückt
im Boden liegen. Daher hat man sich das Haus ursprünglich noch um einige
Meter höher vorzustellen.
Heute führt eine einläufige Freitreppe an der Schauseite in den Mitteltrakt,
der sich in galerieartig gestaffelten barockisierten Balkons mit Zugängen
in den Seitenflügeln öffnet. An ihrer Stelle befand sich ursprünglich
wahrscheinlich eine Zugbrücke auf der Ebene des Erdgeschosses. Das
Außenmauerwerk ist allseitig verputzt. Die mit Schleppgauben ausgebauten
steilen Satteldächer, das Schleppdach des Kernbaus und die Schornsteinköpfe
sind verschiefert. Der gebogene Rücksprung an der Schauseite lässt auf eine
frühere Torfahrt schließen.
Über das Hausinnere berichtet 1842 Rötelmann: "Es gibt über 40 einzelne,
zum Teil sehr ausgedehnte Räume und Gemächer, im Erdgeschoss 8, dem ersten
Stock 11, dem zweiten 10, dem dritten 5 und einen Kornboden, zu dem eine
Treppe von 86 Stufen führt. Mit Tapeten sind nur die Zimmer der unteren
Etage verkleidet, dabei auch zum Teil mit prachtvollen Möbeln geschmückt".

Kartenausschnitt einer Karte aus dem Jahre 1778
Außer durch den Hausteich war das Hauptschloss durch eine Ringmauer gesichert.
Im vorerwähnten Pachtvertrag von 1658 verpachtet Johann Heinrich von Wrede an
den "Schulte" genannten Pächter Möllenbeck sein Gut mit allen "aus [= außerhalb]
der rinckmauer", d. h. auf der Vorburg gelegenen Gebäuden, von denen das Bauhaus
- wohl an der Stelle des 1830 als Viehhaus zweigeschossig errichteten heutigen
Wirtschaftsgebäudes nördlich des Herrenhauses - besonders hervorgehoben wird.
Zu den Vorrechten der adligen Besitzer gehörte, wie überall, auch hier das
Mühlenregal, auf Grund dessen die Bauern eines bestimmten Einzugsgebietes
gezwungen waren, ihr Brotgetreide in Brüninghausen mahlen zu lassen. Die mit
zwei Wasserrädern ausgestattete Mühle hat sich bis in die Nachkriegszeit in
ihrem alten Zustand erhalten. Das zu Wohnzwecken umgestaltete Mühlengebäude
erhielt über dem überkommenen massiven Erdgeschoss ein Fachwerkobergeschoss
unter schiefergedecktem Walmdach.
Das nach der Mühle benannte mittelalterliche Mühlenhaus stand nach Rötelmanns
Beschreibung zwischen der Mühle und dem noch vorhandenen großen Teich und war
"mit dem Turmhaus durch einen Bogen verbunden".
Am Ostrand der Gesamtanlage steht eine erhaltenswerte, mit Fruchtgehängen
dekorierte Gloriette auf barocken Holzsäulen.
Quellen: Rötelmann, W.: Historisch-geographische Geschichte der Gemeinde
Ohle. 1842; Frommann, P. D.: Aus der Geschichte der Gemeinden Plettenberg,
Ohle und Herscheid. Lüdenscheid 1927; Dösseler, E.: Die adlige Grundherrschaft
Brüninghausen im Kirchspiel Ohle und ihre Inhaber. In: Der Märker 1961/1;
Derselbe: Verpachtung des adligen Gutes Brüninghausen 1658. In: Süderländer
Geschichtsquellen, 2. Teil. Werdohl 1954.
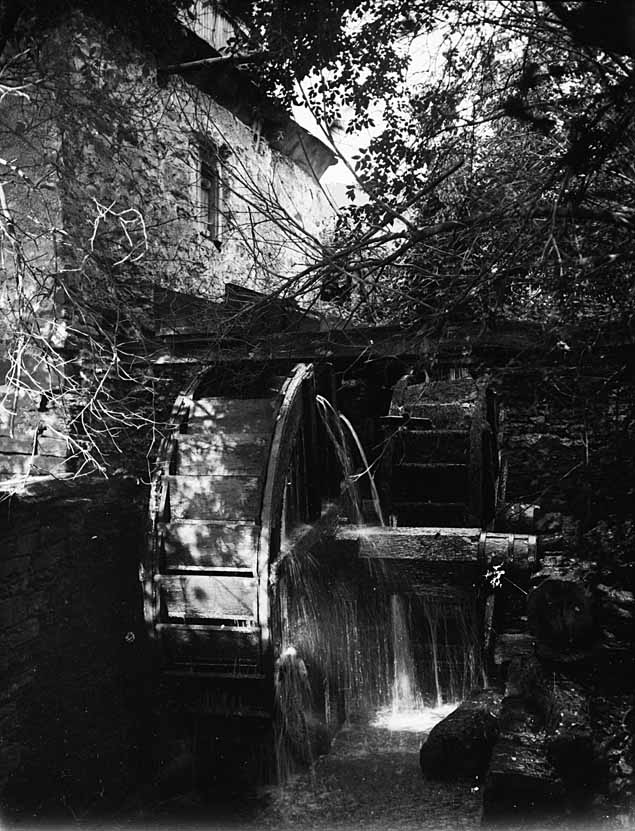
Das Doppelwasserrad der Mühle am Schloss Brüninghausen. Foto: Archiv H. Hassel
1794: Planung für eine neue Straße rechts der Lenne

Haus "Brunninghausen" mit "Muehle" und "Bauers Gut?". Quelle ist die
"Geometrische Carte von der Situation zwischen Neuenrade und Plettenberg
längst den Lehn Fluß in der Grafschaft Marck Renthey Altena zum behufe
eines daselbst anzulegenden neuen Weges gefertigt von Risse Landbaumeisterei
in der Grafschaft Mark d. 13. Aug. 1794". Der alte Weg querte die Lenne
in Höhe Elhausen, führte dann über Teindeln weiter nach Bockeloh. Für die neue Straße (braune
Trasse) rechts der Lenne war hinter Brüninghausen wohl ein dort vermutetes Bauerngut im
Weg, außerdem musste bis Teindeln reichlich Fels weggesprengt werden. Mit dem
Bau der Eisenbahn Hagen-Siegen 1861 wurde das bis dahin kurvige Lennebett vor dem
Schloss Brüninghausen begradigt.
Quelle: "Burgen, Schlösser, Herrensitze im Märkischen Kreis",
Heft zur gleichnamigen Ausstellung aus Anlass der Einweihung des neuen
Kreishauses in Lüdenscheid im März 1986 mit 23 ausgewählten Objekten,
bearbeitet von Dr. August Kracht.
Schloß Brüninghausen / Plettenberg-Brüninghausen, Brüninghausen I

Ehemalige Wasserburg an der Lennestraße zwischen Ohle und Teindeln
auf dem rechten Lenneufer. Ersterwähnung Mitte des 14. Jhdt., aber
wahrscheinlich wesentlich älter. Durch Erbteilung seit 1370 zwei
Häuser, Turmhaus und Mühlenhaus.
Anstelle des ersteren ein dreigeschossiges verputztes Herrenhaus. Aus
zwei Seitenflügeln und einem verbindenden Mittelteil bestehende unregelmäßige,
in mehreren Bauphasen entstandene Baugruppe. Ältester Bauteil das integrierte
mittelalterliche Turmhaus im Nordostflügel, der in zwei Bauabschnitten
quer zum Turmhaus entstand. 1658 Erweiterung durch den Mitteltrakt.
Letzte Erweiterung, den Mauerankern zufolge 1668, durch den lenneseitigen
Flügel parallel zum nordöstlichen Seitenflügel. Bis Anfang des 19. Jhdt.
allseitig von Hausteich und Ringmauer umgeben. Anstelle der früheren
Zugbrücke einläufige Freitreppe im Mitteltrakt. Im Keller Tonnengewölbe
und originelles Kreuzgewölbe mit ährenförmig gemauerten Graten.
Auf der ehemaligen Vorburg zweigeschossiges Wirtschaftsgebäude, ferner
ehemaliges Mühlengebäude mit Fachwerkobergeschoß und Walmdach und Rest
vom ehemaligen Mühlteich erhalten. Gloriette mit barocken Holzsäulen.
Besitzerfolge: von Ohle, von Rüspe, von der Horst, von Wrede (seit Mitte
des 17. Jh.). Das Herrenhaus ist von Mietern bewohnt. Die Eigentümerfamilie
(Freiherr von Wrede) bewohnt einen Neubau am Rande der Gesamtanlage.
Außenbesichtigung von der Straße.
Quelle: "Stadt und Amt Plettenberg - ein Führer", herausgegeben
vom SGV Plettenberg, 1914, S. 53 u. 54
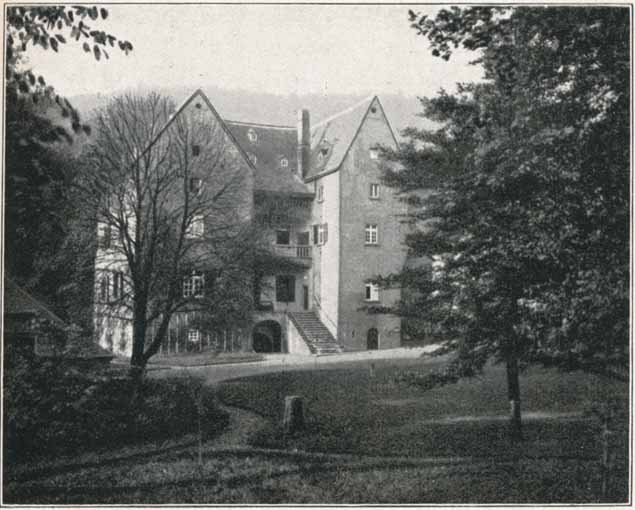
. . . Links sehen wir an der Lenne im Seitental der Jeutmecke Elhausen
liegen, dann fesselt zur Rechten das alte Schloß Brüninghausen, das nun
schon über 250 Jahre Eigentum der Familie von Wrede ist, unsere Aufmerksamkeit. . .
Quelle: "Historie der Stadt und des Amtes Plettenberg und des
Kirchspiels Ohle", aus dem II. Teil der "Westphälische Geschichte" von
Johann D. von Steinen (1755-1760); Neudruck Martin Zimmer 1979
2. Absatz.
Von denen zum Kirchspiel gehörigen Rittersitzen, adlichen Häusern
und zerstörten Schlössern
I. Brüninghausen
Ein Rittersitz, eine viertel Stunde vom Kirchdorf Ohle, an der Lenne
zwischen den Bergen gelegen, ist ein Churcölnisch Lehn, und hat
anfänglich denen v. Brüninghauß gehöret.
Nachhero sind die Güter getheilet und zwey Häuser gebauet worden,
davon eines das Thurnhaus, das andere das Mühlenhaus zu Brüninghausen
genennet worden sind. Diese Güter sind hernach gekommen an die v.
Ole und v. Rüspe(*. Hernach ist der Olen Antheil an verschiedene
Erben kommen, welche ihre Ansprache an v. Wesselberg verkauften.
Aleke Wesselberges vermachte 1426 das Mühlengut zu Brüninghausen
an Diederich Sprenge. Von diesem erbten Aloff Qwoyde und seine
Gemahlin Adelheid, die es 1431 an Johan v. Kobbenroyde verkauft
haben. Nach der Zeit haben die v. Rump zur Wenne das Mühlenhaus
zu Brüninghausen gehabt; als aber 1515 Johan v. Rump dasselbe an
Gert v. Rüspe und seine Gemahlin Catrin v. Eppe verkaufte, sind
die Güter wieder zusammen an die v. Rüspe gekommen, da dann auch
ein Haus wieder weggebrochen worden ist.
Anna Margreta v. Rüspe brachte diese Güter durch Heyrath an Arnold
v. der Horst zu Hellenbrock. Dieser ihre Tochter, Sibilla Elisabet
v. der Horst, wurde vermählt mit Johan Henrich Wrede zu Ameke, der
die Güter durch Kauf 1652 an sich gebracht hat.
Unweit dem Hause lieget eine Mühle zum Hause gehörig, die wegen
der dazu gehörigen Mahlgenossen einen jährlichen Canon an den
Landesherrn zahlen mus.
* Berswordt gedenket aufs Jahr 1622 einer Familie von Rysbeck und
schreibt, sie habe zu Brüninghausen an der Lenne ihr Haus gehabt,
allein es mus an statt Rysbeck Ruispe stehen, wie unten angezeigt wird.
Über die Familien von Ole heißt es bei von Steinen u. a.:
1370 Johan v. Ole, Herr zu Brüninghausen
1375 Wilkin v. Oel gen. von Brüninchuß (Archiv Ruhr)
*Es ist bekannt, daß eine Ritterfamilie v. Brüninghuß gewesen ist,
welche 5 Muscheln geführet hat. Da nun diese v. Ole eine Muschel
führen, so wäre die Frage, ob sie nicht ihrem Ursprunge nach von
denen von Brüninghauß abstammen, und als sie das Haus Ohl bekommen,
davon den Namen angenommen, ihr Wapen geändert, und nur eine
Muschel in demselben behalten haben. Dieser Wilkin v. Oel gen.
v. Brüninghauß, bringt mich auf den Gedanken.
1389 Johan v. Ole vermachet seiner Gemahlin Elske das halbe Gut
zu Brüninghausen zur Leibzucht, und im Jahre 1400 vermacht er
an Aleke Wesselberges das Mühlengut daselbst. Johan v. Ole hatte
zwei Schwestern, eine war vermählet mit N. v. Rüspe, die andere
mit N. v. Hennen.

Schloss Brüninghausen 1887
Quelle: Dr. Heinrich Heppe "Geschichte der Evang. Gemeinden der
Grafschaft Mark, Iserlohn, 1870
Drei Kühe für das Haupt des Hl. Cornelii
. . . Die Einführung der Reformation erfolgte allmählich in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Genaueres lässt sich nicht angeben. Man
hatte hier das wunderthätige Haupt Cornelii, welches einer allgemein
geglaubten Sage zufolge von zwei Engeln durch die Luft von Mailand her
dorthin getragen war. Zur Zeit des zweiten Pastors Hengstenberg (†1727) wurde
es aus der Kirche gestohlen, nachdem kurz vorher die Kurkölner für
dasselbe 200 Rthl. geboten hatten. Hengstenberg hatte das Gebot
zurückgewiesen, weil er der Verbreitung des Aberglaubens keinen Vorschub
leisten wollte - wiewohl ihm der katholische Besitzer des Hauses
Brüninghausen für den Fall der Annahme des Gebots die drei besten Kühe
seines Stalles zugesichert hatte. . .
Quelle: Süderländer Tageblatt vom 03.12.1949 im Ev. Kirchenarchiv Ohle, Sign. 3.3
Ein alter heimischer Adelssitz
Haus Brüninghausen und seine Vergangenheit
Plettenberg-Ohle. In einer Waldschlucht vor Ohle, die sich zum
Flußtal der Lenne und zur dort vorbeiführenden Talstraße hin stark
verengt, liegt Haus und Gut Brüninghausen. Dieses herrschaftliche
Wohnhaus, wie man das stattliche Bauwerk wohl am treffendsten bezeichnet,
dienste lange Zeit hindurch der
Ritterfamilie von Ohle
zum Wohnsitz. Dieses Geschlecht war nach den Überlieferungen wohl schon
im 12. Jahrhundert in einer Burg ansässig, die höchstwahrscheinlich
dort gelegen war, wo auch die alte Kirche stand - auf dem heutigen Kirchplatz.
Die Bewohner des Ortes Ohle waren diesem Geschlecht abgabepflichtig
schon in einer Zeit, als z. B. in Plettenberg die Bauern und Bürger
noch frei waren.
Das Geschlecht von Ohle geht vielleicht auf die Zeit der fränkischen
Eroberung zurück. Die Tatsache der frühen Abgabepflichtigkeit der
Ortsbewohner an diese Familie, die den fränkischen Curtis (Hof, Burg)
verwaltete, dürfte darauf hindeuten. Dieses Geschlecht besaß auch Höfe
in Plettenberg, Windhausen, Dahle und im oberen Sauerland und war mit
dem Geschlecht von Plettenberg stark versippt.
Der Kölner Erzbischof gab 1401 (nach Seibertz) den Oberhof Oyl in
der parochia Oyle an den Ritter Evernard de Ruyspe. An diese Familie
von Rüspe kam durch Heirat auch ein Teil von Brüninghausen und zwar
das sogenannte "Turmhaus",
eben das alte herrschaftliche Landhaus. Das Mühlenhaus jedoch, der
zugehörige Wirtschaftshof nebst dem Dorf Ohle und vielen sonstigen
Höfen kamen nach und nach an Dietrich von Weselberg. 1519 erwarb auch
diesen größeren Anteil vom alten Besitz Brüninghausen Gerd von Rüspe,
so dass diese Familie jetzt über den ganzen Besitz verfügte. Die
Familie von Ole verzog aus der Gegend. In der Mitte des 17. Jahrhunderts
wurde die Familie des Freiherrn von Wrede Eigentümer des Gutes.
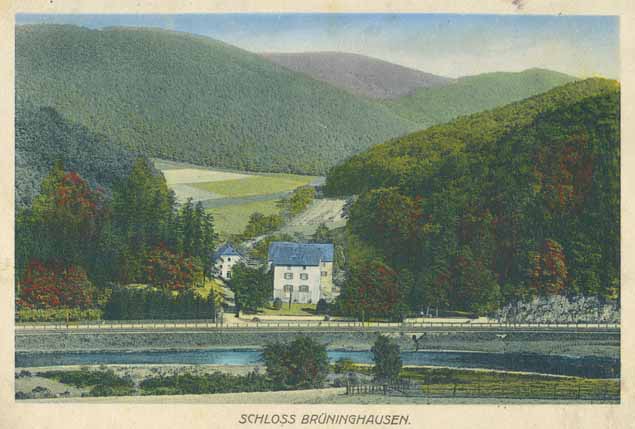
Foto: Ev. Kirchenarchiv Ohle, Sign. S/F 9
Diesem adligen Geschlecht stand die niedere Gerichtsbarkeit über die
meisten Einwohner des Dorfes Ohle zu. Dazu war der jeweilige Herr
auch Patron der Ohler Kirche. Als solcher stand ihm das Recht zu -
es erhielt sich bis in 19. Jahrhundert - die Ohler Pfarrstelle zu
besetzen, während er andrerseits verpflichtet war, zur Erhaltung der
Kirche und Schule beizutragen. Da das Geschlecht von Wrede in der
Reformation katholisch blieb - der wirtschaftliche Schwerpunkt seiner
Güter hatte sich ins kölnische Sauerland verlagert - entstand der
seltsame Zustand, dass
eine katholische Adelsfamilie das Patronatsrecht für die evangelische
Ohler Kirche innehatte
und noch jahrhundertelang ausübte. Das steht aber nicht vereinzelt da;
es liegt auf der Hand, dass sich daraus wiederholt merkwürdige
Situationen entwickelten. Ein Bernhard Friedrich von Wrede machte
Brüninghausen 1713 zu einem Fideikommiß, das stets ungeteilt auf den
ältesten Sohn übergehen sollte. Diese Form des Eigentums hat sich
bis in jüngere Zeit erhalten, während in letzter Zeit eine Teilung
des Gutes auf die Kinder vorgenommen wurde. Hauptsitz der Familie
war später Amecke auf den Bergen in unserer nächsten Nachbarschaft
im kölnischen Sauerlande.
Das "Schloß" Brüninghausen hat im langen Zeitablaufe der Jahrhunderte
allerhand erlebt. Im Winter des Jahres 1608 beispielweise wurde
das Schloß von Straßenräubern überfallen,
die reiche Beute machten. Im 30-jährigen Krieg haben verschiedene
Kriegsvölker dort böse Spuren hinterlassen. In unserer Zeit ist das
alte "Turmhaus", so wohl genannt wegen seiner mächtigen 4 Stock hohen
turmartigen Flügel, die dem ganzen Gebäude einen kastellartigen
Charakter verleihen und sein Aussehen bestimmen, zur Bewohnung wegen
seiner überhohen Räume in unglaublich dicken Mauern nicht mehr recht
geeignet. Es fand daher auch längere Zeit Verwendung als Verwaltungsgebäude
der Ferngas AG und kommt u. U. in Zukunft als
Ferienheim und Landheim
für ausländische und deutsche Studenten in Frage. So würde dann dieser
alte Bau, der so mannigfache geschichtliche und einzelmenschliche
Ereignisse erlebte, vielleicht in unseren Tagen dem Ziele der Verständigung
zwischen den Völkern dienstbar gemacht werden.
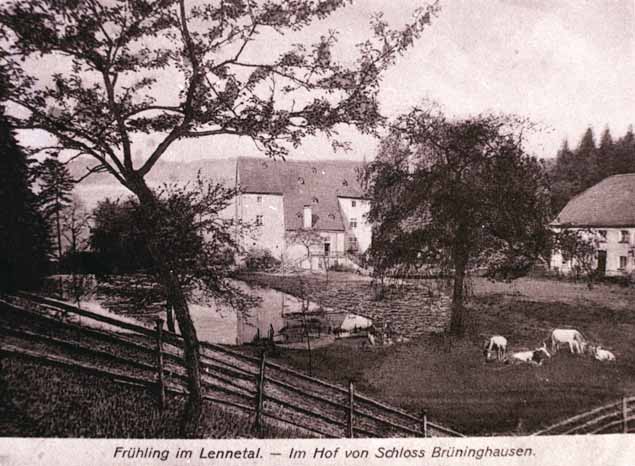
Plettenberg, 17. Dezember 1949 (WP)
Altes Schloß mit neuem Gesicht
Ohle. Die Verwendung des alten Schlosses Brüninghausen,
das seit den Kriegsjahren die Verwaltung der Ferngas AG beherbergte,
dürfte nunmehr klargestellt sein. Der zeitweise verfolgte Gedanke,
hier ein Studenten-Heim zu errichten, wurde fallen gelassen. Das
Ohler Eisenwerk hat daraufhin das Gebäude langfristig angepachtet,
um dort Wohnungen für Werksangehörige einzurichten. Örtlich gesehen
ist es sehr zu begrüßen, wenn hier also in dem alten schicksalumsponnenen
"Turmhaus", wie es früher genannt wurde, Wohnungen eingerichtet
werden. Es sollen 7 Zwei- und Dreizimmerwohnungen eingerichtet werden,
die auch schon im kommenden Februar bereitstehen werden. So wird
also neues Leben in diesen alten Herrensitz einziehen.
Quelle: Süderländer Tageblatt vom 11.05.1950 im Ev. Kirchenarchiv Ohle
Schloß Brüninghausen wird Mehrfamilienhaus
Arbeiterwohnungen im alten Schloß - Umfangreiche Umbauten erforderlich

Foto: Willy Kaspers jr.
Plettenberg-Ohle. Nach längeren, zeitweise unterbrochenen
Verhandlungen ist es dem Ohler Eisenwerk gelungen, mit dem Eigentümer
von Schloss Brüninghausen, Frhr. v. Wrede, zu Vereinbarungen wegen
der Anpachtung und des Ausbaues des alten Schloßgebäudes in Brüninghausen
zu kommen.
Das Eisenwerk wird das Gebäude, das nach Wegzug der Verwaltung der
Ferngas bekanntlich seit einige Zeit leerstand, zum Wohngebäude
herrichten. Es werden zunächst 7 Wohnungen für Arbeiter des Eisenwerkes
eingerichtet und zwar 4 Dreizimmerwohnungen und 3 Zweizimmerwohnungen.
Dabei wird es notwendig sein, das ja für einen solchen Zweck nicht
eingerichtete Bauwerk von Grund auf, vom Keller bis zum Boden, für
seinen neuen Wohnzweck herzurichten.
Wie wir hören, werden die notwendigen Arbeiten sofort ausgeschrieben,
so dass in absehbarer Zeit erfreulicherweise wieder 7 Wohnungen zur
Verfügung stehen werden. Dieser Beitrag zur Behebung der Wohnungsnot,
den das Eisenwerk auch in diesem Falle durch seine Initiative und seinen
Einsatz leistet, dürfte allgemein begrüßt werden.
Quelle: Süderländer Tageblatt von 1952 im Ev. Kirchenarchiv Ohle, Sign. 3.3
Alter Rittersitz im Wandel der Zeiten
Schloß Brüninghausen einst und jetzt - Umbau des 300-jährigen Gebäudes
Plettenberg-Ohle. Eine gute Vorstellung von der Einfachheit alter
Burghäuser kann der alte Rittersitz Brüninghausen vermitteln. Bis 1812
gehörten solche Güter in Ohle, Teindeln, Hilfringhausen, Elhausen und
Jeutmecke zu diesem im Besitz der Familie von Wrede befindlichen Rittersitz
und waren verpflichtet, ihre Getreide in der Fruchtmühle Brüninghausen
mahlen zu lassen.
Während der letzten Kriegs- und Nachkriegsjahre fand die Westfälische
Ferngas ihr Unterkommen in Schloß Brüninghausen. Jetzt ist das Schloß
Brüninghausen an das Ohler Eisenwerk vermietet. Nach einem großzügigen
und zum Teil schwierigen Umbau wurden hier 5 Drei-Zimmerwohnungen und
2 Zwei-Zimmerwohnungen geschaffen, die neuzeitlich eingerichtet und
mit Zentralheizung, WC und teilweise mit Bad ausgestattet wurden. Auch
musste ein neuer Brunnen gegraben werden.
Seit etwa einem Jahr haben in diesem ehrwürdigen Gebäude, dessen äußerer
Teil natürlich erhalten geblieben ist, 7 Betriebsangehörige des Ohler
Eisenwerkes mit ihren Familien Wohnungen erhalten, die allen modernen
Ansprüchen genügen.

Schloss Brüninghausen. Foto: Albrecht v. Schwartzen, September 1959
Quelle: "Plettenberg - Industriestadt im märkischen Sauerland",
1962, Albrecht von Schwartzen, S. 62 u. 63
" . . . Nach dem Verfall der Burg Ohle verlegten die Ohler Ritter ihren Wohnsitz nordwestlich des Dorfes, nach Brüninghausen. Sie blieben Obereigentümer an sämtlichen Ohler Höfen, waren weiterhin Richter über das Dorf und den Nachbarhöfen und hatten das Patronat der Ohler Kirche. Ihre Rechtsnachfolger nutzten alle Rechte der Herren von Ohle bis ins vorige Jahrhundert hinein.
Das Haus Brüninghausen war Kurkölnisches Lehen und Stammhaus des Geschlechts von Brüninghausen. Schon früh waren die Besitzungen geteilt. Zwei Burghäuser waren vorhanden, das Turmgut und das Mühlengut. Das Letztere besaßen die Herren von Ohle, das Turmhaus kam an die Familie von Rüspe. Das Mühlengut kam 1400 an die Familie von Wesselberg, 1426 an Diederich Sprenge, 1431 an die von Kobbenroyde und später an die von Rump. Schließlich kam es an die Besitzer des Turmgutes. Damit war ganz Brüninghausen wieder in einer Hand.
Das eine der Burghäuser wurde abgebrochen. Im Erbgang kam später Haus Brüninghausen mit sämtlichen Pertinenzstücken an die Familie von Wrede, in deren Besitz es noch heute ist.
Von 1944 bis 1949 war Haus Brüninghausen Sitz der Verwaltung der Westfälischen Ferngas AG, deren Gebäude bei einem Luftangriff auf Dortmund vernichtet worden war. Seit einigen Jahren ist es an das Ohler Eisenwerk verpachtet, das durch geschickten Umbau eine Anzahl Wohnungen für seine Werksangehörigen darin errichtete.
Quelle: Staatsarchiv Münster, Bestand Herzogtum Westfalen,
Lehen/Urkunden, Or.-Nr. 411
1532 Januar 16 - Poppelsdorf
Johann von Eppe reversiert als Vormund der Kinder des † Gerhardt von
Ruspe [dem] Erzbischof Hermann von Köln den Empfang der im inserierten Lehnsbrief
gen. Lehen:
Erzbischof Hermann von Köln bekundet, das Haus Brünninghausen (Bruninghusen)
sei früher ein Afterlehen [als Afterlehen bezeichnet man im Mittelalter ein
Lehen, das der Lehnsgeber selbst von einem höher gestellten Lehnsherren empfangen
hat] der von Ruedenberg gewesen. Später sei die Lehnsherrschaft an den
Erzbischof heimgefallen. Daher habe er den Gerhardt von Ruspe mit dem Haus
belehnt. Nach seinem [dessen] Tode belehnt er nun den Johann von Eppe als Vormund von
des Johann von Ruspe, des Sohn des Gerhardt, mit dem Haus, mit der zum Hofe
gehörenden Fischerei und mit allem Gut, das früher Hermann und Wilcken von
Brünninghausen (Bruininghusen) und danach Johann von Oill von den † Brüdern
Conrad und Heinrich von Ruedenberg zu Lehen hatten und das auch Gerhardt von
Ruspe schon besessen hatte. Ausgenommen bleibt die Freigrafschaft zu Hundem
(Hundene). Wenn Johann von Ruspe mündig wird, hat er das Lehen selbst in Empfang
zu nehmen. Der Erzbischof empfängt für das Mannlehen Huldigung und Eid und kündigt
sein Siegel an. Zeugen: Bartholomeus von der Leyhen, Hofmeister, Dietherisch
von Orsbeck und Friderich von Fisschenich, Türwärter.
Lehnseid und Siegelankündigung des Ausstellers. Ausfertigung Pergament deutsch,
Siegel ab.
Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, Bd. 1,
E. Dösseler, 1954, hier: S. 12, 2. Quellen
1423, Febr. 4 Nr. 1
Märkisch-bergisches Bündnis gegen die Lennejunker und Plan einer
gemeinsamen Verwaltung des Amtes Schwarzenberg
Herzog Adolf v. Berg verbündet sich mit Gerhard v. d. Mark gegen
Gerhards Untersassen, nämlich Vyllekoy, die van Bruynynchusen,
van Rusope, van Plettenbracht, gen. van der Moelen, und van
Wyntersoyl u. a., die ohne Fehdeansage Feinde des Herzog Adolf
wurden, seine Lande und Leute täglich schädigten und damit dem
Bündnis ihres Landesherren mit Herzog Adolf zuwider handelten.
Deswegen wollen diese beiden mit ihren Freunden und ihrer Macht
zu Plettenberg in das Dorf einziehen, sich dar lagern, um Gerhards
Haus van der Moelen, Haus Brüninghausen und die anderen Häuser
in der Umgebung auf der Lenne gelegen, zu unterwerfen, einzunehmen
und zu gewinnen und darauf auch das Schloß Schwarzenberg zu belagern.
. . . Die genante Belagerung solle am Freitagmorgen des St. Gregoriustages
(März 12) beginnen, indem beide Parteien mit ihren Freunden und Büchsen
zu Plettenberg einziehen sollen. Wurde aber dieser Ritt durch Wasser,
Wetter oder andere merkliche Not verhindert, so soll die Frist für
den Beginn dieser Verlagerung um 3 Wochen verlängert werden. - D.:
Köln, 1423, des donresdages na unsser liever frauwen dage purificationis.
StAD, Kl Mk Urk. 1280
Quelle: Staatsarchiv Münster, Bestand Herzogtum Westfalen,
Lehen/Urkunden, Or.-Nr. 426
1539 Oktober 3 - Arnsberg
Johan von Ruspe reversiert Erzbischof Hermann von Köln in inseriertem
Lehnbrief gen. Lehen:
Erzbischof Hermann von Köln belehnt Johan von Ruspe mit dem Haus
Brüninghausen (Bruningkhuysen) samt Zubehör, insbesondere der Fischerei,
das von den Herren von Rodenbergh zu Afterlehen gegangen und jetzt
heimgefallen ist, wie einst Hermann und Wilcken von Brünninghausen
damit früher und Johan von Oill danach von den † Conrat und Heinrich,
Gebrüdern von Rodenberge belehnt waren; ausgenommen ist die Freigrafschaft
zu Hundem (Hundene). Dieses Lehen habe schon Gerhart von Ruspe, der
† Vater Johans, inne.
Siegelankündigung des Erzbischofs. Zeugen: Johan Quade (Qwade), Landdrost
zu Arnsberg; Terme von Hoerde; Johan von Wachtendunck, Türwärter.
Johan leistet den Lehnseid. Auf Bitten des Ausstellers, der selbst
kein Siegel hat, siegelt sein Vetter Hermann Rump.
Ausfertigung Pergament deutsch, Siegel ab.

1551/1552, Nr. 17 - Grenzstreitsachen, hier 17. Dez. 1543 (transkribiert: H. Hassel)
Es kommt zu einem Prozeß vor dem Reichskammergericht: Kurfürst Adolf zu
Köln klagt gegen den Herzog Wilhelm zu Kleve, stellvertretend für den Amtmann
Bernhard von Neuenhoff (Altena) und Amtmann Wilhelm von Neuhoff (Neuenrade).
Es geht um die Gefangennahme des Affelner Bürgermeisters Gerhard Helwigk durch
den Amtmann zu Altena. Der Hintergrund: Affelner sollen im Oktober 1649 die
Schweinehirten des Hauses Brüninghausen überfallen haben. Es handelte sich um
drei arme unschuldige Kinder (Jungen), die die Schweine des v. Ruspe auf dessen
Gelände gehütet hatten. Einer der Jungen wurde durch "Zersplitterung des Hauptes"
ermordet, der zweite tödlich verwundet, lediglich der dritte Junge konnte vor
den Affelnern fliehen.
1500-1700 Einnahmeregister und Rechnungen des Hauses Brüninghausen -
Frh. v. Wredesche Archiv Amecke, Akten I B 108
1500-1700 Akte betr. Kirche und Schule zu Ohle, darin u. a.:
Schreiben des Drosten von Neuenrade, Volmert van dem Nyen Hofe an Herman
van Ruispe, Pfarrer und Kirchmeister zu Ohle betr. Aufsuchung Kelch und
Monstranz 1543, VII 1; Herman von Ruispe zu Brüninghausen vergibt den
Altar St. Servatii binnen dem Dorf Ohle nach dem Tode von dessen letztem
Besitzer, Herrn Johan Neysen, an Johan, des Kosters Sohn binnen Ohle, 1555,
i. 31.
Verkauf der Kirchenhagen zu Elhausen an von Wrede, 1780
Johan Wrede, kurfürstlicher Statthalter der Veste Limburg, begabt Henrich
Fischer mit dem Küsteramte des weltlichen Stiftes Elsey, 1592, IV 2.
1509-1899 Akte betreffend die Jagd zu Brüninghausen; enthält u. a.
Jagdgerechtigkeiten, Jagdstreitigkeiten mit Nachbarn und Unberechtigten,
Jagdfrevel, Jagdverpachtungen.
Quelle: Archiv von Wrede-Amecke, Akten I B, Nr. 2. Entwurf
Freilassung zu Teindeln
ohne Datum, ca. 1638-1648, Nr. 295
Anna Margarete, geb. von Ruispe, Witwe von der Horst, "eigenthumbsfrauwe
zu Brunickhausen", bekundet mit diesem "freibrieff", dass die den erbaren
und bescheidenen Friedrich Schmitz von Teindell im Kirchspiel Oill, der
ihr und ihren Erben "mit liebeigenthombs servituit und gerechtigkeit
zugehorig", von solcher "servituit und gerechtigkeit freigelaßen" habe.
Haus Brüninghausen als kurkölnisches Lehen
Laufzeit: 1642-1785, Nr. 18 (Süderländische Geschichtsquellen Band IV, 1967)
1642, Mai 10: Verzeichnis der Erststiftkölnischen Lehnleute: Witwe
des (Arnold) v. d. Horst (-Hellenbroich), Amtmann zu Vlotho, wegen des
Hauses Brüninghausen und des Anteils des Creutnerischen Lehens zu
Zeltingen/Mosel. Lieferung von 2 Lehnspferden.
1652, Febr. 19: Arnold Christoph v. der Horst, dessen Gebrüder
und ihre männlichen Leibeserben belehnt mit dem Haus Brunninghaußen
und der zum Hof gehörigen Fischerei, wie dem Gute zu Rindel (Teindeln),
wie diese Lehen ihr (†)Vater Arnold v. der Horst vom Erzstift Köln,
als Lehen empfing. (StAD., Kurköln, Leh., Gen. 4, S. 46 - Vgl. Archiv
v. Wrede-Amecke, Urk. Nr. 366 v. gleichen Datum)
1652, März 20: Joh. Heinr. v. Wrede zu Melschede nach vorausgegangener
Refutation des Arnold Christoph v. der Horst belehnt mit dem mit Konsens
des Kurfürsten Max Heinr. von Köln erkauften Haus Brunninghausen, der zum
Hofe gehörigen Fischerei wie auch dem Hofe zu Tendel mit allem Zubehör,
wie dieselben Lehen Arnold Christoph v. der Horst und vorher die v. Ruspe
vom Erzstift Köln als Lehen empfingen. (Ebd. S. 49)
(Vgl. Arch. v. Wrede-Amecke, Urk. 368 - 1652, März 21)
1690, Dez. 11: Theodorus Hoeningh als Bevollmächtigter des Jobst
Bernard v. Wrede zu Melschede (bzw. Bruninghaußen) belehnt mit dem
Erzstiftslehnhaus Brünninghausen und der zu dem Hof gehörigen Fischerei
wie auch dem Gut Teindeln mit allem Zubehör, wie dieselben sein (†)Vater
Joh. Henrick v. Wrede käuflich an sich brachte von Arnold Christoph von
der Horst, der mit diesem Lehen von Kurfürst Ferd. von Köln nach Abgang
der v. Rüspe als heingefallenes Lehen belehnt war. (Ebd. Nr. 5, S. 115;
6, S. 86 in: StAD., Kurköln, Leh., Gen.
1785: Philipp, Frh. v. Wrede zu Amecke belehnt mit dem Haus Br.
und zugehöriger Fischerei sowie dem Gute zu Teiden. (Ebd. Nr. 25)
1660, Aug. 1, "im dorff Ohl" - Mahlgerechtigkeit des Hs. Brüninghsn.
Vor Henrich Wortmann, Richter zu Neuenrohde, bekunden folgende Eingesessene
des Ksp. Ohle: Moritz Becker, Johan zu Elhausen, der alte Dickehage (zu
Hilfringhausen), Henrich Schmidt zu Teindell, Johan Duncker, Herman vorm
Kirchhofe, Mertens Diederich, Hans Koßter zu Ohle:
Art. 10: "wahr, daß solche mahlmühle ihre eigene zwängliche mahlgäste des
kirchspelß Ohle hat, welche mehrenteilß leibeigene, ohne dry hoffe, allein
zum hauß Brunninghausen gehorig . . ." "waß die freyen anbelanget, und
wen die Selscheder kämen, hetten in etwa mitt dem mahlen den vorzug..."
(StAD, RKG, W.1015, f. 28-29: Extractus rotuli wegen mahlmuhlen, osemundschmitten
und anderer berechtsambkeit des haußes Brunninghausen". - Vgl. StAD Münster,
Kl. Mk. LA., Nr. 276, Fasz. 7 Mühle zu Brüninghsn. 1728)
1666, Mai 10/18. Jurisdiktion des Hauses Brüninghausen
Verhör folgender Zeugen durch Clemens Piper, Frone zu Altena, in
Ohle am Pfarrhause auf Veranlassung der Räte zu Kleve bzw. des
kurfürstl.-brandenburgischenKommissars Georg Grüter, Hogreve zu Altena
und Richter zu Wiblingwerde:
Aus dem Ksp. Ohle:
Casp. Rickes, Dorf Ohle, ca. 56 J.
Herm. Vorrath, ebda., 61 J.
Moritz Becker, ebda.,54 oder 55 J. alt
Hanß Köster, ebda., 70 J.
Joh. auf der Worth, ebda., 60 J.
Moritz Wehrdeß, ebda., ca. 55 J. alt
Joh. Duncker zu Theindelen, über 80 J. alt
Hindrich Schmidt, ebda., ca. 65 J. alt
Oberste Johan zu Elhausen, ca. 80 J. alt
Das "eisern kellerchen"
Zur Strafgerichtsbarkeit: Die Existenz eines Gefängnis ("eisern
kellerchen") mit einem schließbaren "stock" wie eines Prangers
(kaeck) mit Ketten und Schandsteinen wird bejaht, jedoch selten
der Gebrauch erwähnt. Auf Befehl des Christoph v. Ruspe habe ein
Weib einmal die Schandsteine an einer Kette tragen müssen.
Gemäß Aussage des Joh. auf der Wohrt durften Delinquenten 3 Tage
lang in Brüninghsn. in Haft sein, um dann ans Amt Neuenrade
abgeliefert zu werden. Das spanische Kriegsvolk des Isenburgschen
(Eisenburg) Regimentes unter Obrist Butler habe bei Einquartierung
in den Ämtern Altena und Neuenrade den Pranger und Stock abgebrannt
und die Schandsteine bis auf einen zerschlagen.
Zum beanpruchten Recht des Hauses Brüninghausen auf Zitation (Vorladung),
Cognition (Weg zu einer Lösung suchen), Pfändung und Exekution
äußert Clemens Geck, als Rezeptor bei Pfändungen im Kirchspiel Ohle:
bei Leibeigenen habe der Besitzer des Hauses Brüninghausen durch
seine Bediensteten pfänden lassen. Die Zitierung wird von den Zeugen
im allgemeinen bejaht, jedoch die Incarceration (Haftnahme) meist
verneint.
Zur beanspruchten Anstellung der Rezeptoren durch Haus Brüninghausen:
besonders für ihre Eigenleute, ohne Zuziehung der Neuenrader Beamten,
bejaht von den meisten Zeugen.
Die Dienste der Eigenhörigen wurden im allgemeinen von Haus Brüninghausen
beansprucht, als Amtsdienste werden jedoch Wachdienste geleistet. Zur
Jurisdiktion des Hauses Brüninghausen in Streitsachen über Schatz-
und Kontributionsabgaben: zum Teil bejaht von Zeugen. An- und Absetzung
der Vorsteher und Kirchmeister zu Ohle durch Haus Brüninghausen: bejaht
durch die meisten Zeugen.
StA Münster, Kl. Mk. LA, Nr. 276, Fasc. (- f. 31-52)
Vergleiche Anzeige des Amtmanns zu Plettenberg (Schwarzenberg) Christoph
von Plettenberg betreffend Errichtung eines Stockes oder Kaeck zu
Brüninghausen durch v. der Horst, Drosten zu Vlotho, 1650 (ebd.f. 4-5).
In einem Zeugenprotokoll von 1670 (ebd. f. 103) äußert Clemens Geck zu
Harlinghausen: nach Aussagen seines Vaters hätten die v. Rüspe (bis Anfang
17. Jahrhundert) das Recht zur Coercition (Bestrafung) der Eigenhörigen
betreffend Schlägerei, Scheltworte, Hurerei und andere streitige Sachen
gehabt.
Quelle: Plettenberg-Lexikon
Brüninghausen Schloß; an der Bundesstraße 236 und der Ruhr-Sieg-Eisenbahnstrecke
zwischen Ohle und Teindeln gelegen; seit Mitte des 14. Jahrhunderts urkundlich
nachweisbar, wahrscheinlich aber schon Jahrhunderte früher, sind die "von Ohle"
(auch OLe, Ol, Oill) auf zwei adligen Gütern Brüninghausen, 1 km lenneaufwärts,
auf dem sogenannten Mühlengut und dem sogen. Turmgut absässig; das Turmgut nannte
sich nach dem mehrfach in Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts erwähnten Turmhaus,
das der älteste Teil eines ursprünglich einheitlichen, erst durch Erbteilung (1370)
in zwei Teile gespaltenen Rittergutes war; das Turmhaus erheiratete um 1400 Eberhard
von Rüspe, während das Mühlenhaus vorläufig im Besitz des anderen Zweiges der von
Ohle blieb; in der Folgezeit wechselte das Mühlenhaus mehrfach den Besitzer und
wurde in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts wegen Verschuldung auf dem Marktplatz
zu Schwerte öffentlich versteigert; 1519 erwarb es die Familie von Rüspe, wodurch
die beiden Güter wieder vereinigt waren; 1622 ging es durch Heirat der Erbtochter
von Rüspe an Arnold von der Horst; 1651 wohnten noch zwei erbberechtigte Schwestern
von der Horst - Sibylla Elisabeth und Johanna Maria - auf dem Rittergut; die erste
heiratete Johann Heinrich von Wrede, die zweite dessen Bruder Ferdinand von Wrede;
damit gelangte Brüninghausen an die ursprünglich im Balver Land (Mellen,
Langenholthausen) beheimateten von Wrede, in deren Hand es sich noch heute befindet;
Jobst Heinrich von Wrede, kaiserlicher Rittmeister und kurkölnischer Geheimer Rat
und Kämmerer, ist als Bauherr des erweiterten Schlosses bekannt - von seinem
ältesten Sohn Jobst Bernhard von Wrede leitete sich die später in den Freiherrenstand
erhobene Linie Brüninghausen-Amecke ab; Von 1944 bis 1950 war das Haus Sitz der
Westfälischen Ferngas AG, bis 1970 war es an das "Ohler Eisenwerk" vermietet - das
Haus wurde damals so umgebaut, dass Wohnungen für die Mitarbeiter entstanden; da
Schloss Brüninghausen auch heute als Wohnhaus genutzt wird, kann es nicht von innen
besichtigt werden;

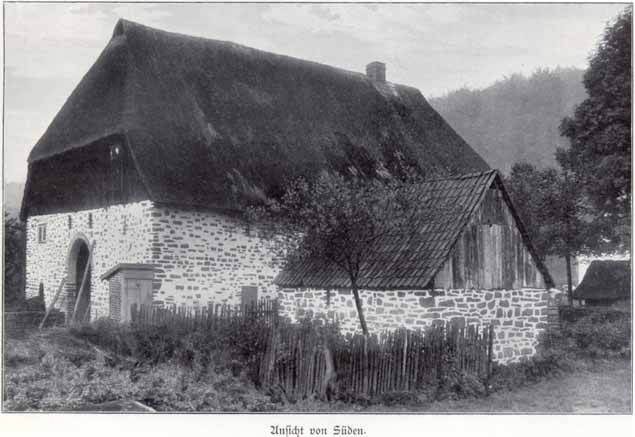
Haus Brüninghausen (Besitzer von Wrede), 13 km südöstlich von Altena.
Bauernhaus, Renaissance, 17. Jahrhundert, massiv. Quelle: Die Bau- und
Kunstdenkmäler von Westfalen, A. Ludorff, 1911

Die ehemalige Mühle. Foto: Martin Zimmer, März 2002
Siehe auch: Forstbetrieb Freiherr v. Wrede

Foto: Franz Scharwächter
Quelle: Westfälische Rundschau vom 10.05.1996 im Ev. Kirchenarchiv Ohle, Sign. 3.3
Origineller Beitrag zum Stadtjubiläum im nächsten Jahr
Schloß Brüninghausen
als malerische Kulisse
für Ohler Ritterspiele
Ohle. (mau) Im alten Kirchspiel Ohle erwacht wieder das Ritterfieber!
In einem Vorgespräch mit dem Eigentümer des Schlosses Brüninghausen, Christoph
von Wrede, ist die Ohler Dorfgemeinschaft ihrem Ziel, anläßlich des 600.
Stadtjubiläums am 8. Juni 1997 rund um das historische Gebäude ein mittelalterliches
Fest für jung und alt aufzuziehen, ein ganz gehöriges Stück nähergekommen.
Am Mittwoch abend führte von Wrede die Vorstände (fast) aller in der
Dorfgemeinschaft zusammengeschlossenen Ohler Vereine sowie Kulturamtsleiter
Siegfried Griebsch über sein Grundstück. Schnell waren sich die Beteiligten
einig: eine prächtige Kulisse für ihr Ritterfest.
In der anschließenden Diskussion im Ohler SGV-Heim wurde ein möglicher Rahmen
abgesteckt, in dem die Feierlichkeit ablaufen könnte. Im Anschluss an die
thematisch am Mittelalter orientierten Sonntagsgottesdienste können die
Ohler Familien und andere Plettenberger zum Festplatz strömen - möglichst
per Pedes über den Stübel. Mangels Parkmöglichkeit am Schloß Brüninghausen
soll für Gäste, die nicht gut zu Fuß sind, ein Shuttle-Dienst von einem
Parkplatz in Ohle eingerichtet werden. Nach Rücksprache mit Ordnungsamtsleiter
Norbert Jahn muss die Bundesstraße 236 für Fußgänger tabu bleiben.
Das eigentliche Fest mit Edelleuten und Gesinde, Gauklern und Rittern, derbem
Ritteressen und Getränken aus Krügen soll mit Hilfe von Archivar Martin Zimmer
auf unterhaltsame Art viel Information über Ohle im allgemeinen und das Schloß
Brüninghausen im besonderen aus jener Zeit liefern, in der Plettenberg die
Stadtrechte verliehen wurden. Alle Ohler Vereine wollen an der Programmgestaltung
mitwirken. Am Abend gegen 18 Uhr soll das Fest ausklingen.
Auf der nächsten Sitzung der Ohler Dorfgemeinschaft wird das Konzept konkretisiert.
Erst danach ist vom Eigentümer Christoph von Wrede eine endgültige Zusage zu
erwarten, dass er seinen Schloßgarten zur Verfügung stellt.
. . .

Foto: Franz Scharwächter
Quelle: "Von der Hünenburg auf dem Sundern bei Ohle und ländlichen
Siedlungen in ihrer Umgebung", P. D. Frommann, 1949, S. 12-16
Von Ohler Burgvögten und ihren Nachfolgern
Der erste urdkundlich erwähnte Burgvogt zu Ohle ist Wilhelmus de Ole, der in
einer Urkunde des Kölner Erzbischofs Brunos III. von 1193 und in zwei anderen
des Erzbischofs Adolfs I. von Altena aus den Jahren 1196 und 1197 als Zeuge
angegeben ist. Seit 1180 waren die Kölner Erzbischöfe Herzöge von Westfalen
und dadurch auch Vorgesetzte der Burgvögte. Die Nachkommen Wilhelmus de Ole
besaßen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts außer der Curtis Ohle auch
Brüninghausen und Güter in Dahle, Plettenberg und Windhausen zu Lehen.
Es wohnten in Brüninghausen 1313 Hermann von Ole, 1326 Hermann und Wilhelm von
Ole. Letztere hatten Teindeln, das Bilsteiner Burglehen war und zu ihren
Stammbesitzungen gehört hatte, anscheinend an die Edelherren von Rüdenberg
aufgelassen und dann als Lehen zurückempfangen. Goswin von Rüdenberg war der
Schwiegervater eines Hermanns von Ole. Hermann und Wilhelm von Ole besaßen
auch die Hünenburg auf dem Sundern. 1372 wurde Theodor von Ole mit dem Oberhof
Ohle belehnt.
Um 1370 erfolgte eine Teilung Brüninghausens. Hermanns Sohn, Johann von Ole,
erhielt das Mühlenhaus und Everhard de Ruyspe, der Gemahl seiner Schwester
Ermyne, das Turmhaus. Dieser Everhard de Ruyspe wurde 1401 vom Kölner
Erzbischof mit dem Oberhof "Oyle in parochia Oyle" belehnt. Damit gelangten die
von Rüspe auch in den Besitz des Patronats über die Ohler Kirche und die
patrimoniale Gerichtsbarkeit über die zum Oberhof Ohle gehörenden Bauern.
Weil ein Ritter von Ohle die Erbin des Gutes Frielentrop geheiratet hatte,
zog er dorthin; 1456 war Frielentrop der Wohnsitz Johanns von Ole. Im
16. Jahrhundert besaßen die von Ole auch Langeney. . . Die Familie von Ole
wird nach der Mitte des 15. Jahrhunderts nicht mehr in der Gemeinde Ohle
erwähnt. Zweige derselben lebten in Frielentrop, Bamenohl und Langeneu.
1507 gehören Johann von Ole noch zwei Höfe zu Teindeln, die er damals dem
Hospitale auf dem Böhl verpfändet hatte.
Ein Nachkomme (vermutlich ein Enkel) Eberhards von Rüspe, Guntermann von
Rüspe, hatte Petronella von Plettenberg zur Gemahlin. Die wirtschaftlichen
Verhältnisse derer von Rüspe im Turmhause scheinen in jener Zeit nicht
immer günstig gewesen zu sein, denn Guntermann und sein Bruder verkaufen
den Loerhof zu Grimminghausen an den Plettenberger Bürger Henrich Wyscherd;
ferner veräußerten Guntermanns Witwe Petronella und ihre vier Söhne ihre
Einkünfte aus dem von Hans vor dem Kerkhofe zu Ohle bebauten Gute 1501 an
die dortige Kirche. Damals war das Mühlenhaus sogar an den Schwerter
Bürger Wendel verpfändet.
Günstiger gestalteten sich die Verhältnisse unter Guntermanns Sohne Gerd
von Rüspe. Dieser heiratete 1513 Katharina von Eppe und erwarb 1519 von
Johann Rump zur Wenne das Mühlenhaus. Dieses hatte inzwischen folgende Besitzer
gehabt: nach Johann von Ole erst Aleke Wesselberg, dann 1426 Diedrich Sprenge,
später Aliff Qwoyde (Quade ?), 1481 Johann von Kobbenroyde und endlich
dessen Schwiegersohn Johann Rump. Gerd von Rüspe kaufte ferner noch 1521
Godecken, 1532 Middendorps Gut zu Ohle, 1523 das Hofgut zu Erkelsen, er löste
auch 1518 den "Bushof" zu Hilveringhausen und später Lohagen Gut zu Grimminghausen
wieder ein. 1538 belehnte ihn der Kölner Erzbischof mit Brüninghausen. Er
wird auch als Patron der Kirche in Balve erwähnt. Im Jahre 1532 (?) starb er schon.
Seine Witwe kaufte 1539 das Hofgut - den Loerhof - zu Grimminghausen, "den
dermalen Diedrich Rump nutzt" und den die von Rüspe schon früher besessen hatten.

Foto: Ev. Kirchenarchiv Ohle, Sign. S/F 9
Gerds Bruder Jürgen von Rüspe wurde Besitzer des Gutes Baukloh, das von diesem
auf seinen Sohn Rötger und danach auf dessen Sohn Johann überging. Die beiden
ältesten Söhne Gerds, Hermann und Johann von Rüspe, erbten Brüninghausen.
Hermann verkaufte 1547 den Vogelsang in der Gemeinde Herscheid an Matthias von
Reringhusen und war Lehnsherr des Kösters- oder Wibbecker Gutes zu Böddinghausen.
1564 kaufte er das Gut Blomberg bei Valbert und von denen von Schade für 1.000
Goldgulden und 300 Taler Teindeln, das schon früher mit Brüninghausen vereinigt
gewesen war. In Teindeln wohnten zu der Zeit Hans Duncker, Gerd Eckmann und
Hans Selter. 1570 lebte auf dem mittleren Gute Hermann Schmidt.
Weil die Ehe Hermanns von Rüspe kinderlos bleib, so setzte er seinen Bruder Johann
zu seinem Erben ein. Dieser war schon 1561 mit Brüninghausen belehnt worden und
seit Hermanns Tode (1566) alleiniger Besitzer. Er war auch Lehnsherr der beiden
Elhauser Güter. 1567 belehnte er mit dem einen Johann, Peters Sohn daselbst, und
1585 mit dem andern, auf dem vorher Hermann gewohnt hatte, den Heinrich Noelle.
Johann starb 1586.
Sein Sohn Christoph von Rüspe war mit Sybilla Effern gen. Hall vermählt, übte
die patrimoniale Gerichtsbarkeit mit Weisheit, genoss seitens der Ohler Bevölkerung
hohes Ansehen und wurde 1614 in der Ohler Kirche beigesetzt.
Aus der Ehe seiner ältesten Tochter Anna Margareta von Rüspe, der
Erbin Brüninghausens, mit Arnold von der Horst zu Hellenbrock gingen
zwei Töchter hervor, die die Gemahlinnen zweier Brüder von Wrede wurden.
Die von Wrede besaßen im 15. Jahrhundert Güter zu Balve und Wulfringhausen.
Henneke von Wrede gehörte bis 1640 auch ein Gut in der Gemeinde Herscheid.
Gerd von Wrede war 1417 bis 1420 Landmarschall in Livland. Johann Heinrich
von Wrede, der Gemahl der Sybille Elisabeth v. d. Horst, war nicht bloß
Besitzer der Güter zu Brüninghausen, Langenholthausen und Baukloh, das
der erwähnte kinderlose Johann v. Rüspe daselbst 1641 der Witwe Arnolds
v. d. Horst übertragen hatte, sondern auch Herr zu Müllenbach und
Niederlahnstein, ferner Kaiserlicher Rittmeister, Kurkölnischer Geheimer
Rat und Kämmerer, auch Drost und starb 1688.
Von seinem ältesten Sohne Jobst Bernhard von Wrede stammt die Linie
Brüninghausen-Amecke. Dessen Bruder erbte von seinem kinderlosen Oheim,
des Vaters Bruder, Melschede. 1713 machte Bernhard Friedrich von Wrede
zu Amecke das Schloss Brüninghausen zu einem Fideikommiß, das stets auf
den ältesten Sohn übergehen sollte. Es gehörte: 1763 Carl Philipp von
Wrede, 1809 der Freifrau Eleonore von Wrede zu Amecke, 1850 dem Königl.
Hannoverschen Kammerherren Freiherrn Carl Engelbert von Wrede zu Nettlingen
bei Hildesheim, seit 1851 Carl von Wrede, 1891 Paul von Wrede, dann dem
Freiherrn H. von Wrede zu Amecke.
Obwohl die Freiherrn von Wrede dem katholischen Bekenntnis angehörten,
hatten sie doch bis ins 19. Jahrhundert hinein das Recht, die Ohler
Pfarrstelle besetzen zu können, die sie 1764 dem Pastor P. W. Werkshagen
und 1809 Karl Friedrich Wille auf Wunsch der Gemeinde übertrugen. Andrerseits
waren sie auch verpflichtet, in Fällen, in denen das Kirchenvermögen zur
Erhaltung der Kirche und Schule nicht ausreichte, zwei Drittel der erforderlichen
Kosten zu übernehmen.
Im 17. Jahrhundert hat Brüninghausen arg gelitten Am 12. Dezember 1608
kamen in der Dunkelheit sieben Straßenräuber, die mit Äxten und Hacken
Tor und Türen, Kisten, Kasten und Schränke erbrachen, das Gesinde verwundeten
und dann mit dem vorgefundenen Gelde, den Kleinodien und dem Silbergeschirr
verschwanden. Noch schlimmer erging es Brüninghausen im Dreißigjährigen Kriege
(1618-1648). Die Kriegsvölker des Obersten Buttler und besonders das
Eisenburgische Regiment haben dort übel gehaust. Die Gebäude hatten derartig
gelitten, dass dem Turmhaus 1668 eine gründliche Instandsetzung zuteil werden
musste (*nach Akten im Archiv des Freiherrn von Wrede).
Vor 80 Jahren beschrieb Lehrer Wilhelm Rötelmann zu Ohle Brüninghausen in
folgender Weise:
"An Gebäuden sind vorhanden: das herrschaftliche Wohnhaus,
zwei Oekonomiegebäude und eine Fruchtmühle. Das Wohnhaus besteht aus zwei Haupt-,
einem Mittel- und einem Nebenflügel und hat im Verhältnis zu seinem geringen
Umfange eine wahrhaft imponierende Höhe. Es gibt über 40 zum Teil sehr ausgedehnte
Räume und Gemächer in demselben, im Erdgeschoss 8, dem ersten Stock 11, dem zweiten
10, dem dritten 5 und einen Kornboden, zu dem eine Treppe von 86 Stufen führt.
Mit Tapeten sind nur die Zimmer der untern Etage bekleidet, dabei auch zum Teil
mit prachtvollen Möbeln geschmückt.
Vormals wurde dieses Gebäude, zum Unterschied zum sogenannten Mühlenhause, welches
zwischen der Mühle und dem größeren Teiche stand, das Turmhaus genannt. Beide
waren durch einen Bogen verbunden und ringsum mit Wasser umgeben.
Die Grundfläche des Gutes beträgt 1.227 preußische Morgen, woran die Schulten
Colonie mit 202 Morgen beteiligt ist. Hierunter befinden sich 1.019 Morgen
Waldungen. Dazu kommen noch 8 Morgen jüngst angeworbener Markenberge, sowie in
der Steuergemeinde Eiringhausen ein Bergdistrikt von ca. 60 Morgen. Der Reinertrag
von diesen Gütern beläuft sich auf 1.341 Taler.
Bis 1812 gehörten sämtliche Güter im Dorfe, zu Teindeln, Hilferinghausen, Elhausen
und Jeutmecke zu diesem Rittersitze und waren nebst Erkelze zu der Fruchtmühle
daselbst mahlpflichtig."
Die zum Rittergut Grimminghausen gehörenden Bauernhöfe und Selscheid waren
zwangsmahlpflichtig nach der Mühle zu Versevörde; im Jahre 1765 waren das 90 Personen.
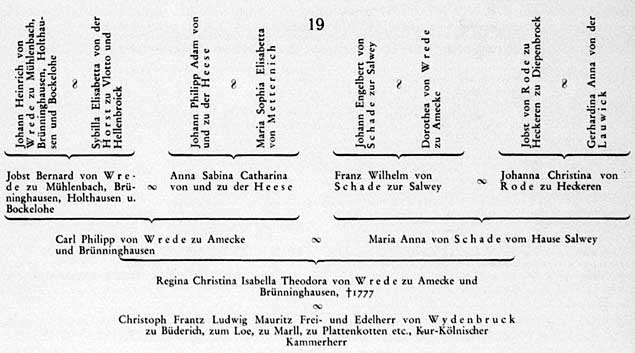
Quelle: IVa Adelsarchiv v. Wrede-Amecke, 1. Generalia,
1d) Gutsinventare, Streitsachenverzeichnis (aus: Süderländische
Geschichtquellen und Forschungen, Band IV, 2. Teil, S. 315-318, E. Dösseler)
o. D. (vor 1590), Urk.-Nr. 177
Landwirtschaftliches Inventar des adligen Gutes Brüninghausen
(Inventarium deß gereiden zu Bruininckh.)
Johan Voß, bauwmeister, hait an baureidschafft vorbracht: item
1 wagen mitt seiner thobehorungh, 1 (alde) mistkair, 1 (alde)
loiffkar, (2 nie schledden), 2 scherepfloeghe (1 pfloegh), 1
vorpfloegh mit ihrer zubehoir, 2 isern und 2 hultzen egeden
mit ihrer zubehoirungh, item 4 haimen alde und neuwe, 1 kairsattell,
2 lichten, 2 toeme (2 echtersellen mitt ihrer zubehoirungh, 1
anspan mett seiner zubehoir), 3 (2) schüten, 5 (4) mistgafflen,
2 schottgafflen, 1 raehacke, 2 heidthacken, 3 (2 neuwe) holdtbylen,
1 nie handtbyle, 1 hoppenhacke, 1 euerbor, item 1 isern hoppenseckell,
item 1 pferdewehr, 1 schnidebanck, 1 nie und 1 aldt schniedemesser,
3 sichte, 4 seißen, 7 (5) fliegel, 2 (1) remme, 2 (1) isern paile,
2 pair vorketten, 2 pair pfloegketten, 1 bindtkette, 2 remmeketten.
Schmitte-reidschaft (Schmiede-Gerätschaften)
1 anbildt, 2 belge, 1 vorhaimer, 1 seidthaimer, 1 speerhaicken,
2 tangen, 2 herdtisern, 3 naigelisern, 4 dorschlege, 1 baitell,
2 (1) handthemmer, 2 kleine hemmer, 1 hoiff tange, 1 werckemeßer,
2 buikketten in den noidtstall, 1 werckefatt.
Viehe
Item 17 melcke Koe und dreghafftige stercken (Dieser Koe haidt die
celnersche ein mittgenohmen . . .). Item 3 stercken, 1 vornochse.
Item 41 schaiffe, darunter 12 jairlinge. Item 1 pferdt, hab ich dem
junckern guedt gethain. Item 3 schweine, haidt Dierich alzusamen
gekofft. 16 hunder, daerunder 3 hainen. Item 11 gense, 3 ende. Item
9 voider heugens. Item noitturfft vor rinder und kohevoider.
Proviandt
Item der vorraidt an speck ist gewesen 11 syden mitt den schencken
und 7 schencken zusammen gewesen 205 pfundt. Item 1 vaß bier von
3 tunnen. Item ungefehrlich 2 ahem Weins, sein dem probst zugeschoren,
soll ich nicht widderliebern.
Verzeichnis, was ich zu Bruininckhuißen an vettungh und seiungh
entfangen.
Archiv von Wrede-Amecke, Akten I A Nr. 10. - In Klammern spätere
Zusätze. Weil diese späteren Zusätze sich im Inventar vom 17. Mai
1590 (nachfolgend) finden, muss obiges Inventar früher zu datieren sein.
1590, Mai 17, Urk.-Nr. 178
Inventar des Gutes Brüninghausen
"Verzeichniß der saidungh und besetzungh des guedt, so der richter
Kreickeboeme . . . vermuege vorigen contracts zu seiner zeitt . . .
widderliebern soll.
Irstlich uff der laicke . . .
Quelle: Steuerzettel, Abgaben u. Dienste im Amt Neuenrade, StA. D.
Kl. Mk. XXX, Nr. 45 (früh. StA Münster, Kl. Mk. LA 57), f. 280a-282b
Kirspels Ohle hebzettul
Anno 1651, den 1 martii ist diese hebzettul von unserem herren richteren
Henrichen Wortmann (Richter des Amtes Neuenrade) und [dem] verwalteren
deß haußes Bruninghausen, Arnoldten Milesien, wie dan den vorsteheren [des]
kirspels Ohl unterbenent verfasset worden.
Hoff, Johann, 28 Stbr.
Merthens, Mauritz, 42 Stbr. 6 pf.
Auff der Worth, 34 Stbr.
Richs, 9 Stbr.
Suer, 6 Stbr.
Werdts und Paulmann, 28 Stbr.
Wulner, 20 Stbr.
Mollers, Grethe, 6 Stbr.
Schmidt, 11 Stbr.
Becker, 32 Stbr.
Oberman, 32 Stbr.
Vorroth, 32 Stbr.
Voß, 32 Stbr. 6 pf
sa. = 6 rhr., 43 stb., 6 pf.
(alle aus dem Dorf Ohle ?)
Es folgen von den Höfen außerhalb des Kirchspiels:
Herman Coster, Herman Schneider, Johan zu Erckelse, Volmars Johan zu Selschede,
Voßloe, Schuhemacher zu Hilveringhausen, Schmidt zu Teindell, Selter ebd.,
Birman zu Hilveringhausen, Jasper zu Erckelse, Oberste zu Elhausen, Heugell
(Selscheid), Winterhoff, Eberich (Selscheid), Henderich unter den Eiche
(Selscheid), Dickehage (Hilfringhausen), Duncker (Teindeln), Jasper zu
Erckelse, Achter dem Keller (Hilveringhsn.), Niederste zu Elhausen, Hinderich
Dickehage vom lande, Hinderich uf dem Have. Sie mussten 15 Reichstaler,
13 Stüber und 6 Pfennig zahlen, macht Summa summarum 22 Reichstaler, 41 Stüber.
Unterschrieben ist der Hebezettel von Hinderich Wortmann (Richter des Amtes
Neuenrade), Arnoldt Milesies, Moritz Becker - auf Begehren Johan zu Erckelse
und Johan Duncker dieses unterschrieben, Johan Selter, Moritz Neiße, Volmar
Ebberich, Jasper Heugell.
In einem "Verzeichnis der Dienste" im Amt Neuenrade im Jahre 1651
heißt es "Die Eigenen im Kirchspiel Ohle, zum Haus Brüninghausen gehörig,
tun keine Dienste oder Jagddienste dem Drosten, ohn alleine die Freien tun Dienste."
1776, Juli 2 Nr. 9, Verzeichnis der Mahlgenossen der herrschaftlichen
Mühle zu Brüninghausen (b. Ohle). Darin sind 29 Familien als Mahlgenossen
ausgeführt.
Vasallentabellen des märkischen Amtes Neuenrade
1801, Nov. 29, Nr. 10a - Gut: Brüninghausen, feudal, (kurköln. Lehen) und
schatzfrei; Inhaber: Ww. Geh. Rat v. Wrede, 65 Jahre, zu Amecke; Wert:
20.000 Reichstaler. Zum Vergleich: Der Rittersitz Grimminghausen, allodial und
schatzfrei, war zusammen mit Neuenhof 27.000 Reichstaler wert.
1800, Apr. 3 - Liste der adligen Güter im Amt Neuenrade - Nr. 10b
Ksp. Ohle: Brüninghausen, Kurkölnisches Lehen, Inh.: Carl Frh. von Wrede,
Schätzwert 5.425 Rtl. (nach Taxe des Scheffen Rentrop).
Grimminghausen: Allodial des Frh. v. Kessel, Wert 31.000 Tlr. gemäß Kaufbrief
vom 03.01.1800 (jedoch einbegriffen die dabei gelegenen Bauerngüter).
Gerichtsbarkeit im Kirchspiel Ohle
Mit Schreiben vom 12. Juli 1526 fragen die Klevischen Räte (Herzog Joh. III.)
beim Amtmann zu Neuenrade an. Sie wollen wissen, ob es stimmt, dass sich "Gert
van Ruyspe etliche Hoheit und Gerichtsbarkeit in unsere Amt und im Kirchspiel
Ohle anmaßt". Man solle sich erkundigen, wie "die bloetrenne ader die straeff
heb aver die lyffbrueken", wo man die Güter im selben Kirchspiel "uyt to gaen
plege".
Am 2. August 1526 antwortet Dietrich Becker, herzoglich klevischer Richter zu
Neuenrade, dass vor seinem Hochgericht, das bestätigten der Volmert von dem
Neuenhofe, Amtmann zu Neuenrade, sowie Bürgermeister, Räte und Alteingessene
des Amtes: Wenn im Kirchspiel Ohle "eyne blot renynge gesche eder lyffbroeck",
so würden sie in Neuenrade gerichtet vor dem Hochgericht. Das gelte auch für
Klagen um Schuld und Schaden im Kirchspiel Ohle. Auch habe man im Kirchspiel
Ohle nie einen Galgen oder Räder gesehen, mit denen Leibbrüchten bestrafe.
Auch sei von Gert van Ruspe und seinen Vorfahren keine Gerichtsbarkeit im
Kirchspiel Ohle ausgeübt worden.
Am 9. August 1526 (StAD, Kl. Mark, XXII, Nr. 91a) fügt Dietrich Becker noch hinzu:
Im Kirchspiel Ohle sei nie ein Richter gewesen. Die Gebrechen (Tätlichkeiten)
der Leute untereinander, sowohl den Eigenleuten des Gert van Ruspe als auch
den Vorvätern mit den Kirchspielsleuten, seien immer vor dem Gericht zu Rode
(Neuenrade) geschlichtet worden.
1650, Apr. 9 Bericht des Richters Henrich Wortmann
Adlige Jurisdiction: (Art. 3)
Selbige fehlen. Nur sind unter dem Hause Brüninghausen, gehörig dem
kurfürstlichen Drosten zu Vlotho Arnold Christoph v. der Horst, alle
Einwohner des Dorfes Ohle bis auf 3 bis 4 Freie leibeigen. Die
Leibeigenen werden durch den Diener oder Müller des Hauses Brüninghausen
zu Diensten und Pachtlieferungen angehalten. Sonst soll auch das Haus
Brüninghausen die Gerechtigkeit haben, "daß vor kurtzen jahren annoch
einen kaeck (Pranger) in mehrbesagtem dorf Ohle gestanden, wohemitten
die ubertrettere der leibeigenen bestraffet." Diese Gerechtsame werde
auch jetzt noch durch den gen. v. der Horst beansprucht.
380 Urkunden im Archiv des Hauses Amecke, Laufzeit 1293-1794
1652 erwarben die von Wrede durch Heirat das Gut Brüninghausen bei Plettenberg. Dieses Gut war um 1400 von der Familie von Ohle an die Familie von Rüspe gelangt und durch die Heirat von Anna Margarethe von Rüspe mit Arnold von der Horst zu Hellenbroich und Müdlinghausen 1622 an die von der Horst gegangen. Durch die Heirat der Brüder Johann Heinrich und Ferdinand von Wrede mit den Schwestern Sybilla und Johanna Maria von der Horst kam nicht nur Brüninghausen an die von Wrede, sondern auch Gut Bockeloh bei Plettenberg, das seit dem 14. Jh. im Besitz der von Ohle, dann der von Rüspe gewesen war. Bockeloh wurde 1770 an C. D. Geck zu Rosmart verkauft.
Literatur: Conrad, Horst (Bearb.): 800 Jahre Familie von Wrede 1202-2002. Münster 2002.
1869, Jan. 22 Vertrag zwischen der Ev. Gemeinde Ohle und Freiherr
Carl von Wrede über
die Auflösung des Patronatsverhältnisses
Auszug aus § 4: ". . . Für die in § 1 bis 3 . . . Ablösung des Patronats,
insbesondere für die Übernahme der gesamten Baupflicht hinsichtlich der
Kirchen und Pfarrgebäude seitens der hiesigen Gemeinde, zahlt der Freiherr
Carl von Wrede-Amecke in Nettlingen an die genannte Kirchengemeinde die
Capitalabfindung von 1.750 Taler . . . binnen drei Monate . . ."
Auszug aus § 5: ". . . Beide Theile entsagen allen Einreden gegen diesen
Ablösevertrag und verzichten gegenseitig auf alle weiteren Ansprüche.
Von den Kosten dieses Ablöse-Vertrages übernimmt jeder Theil die Hälfte
und wird beiderseits zweimalige Ausfertigung dieser Verhandlung beantragt. . .

Kartenausschnitt einer Karte der Grafschaft Mark von 1791. Es sind die
Grenzen zwischen dem Amt Neuenrade, zu dem Brüninghausen (roter Pfeil) und
Ohle gehörten, mit dem Amt Plettenberg und dem Amt Altena sowie dem
Hochgericht Lüdenscheid farbig abgesetzt.
Die Besitzer des Hauses Brüninghausen
1311 erste Erwähnung, Stammhaus des Geschlechts von Brünninghausen
1313 Hermann von Ole wohnt auf Schloß Brüninghausen
1326 wohnen Hermann und Wilhelm von Ole in Brüninghausen
1370 Erbteilung: Hermanns Sohn Johann von Ole erhielt das Mühlenhaus,
Everhard de Ruyspe, Ehemann von Ermyne v. Ole (Schwester von Johann),
erhielt das Turmhaus.
1370 Johan v. Ole, Herr zu Brüninghausen
1400 (um) Das Turmhaus erheiratete um 1400 Eberhard von Rüspe
1400 Johann von Ole gibt das Mühlengut an Aleke von Wesselberg
1406 kauft Dietrich von Wesselberg von Evert Rüspe dessen Zehnten, Fischerei
und Rechte an Brüninghausen und das Gut in Ohle.
1423 ging Gerhard von der Mark daran, den politischen Verhältnissen widerstrebende
Landstände zum Gehorsam zu bringen, wobei die van Bruyninckhuysen und Rusope
(von Brüninghausen und Rüspe) und als zu belagernde Burgen Geirharts huyss
van der moelen ind Bruyninckhuyss (Gerhards Haus von der Mühlen und Brüninghausen).
1426 Aleke von Wesselberg vermacht das Mühlengut an Diederich Sprenge
???? Aloff Qwouyde und Gattin Adelheid erben das Mühlengut
1431 sie verkaufen es an an Johan v. Kobbenroyde
???? von Rump zur Wenne besitzt das Mühlenhaus
1501 das Mühlenhaus ist an den Schwerter Bürger Wendel verpfändet
1515 Johan von Rump verkauft das Mühlengut an die Besitzer des Thurmgutes, Gert v.
Rüspe und dessen Gemahlin Catrin v. Eppe, wodurch das Turm- und das Mühlengut wieder in einer Hand sind.
???? Abbruch eines Burghauses
1519 erwarb es die Familie von Rüspe (Gerhard v. Rüspe)
???? Anna Margreta v. Rüspe bringt die Güter durch Heirat an Arnold v. d. Horst
zu Hellenbrock
1526 Gert van Ruspe
1539 Erzbischof Hermann von Köln belehnt Johan von Ruspe mit dem Haus
Brüninghausen (Bruningkhuysen)
1587 Diderich von Ruispe
1622 ging es durch Heirat der Erbtochter von Rüspe an Arnold Christoph von der Horst
1651 wohnten noch zwei erbberechtigte Schwestern von der Horst - Sibylla Elisabeth
und Johanna Maria - auf dem Rittergut; die erste heiratete Johann Heinrich von
Wrede, die zweite dessen Bruder Ferdinand von Wrede; damit gelangte Brüninghausen
an die ursprünglich im Balver Land (Mellen, Langenholthausen) beheimateten von Wrede
1652 deren Tochter Sibilla Elisabet v. d. Horst heiratet Johan Henrich von Wrede,
der die Güter durch Kauf an sich bringt.
Jobst Heinrich von Wrede (†1688), kaiserlicher Rittmeister und kurkölnischer
Geheimer Rat und Kämmerer, ist als Bauherr des erweiterten Schlosses
bekannt. Von seinem ältesten Sohn Jobst Bernhard von Wrede leitet sich
später die in den Freiherrenstand erhobene Linie Brüninghausen-Amecke
ab.
1658 wird ein neues Haus erwähnt
1668 nennt ein Maueranker als Datum der Erweiterung des Schlosses
1713 Bernhard Friedrich von Wrede macht Brüninghausen zu einem Fideikommiß
1763 gehört es Carl Philipp von Wrede
1801 Ww. Geh. Rat v. Wrede, 65 Jahre, zu Amecke
1809 gehört es der Freifrau Eleonore von Wrede zu Amecke
1842 Rötelmann: "Es gibt über 40 einzelne, zum Teil sehr ausgedehnte Räume und Gemächer,
im Erdgeschoss 8, dem ersten Stock 11, dem zweiten 10, dem dritten 5 und einen Kornboden,
zu dem eine Treppe von 86 Stufen führt. Mit Tapeten sind nur die Zimmer der unteren
Etage verkleidet, dabei auch zum Teil mit prachtvollen Möbeln geschmückt
???? Jobst Bernhard v. Wrede, Johan Heinrichs Sohn.
1850 dem königl. Hannoverschen Kammerherren Freiherr Carl Engelbert v. Wrede
zu Nettlingen (bei Hildesheim)
1851 Carl von Wrede
1869, Jan. 22 Vertrag zwischen der Ev. Kirchengemeinde Ohle und Freiherr
Carl von Wrede über die Auflösung des Patronatsverhältnisses
1891 Paul von Wrede
1906 Karl v. Wrede erbt Brüninghausen
1934 Hermann v. Wrede
1944 bis 1950 Sitz der Westfälischen Ferngas AG
1950 bis 1970 war das Schloss an das Ohler Eisenwerk vermietet
1993 Jobst v. Wrede übergibt Brüninghausen an Sohn Christoph-Hermann v. Wrede

Am Aussichtspunkt von Brüninghausen zur Hünenburg auf dem Sundern ist in den Fels gemeißelt:
C. v. W - E. v. W - geb. v. H., den 8/9. 1853. Umrahmt sind die Kürzel durch
fünf Rosen, wie sie auch im Wappen der von Wrede vorkommen. Eltern des Brautpaares
sind offensichtlich P. v. W. und A. v. W.
Quelle: Einwohnerbuch der Stadt Lüdenscheid und des
Kreises Altena 1931/32, Amt Plettenberg, S. 466-467
Brüninghausen
Cesar, Josefine, Köchin
Falcioni, Therese, Kinderfräulein
Kruse, Therese, Wwe., Landwirtin
v. Wrede, Hermann, Freiherr, Kaufmann, F. Plettenberg 285
Lexikon für die Stadt Plettenberg, erstellt durch Horst Hassel,
58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail:
webmaster@plbg.de
|