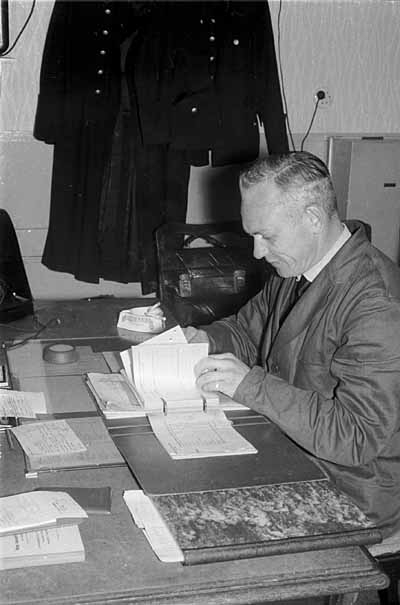|
10 Jahre Krankentransport
Quelle: Erinnerungen von Helmut Groß, maschinengeschrieben
DIN A4, 6 Seiten im Privatarchiv HH; zahlreiche Fotos aus der Chronik
des Krankentransportes in der Feuer- und Rettungswache
Opel Blitz von 1930 der erste Krankenwagen
Er war ein "Mann der ersten Stunde" in Sachen Krankentransport: Helmut Groß (*31.12.1923 †14.12.2006).
Bei seiner Verabschiedung am 30. Dezember 1983,
wenige Monate nach seinem im Januar 1983 gefeierten 40-jährigen Dienstjubiläum, erinnerte er sich daran, wie alles begonnen hatte,
wie er mit seinen Kameraden den Krankentransport der Stadt Plettenberg nach dem II. Weltkrieg aufgebaut
und von 1950 bis 1973 geleitet hat. Seine Aufzeichnungen stellte er seinerzeit dem Chronisten zur
Verfügung. Vor wenigen Tagen fanden sie sich in einem Stapel Archivalien wieder. Und das ist die Geschichte
von Helmut Groß und der Geburtsstunde des Krankentransportes in Plettenberg:
Trotz aller Widerwärtigkeiten habe ich dann aber am 1.06.1946 diese Station eröffnet. Von der damaligen Freiwilligen Sanitätskolonne Plettenberg-Eiringhausen habe ich einen Krankenwagen Opel Blitz übernommen, ebenso den Fahrer Hoffmann, welcher seit 1930 bei der Sanitätskolonne die Krankenwagen gefahren hatte. Hinzu kamen Otto Nölle und Friedrich Schröder, kurze Zeit später auch Hans Schulte.
Der mir übergebene Krankenwagen war in einem trostlosen Zustand. Er hatte nur hinten rechts noch eine Bremse im Rad, alle Reifen waren ohne Profil. Erst nach einigen Wochen erfuhren wir durch andere Sanitäter aus Eiringhausen, dass in der dortigen Garage noch neue Reifen genügend vorhanden waren, uns aber nicht übergeben wurden.
Von dem englischen Stadtkommandanten wurde für den KBM Kohlhage als Kommandofahrzeug von
einem Postbeamten am Osterloh ein DKW beschlagnahmt, von Elektro Listringhaus ein Opel P4,
und von der Firma Schöpe am Dillacker erhielten wir einen Mercedes 7/32. Weiterhin fuhren wir kurzzeitig
noch einen Hansa 1100. Aus dem damaligen Lazarett Hellersen erhielten wir aus Beutebeständen
noch einen Citroen Krankenwagen mit zwei Tragen zugewiesen. Auch dieses Fahrzeug konnten
wir wieder fahrbereit machen und damit noch ca. 2 Jahre fahren. Im Jahre 1948 kamen dann
E. Kalthoff, 1950 K. Heßmer, 1956 K. H. Hee(rich), 1962 H. W. Klaucke, 1963 M. Eggert und
1964 H. Kotyczka. Das war der alte, langjährige Stamm der Krankentransport-Station.
Ehefrauen der Krankenwagenfahrer übernahmen den Telefondienst
Um überhaupt die Wagen fahren zu können, bekamen wir von der Bezirksregierung in Arnsberg
vom damaligen Bezirks-Brandmeister Willi Linnepe eine monatliche Benzin- und Reifenzuteilung.
Diese Zuteilungen waren aber immer so knapp, dass wir oftmals nur ein Fahrzeug in Betrieb
halten konnten. Es kam alse desöfteren vor, dass alle Wagen ohne Benzin still standen.
Das muss man sich heute einmal vorstellen: da hat man drei Wagen in der Garage und keiner
kann laufen!
Benzin heimlich bei belgischen Lkw abgezapft
Private Pkw gab es so gut wie gar nicht. Wer sollte also sonst wohl die Krankentransporte
durchführen? So wie es noch bis zum Ende des Krieges gegangen war, ging es auf keinen
Fall weiter. In diesen Jahren, und auch vor dem Krieg seit 1930, hatte die freiwillige
Sanitätskolonne in Eiringhausen eine Garage neben dem Kino. Der Fahrer Hoffmann
arbeitete bei Graeka (Graewe & Kaiser). Seine Frau hielt das Telefon ständig besetzt
und rief bei Bedarf ihren Mann bei Graeka an, damit er den Transport machen konnte.
Die Firma Graeka war damals schon so großzügig, Hoffmann den Lohn weiter zu zahlen,
solange er für das DRK unterwegs war. Gewiss eine noble Geste, wie ich meine.
Nach dem Willen der englischen Militärregierung musste also in allen
Städten unter 100.000 Einwohner eine ständig besetzte Wache eingerichtet
werden. Im Kreise Altena waren dieses die Stationen Werdohl, Altena,
Brügge, Meinerzhagen und Plettenberg. Alle Stationen wurden zunächst
mit vier Fahrern besetzt. Da keine Bestimmungen darüber erlassen worden
waren, wer die Stationen betreuen oder bezahlen sollte, wurden alle
Stationen zusammengefasst und bis zum Jahre 1948 als ein Privatunternehmen
in der Feuerwehr geführt.
Die technische Aufsicht hatte Kreisbrandmeister Kohlhage zusammen mit
seinem Stellvertreter W. G. aus Kierspe. In dem Betrieb des Kameraden
Goseberg wurde ein kleines Büro eingerichtet und ein schwerkriegsbeschädigter
Mann für alle Büroarbeiten und Abrechnungen mit den Krankenkassen eingestellt.
Erst im Jahre 1958 wurden diese fünf Stationen dann durch die Kreisverwaltung
unter OKD Feuring (Oberkreisdirektor) übernommen und alle Fahrer als
Krankentransportfahrer eingestellt.
Unser Anfang hier in diesem Gerätehaus war einfach trostlos. Ein Zimmer ohne
Tür und ohne Einrichtung war der Anfang. Da Kreisbrandmeister Kohlhage eine
Schreinerei und Zimmerei in der Ziegelstraße hatte, bekamen wir innerhalb zwei
Tagen eine Tür gemacht und begannen dann, das Zimmer einzurichten. Von der
"Organisation Todt" aus den Kahley-Baracken erhielten wir einen alten
Kohleofen, zwei Feldbetten ohne Matratzen aus dem Lazarett Königstraße
(Schule, später Gymnasium), und von der Firma Schade einen Stuhl, einen
Tisch und zwei hölzerne Doppelspinde sowie eine Werkbank mit Schraubstock.
Das war unser Anfang.
Das Feuerwehrgerätehaus selbst hatte Schäden durch den Beschuss in den
letzten Kriegstagen. Die Garagen waren größtenteils zerstört. Sie wurden
von uns "so nebenbei" wieder mit aufgebaut. Wie wir diese Arbeiten alle
erledigt haben - Tag und Nacht Reparaturen an den Fahrzeugen, jeden Tag
Reifen flicken usw. usw. - das ist heute kaum noch vorstellbar. Ich erinnere
mich noch, dass ich einmal montagmorgens zum Dienst gegangen bin und erst
am folgenden Samstagabend wieder nach Hause kam. Zu dieser Zeit sprach
keiner von Stundenplan oder regelmäßiger Arbeitszeit. Da wurde fest zugepackt,
um wenigstens immer einen Wagen einsatzbereit zu halten.
So gingen die Jahre mit viel Arbeit und Sorge für uns ins Land. Eine
allmähliche Besserung trat erst 1948 nach der Währungsreform ein. Wir
erhielten jetzt sporadisch mal einen neuen Wagen und auch Uniformen, so
dass man ab 1952/53 sagen konnte, wir haben die Sache im Griff und können
uns mit unseren Leistungen sehen lassen. Im Jahre 1955/56 wurden erstmals
von unserer Station mit zwei Fahrzeugen über 100.000 Kilometer im
Krankentransportdienst gefahren. Auf diese Leistung waren wir alle
besonders stolz, denn die anderen Stationen fuhren im Jahresdurchschnitt
nur die Hälfte.
Aber, wie das im Leben so ist, wir bekamen nichts geschenkt. Bis zum Jahre
1963 wurden wir als Krankentransportstation bei der Kreisverwaltung Altena
geführt. Im Laufe der Jahre waren aber unsere Arbeitsbedingungen beim
Kreis so schlecht geworden, dass wir uns Mitte 1962 entschlossen, zusammen
mit der Gewerkschaft ÖTV, gegen den Kreis bzw. Oberkreisdirektor Feuring
zu klagen. Arbeitszeiten von 84 und 96 Stunden wöchentlich waren normal,
zusätzlich mussten wir auf Anordnung des damaligen Kreisbrandmeisters
Peter Holthaus aus Dahlerbrück auch noch die Stationen Altena und Werdohl
während des Urlaubs oder bei Krankheitszeiten mitvertreten. In unserem
Kreisbrandmeister Holthaus hatten wir absolut keine Stütze, er machte uns
das Leben echt schwer.
Nach einer Ende 1962 mit dem OKD und dem KBM im Kreishaus Altena abgehaltenen
Sitzung konnten wir immerhin so viel erreichen, dass jeder Fahrer für das
Jahr 1962 eine Nachzahlung von 300 DM bekam. Mehr war also nicht drin. Und
um keinen weiteren Ärger mit den Stationen zu haben, schob uns der OKD dann
zum 1.1.1963 an die Städte und Gemeinden ab. Dagegen war gar nichts zu
machen. Das war im 1948 erschienenen Feuerschutzgesetz ausdrücklich festgelegt
worden.
Damit hatte sich der OKD die Sache recht einfach gemacht. Andrerseits waren
wir froh, zur Stadtverwaltung zu kommen, da wir in dem Glauben waren, dass
man vor Ort die Bedürfnisse der Feuerwehr besser würde beurteilen können als
aus der Ferne vom Kreishaus Altena aus. Aber weit gefehlt! Jetzt kamen wir
vom Regen in die Traufe, wie der Volksmund sagt. Die anderen vier Stationen
des Kreises wurden bei den jeweiligen Städten dann den Ordnungsämtern
zugewiesen, was sachlich sicherlich auch vollkommen richtig war. Nur hier
in Plettenberg da war so ein schlauer Beamter, der teilte uns dem Sozialamt
zu. Ich weiß heute noch nicht, wer diese Anordnung damals getroffen hat.
Der damalige Amtsleiter des Sozialamtes, Erich Lohmüller, hatte von den Erfordernissen und Notwendigkeiten
der Feuerwehr und speziell einer Krankentransport-Station keinen blassen
Schimmer. Er bemühte sich aber auch erst gar nicht, sich in die neue Materie
einzuarbeiten. In unzähligen Sitzungen haben wir versucht, zu einer guten
Zusammenarbeit zu kommen, leider nur mit negativem Erfolg. Wenn ich als
Stationsleiter mit noch ein oder zwei Kameraden zu einer Besprechung mit dem
Amtsleiter ging, kamen wir uns vor wie bettelnde Wohlfahrtsempfänger, die
nur Anweisungen entgegenzunehmen hatten und sonst nichts.
In diesen Jahr, das dürfen sie mir glauben, habe ich meine ersten grauen Haare
bekommen! Der einzige Beamte, welcher uns Verständnis entgegenbrachte, war
der damalige Stadtdirektor Lenjer. Mit ihm hatten wir nach Voranmeldung
und Bekanntgabe unserer Gesprächspunkte dann halbjährliche Besprechungen,
die immer zu unserer Zufriedenheit ausfielen und wo wir den Willen sahen, uns
aus unserer misslichen Lage herauszuhelfen. Ich erinnere mich, dass einmal
der Stadtdirektor keine Zeit für uns hatte und wir so mit Herrn Hiekel als
Vertreter im Amt sprechen mussten. Nachdem wir unsere Sorgen und Nöte
vorgetragen hatten, teilte uns Herr Hiekel mit, dass, wenn wir mit dem
bisher Erreichten nicht zufrieden wären, er für uns auf dem städtischen
Bauhof noch reichlich Arbeit habe! Diese Sitzung haben wir dann spontan
verlassen und uns geweigert, jemals wieder mit Herrn Hiekel zu verhandeln.
Die Feuerwehr war für ihn ein rotes Tuch! Ein notwendiges Übel, weiter
nichts.
Erst als im Jahre 1973 die Krankentransportstation zu einer Feuer- und
Rettungswache erweitert wurde, und die Übernahme zum Ordnungsamt geschah,
da war auf einmal alles möglich. Mir persönlich kam es vor, als hätten wir
nunmehr, nach all den langen Jahren, in denen wir "zerwaltet" aber nicht
verwaltet wurden, das große Los gezogen. Das Verständnis füreinander wuchs,
die gemeinsame Sorge um den weiteren gezielten Aufbau der Wache mit
qualifiziertem Personal, mit neuen technischen Einrichtungen, neuen
Fahrzeugen etc., ließ uns enger zueinander finden.
Die letzten 10 Jahre haben uns allen doch bewiesen, dass es auch anders
geht, vor allem aber dann, wenn alle zusammen ein großes Ziel zu erreichen
versuchen! Angefangen von Udo Heßmer, dem nunmehr die Leitung der Wache
übertragen wurde, über Gerd Kerber,Norbert Jahn, Werner Branscheidt und
nicht zuletzt bis zum Stadtdirektor Dr. Hans Wellmann waren sich alle
Verantwortlichen einig, schnell und unbürokratisch zu helfen, wollte man
auch in Zukunft gut ausgebildete und einsatzbereite Wachmannschaften zur
Verfügung haben.
Im Rückblick auf die letzten 10 Jahre muss ich sagen, dass das, was hier
investiert worden ist, sich schon lange bezahlt gemacht hat. Zu einem
Vergleich sollte man mal die Einsatzberichte heranziehen. Jeder, der
mit der Materie vertraut ist, weiß, was in diesen Jahren von der gesamten
Wachmannschaft geleistet worden ist. Ich persönlich möchte daher heute
dem Rat und der Verwaltung besonders für das Verständnis, welches uns
entgegengebracht wurde, herzlich danken. Dass dieses Miteinander nicht
immer selbstverständlich ist, zeigen die Querelen bei anderen Stationen
in unseren Nachbarstädten.
Allerdings - und hier muss ich warnend den Finger erheben - macht sich
im letzten halben Jahr wieder ein Gespenst der Furcht und Angst breit,
welches alles das, was in den letzten 10 Jahren gut gelaufen ist,
wieder zertreten möchte. Seid nicht stur und redet miteinander. Versucht
wenigstens, aus den Mißstimmigkeiten, die sich ergeben haben, in
Gesprächen einen rechten Weg zu finden, der für alle tragbar ist.
Am 27. Januar konnte ich mein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern (Dienstzeit
vom 27.01.1943 bis 31.12.1983, Arbeitszeit vom 01.06.1946 bis 31.12.1983).
In einer kleinen Feierstunde im Amtshaus überreichte mir Stadtdirektor Dr.
Wellmann die Ehrenurkunde. Nach Dienstschluss fand eine kleine Feier im
Gerätehaus statt, zu der ich alle Kameraden der Wache und alle Mitarbeiter
des Ordnungsamtes eingeladen hatte. Kamerad H. W. Klaucke würdigte in
einer kleinen Rede meine "Verdienste". Stadtbrandmeister Werner Branscheidt
fand ebenfalls lobende Worte für meine in 40-jährige Zugehörigkeit zur
Feuerwehr geleistete Arbeit. (Udo Heßmer war zu dieser Zeit in Urlaub)
Am 31.12.1983 endet meine Dienstzeit in der Feuer- und Rettungswache.
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass sich ein anderer Kamerad der Wache
finden wird, das nun einmal Begonnene weiterzuführen und für die
Nachwelt zu erhalten.
Plettenberg, im Dezember 1983 Helmut Groß
|