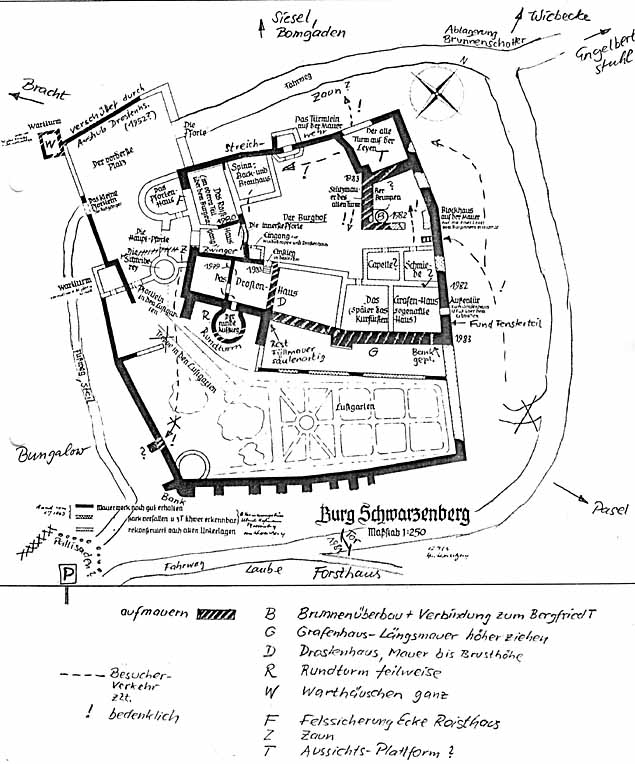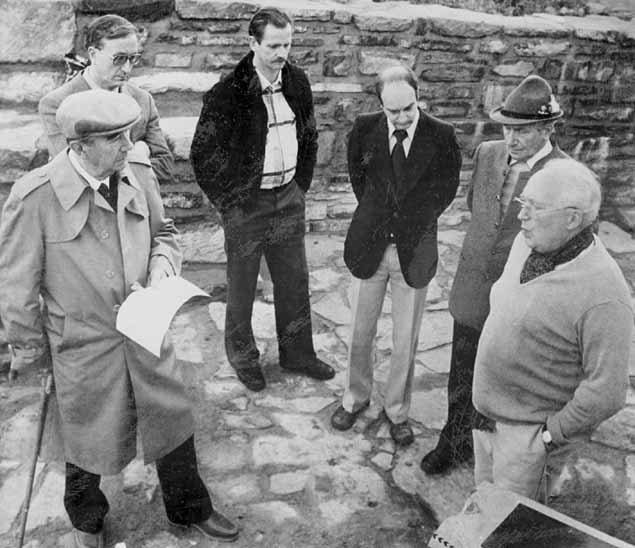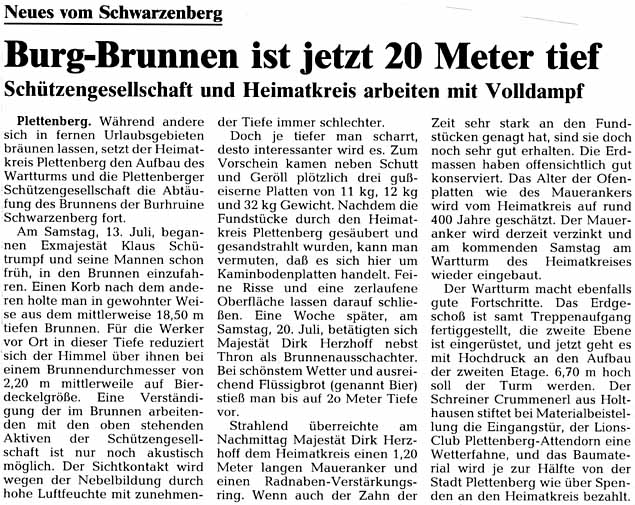|
100 Jahre Restaurierung der Burgruine Schwarzenberg
Quelle: ST vom 26.01.2010
Tido Freiherr zu Knyphausen ist tot
Die Verwaltung des Forstgutes Schwarzenberg in Plettenberg hat nun
der Sohn des verstorbenen Freiherrn übernommen. Felix Freiherr zu
Innhausen und Knyphausen kümmert sich neben der Verwaltung von Schloß
Bodelschwingh nun auch um die Familienbesitztümer in der Vier-Täler-Stadt.
Restaurierung der Ruine bisher fachgerecht
Plettenberg (HH). Wegen ihres Engagements und der fachlich richtigen
Sanierung des Mauerwerks der Burgruine Schwarzenberg konnten die "Freunde
der Burg Schwarzenberg" gestern Lob vom Landesamt für Denkmalpflege
einheimsen. Frau Dr. Isenberg war eigens aus Münster angereist, um die
Restaurierungsarbeiten der Stadt und des Freundeskreises zu begutachten.
Außerdem nahm die Restauratorin eine Baugrube in der Innenstadt in
Augenschein, wo Reste des ehemaligen Offenborn-Bachbettes freigelegt
worden sind.
An der Ortsbesichtigung nahmen gestern neben der Vertreterin des
Landesamtes für Denkmalpflege und Bodenfunde in Münster, Frau Dr.
Isenberg, der Vertreter der Stadt, Gotthard Keil, Ortsheimatpfleger
Horst Hassel und die Mitglieder des Heimatkreises, Horst Köster und
Volker Brüggemeier teil. Dr. Isenberg war nach Plettenberg gebeten
worden, weil im Rahmen der Restaurierungsarbeiten zahlreiche Funde
gemacht wurden, die es nun fachgerecht zu sichern galt. Alle bisher
von der Stadt und vom Freundeskreis vorgenommene Arbeiten wie
Verfugen des Mauerwerks und teilweiser Wiederaufbau umgestürzter
Mauern wurde begrüßt und in der Ausführung als fachgerecht bezeichnet.
Der Besuch aus Münster galt nicht zuletzt der Klärung, ob weitere
Mittel von Stadt, Kreis und Land für dringend notwendige weitere
Restaurierungsarbeiten "locker gemacht" werden können. Entsprechende
Zuschussanträge sollen, so Gotthard Keil von der Verwaltung der Stadt
Plettenberg, auch für 1981 wieder gestellt werden.
Quelle: ST vom 25.07.1985
Quelle: Urkundensammlung Kreisarchiv Altena, 15.05.1388, Köln, Sign. 190, Pergament, Siegel fehlt
Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, Band I, 1954, E. Dösseler,
hier: S. 15, Entwurf, Papier, St.A.D. Jülich-Berg I, 423, f 16
Schloß Schwarzenberg unter bergischer Hoheit:
1423, Sept. 12.
Ferner soll der Herzog unverzüglich als besonderen Proviant zur Aufbewahrung
im Turm für Notzeiten an Roggen 50 Malter, an Speck 50 Seiten, an Malz 50 Malter,
2 "wagen" Käse und 2 Faß Butter übersenden. Falls Wilh. hierzu zulegen müßte,
soll ihm der Landesherr den Zusatz ersetzen. Dieser Vertrag soll durch den
gegenseitigen Austausch von versiegelten Briefen bestätigt werden.
Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, Band I, 1954, E. Dösseler,
hier: S. 14, St.A.D. Jülich-Berg I, 423, f 10, Rest des rückwärts aufgedrehten S.
Uebergabe von Schwarzenberg und Lüdenscheid an Berg
1423, Apr. 15.
Quelle: Urk.-Nr. 966 Archiv Münster, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens (Dep.)
11.07.1564, Sign. 966
Quelle: Süderländer Tageblatt vom ??.??.19??
P. D. Frommann, Rektor i. R.
In Plettenbergs näherer Umgebung erinnern an zwei Stellen Trümmer auf
Bergeshöhen an längst verfallene Burgen, die Jahrhunderte lang für
unsere Vorfahren von allergrößter Bedeutung gewesen sind, an die
Hünenburg auf dem Sundern bei Ohle und die Grafenburg auf dem
Schwarzenberg. Über letztere sind viele Nachrichten erhalten geblieben,
auch Bilder, so dass man ihre Beschaffenheit und Geschichte deutlich
zu erkennen vermag.
Seitdem die Kölner Erzbischöfe 1180 die Herzogswürde und -rechte in
Westfalen erlangt hatten, suchten sie diese auch zu behaupten. Dadurch
gerieten sie in einen Gegensatz zu den Grafen, welche nach größerer
Selbständigkeit trachteten, die sie nur zum Schaden der herzoglichen
Rechte erwerben konnten. Das war due Ursache langwieriger erbitterter
Fehden. Gegen den Erzbischof Siegfried von Westerburg verbündeten sich
zweimal eine Reihe von Grafen und Herren des niederrheinischen Gebietes.
Das zweite Bündnis, an dem auch Graf Eberhard II. von Altena-Mark
beteiligt war, führte im Limburgischen Erbschaftskriege am 6. Juni 1288
zu der blutigen Schlacht bei Worringen, in der der streitbare Kirchenfürst
besiegt und gefangen genommen wurde. Das hatte eine Schwächung der
Herzogsgewalt zur Folge und trug wesentlich dazu bei, dass die Grafen
von der Mark in den Besitz der zwischen ihnen und ihrem Herzoge
strittigen
Rechte des Burgbaues und der Städtebefestigung
Der Bergkegel des Schwarzenberges
Die Erbauung der Burg erforderte hunderte fleißige Hände.
Zur Verteidigung der Burg wurden Burgmannen berufen,
1385 empfing Gerhard von Plettenberg, der Sohn des bekannten
märkischen Drosten gleichen Namens,
An der Spitze der Burgmannen
Drei Perioden in der 500-jährigen Geschichte der Burg Schwarzenberg
Am Ende des 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erlangten
die Grafen von der Mark von den Herren von Plettenberg im Kirchspiel
Plettenberg allerlei Güter und Rechte, unter anderem das Gericht zu
Plettenberg, Leute, Güter und Zehnten zu Landemert und die halbe
Mühle oberhalb Plettenbergs. Darum haben auch die märkischen Grafen
zeitweilig in der Burg Schwarzenberg gewohnt, wo sie die herrlichste
Gelegenheit zur Jagd in den ausgedehnten Markenwaldungen hatten.
. . .
Quelle: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Altena, A. Ludorff, 1911, S. 82 ff
Schwarzenberg
Sowohl Levold von Northof wie auch Gert von Schüren bezeugen übereinstimmend,
dass Rütger von Altena, der Droste des Grafen Eberhard II. von Altena, die
günstige Gelegenheit wahrnahm, als seines Herrn Widersacher, der Erzbischof
von Köln, und die drei anderen rheinischen Kurfürsten mit dem römischen
Könige Albrecht I. wegen der Rheinzölle in Streit waren, um die Veste Berg-Neustadt
und auf dem Schwarzenberge eine Burg zu erbauen (Quelle: Bei Northof heißt es:
Eodem anno (1301) guerra inter regem et praedictos archiepiscopos incipiente
moveri, Ruthgerus de Altena dapifer in die S. Servatii oppidum quod Nyestadt
vocatur, et in crastino (!) beati Remigii oppidum quod Nyestadt vocatur, et
in crastino (!) beati Remigii castrum Schwartenbergh construxit atque firmavit.
G. v. Schüren berichtet: In denselven Jaire (1300) stichden Albert, römische
Konink, Oirlog tegen die vier Koerfürsten up den Rhyn, umb die Tolle wille,
die hey afgelacht wollen hebben. In den Jair duysent CCCI up Sent Servatius
Dag begonde Rutger von Altenae, Drost des Greven van der Marcke, tho tymmern
die nye Stadt im Suyderland und daer des negsten Dages nac Sent Remigius Dag
begonde deselve Rutger to tymmeren dat Slott Swartenberg.). Von letzterer
scheint 1301 aber nur ein starker Bergfried errichtet worden zu sein.
1348 überwies Graf Engelbert III. dem Ritter Godharde van Hangensleide,
Hanxlede, ein Erbburglehen op unserm Hus thom Swartenburgh. Damals hatte
auch der Graf von Arnsberg auf demselben Berge noch ein Burghaus, das dem
Märker unbequem war. Wegen der Unbill, die Arnsberger Stegreifritter sich
gegen märkische Unterthanen erlaubt hatten, kam es 1352 zwischen Engelbert
und dem Grafen Gottfried IV. von Arnsberg zu einer hitzigen Fehde. Binnen
dissen Oirloge ward den Greven von Arnsberg sin Hus, dat he up dem Slotte
tom Swartenberch hadde, affgebraecken (In dieser Fehde wurde dem Grafen
von Arnsberg sein Haus, das er auf dem Schlosse Schwarzenberg hatte, abgebrochen).
Nun konnte der ganze Berg besetzt werden und Engelberts Droste, Gerd von
Plettenberg, säumte nicht, den ganzen für eine Burganlage so trefflich sich
eignenden Berg zu Gunsten seines Herrn 1353 zu befestigen. So entstand das feste
Bollwerk Schwarzenberg, auf dessen Besitz die Grafen von der Mark immer das
größte Gewicht gelegt haben.
1383 empfing Johann von Düdenscheid, genannt "der Stotterer", von Graf Engelbert
III. ein Burglehen am Schwarzenberg. Während des Krieges, der 1397 zwischen
dem Herzoge Wilhelm von Berg und den Grafen Dietrich und Adolf von der Mark
ausbrach und zu der für die Märker siegreichen Schlacht bei Cleve führte,
scheint Graf Eberhard von Limburg das Schloss Schwarzenberg besetzt zu haben.
Lange kann die Besetzung nicht gedauert haben.
Das feste Schloss auf dem Schwarzenberge bildete in damaliger Zeit einen sehr
schwer einnehmbaren Stützpunkt seiner Herrschaft für den Herrn der Grafschaft
Mark. 1411 tritt Graf Adolf IV. an seinen Bruder Gerhard des lieben Friedens
wegen u. a. auch das Schloss Schwarzenberg ab. Diese Abtretung wird für das
slait Swartenberge 1413 bestätigt. 1423 verschreibt Gerhard seinem Verbündeten
sogar gegen das Leben seines Bruders Adolf dem Jungherzog Ruprecht von Berg
eine Pfandschaft auf unse sloss to dem Swartzenberge, dessen Insasse, der
Drost aus dem Geschlecht von Plettenberg, jedenfalls mit dieser Wendung der
Dinge nicht einverstanden war; denn unter den ungehorsamen Untersassen, die
Gerhard noch in demselben Jahre zu bestrafen denkt, befindet sich der Herr
auf Schwarzenberg. Nach dem Tode des Jungherzogs gibt der Vater, Herzog
Adolf von Berg, 1433 die für ihn unbequeme Pfandschaft auf das slot Swartenberch
gegen eine bessere an Gerhard zurück.
Ein Burghaus am Schwarzenberge schenkte Graf Gerhard während seiner Herrschaft
der adligen Familie von der Mark, die es aber 1468 an Herzog Johann I. von
Cleve-Mark abtrat.
58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |
 Plettenberg. Wie die Heimatzeitung erst jetzt erfuhr, verstarb
Tido Freiherr zu Innhausen und Knyphausen im September letzten Jahres
im Alter von 71 Jahren nach längerem Krebsleiden. Der Schlossherr von
Schloss Bodelschwingh in Dortmund übernahm nach dem Tod von Elisabeth
Freifrau von Chappuis die Verwaltung des Forstgutes Schwarzenberg, zu
dem auch das Forsthaus Schwarzenberg und die Burgruine Schwarzenberg
zählen.
Plettenberg. Wie die Heimatzeitung erst jetzt erfuhr, verstarb
Tido Freiherr zu Innhausen und Knyphausen im September letzten Jahres
im Alter von 71 Jahren nach längerem Krebsleiden. Der Schlossherr von
Schloss Bodelschwingh in Dortmund übernahm nach dem Tod von Elisabeth
Freifrau von Chappuis die Verwaltung des Forstgutes Schwarzenberg, zu
dem auch das Forsthaus Schwarzenberg und die Burgruine Schwarzenberg
zählen.