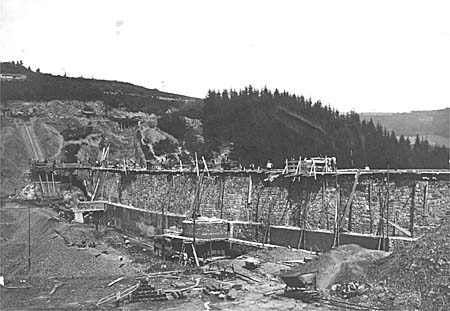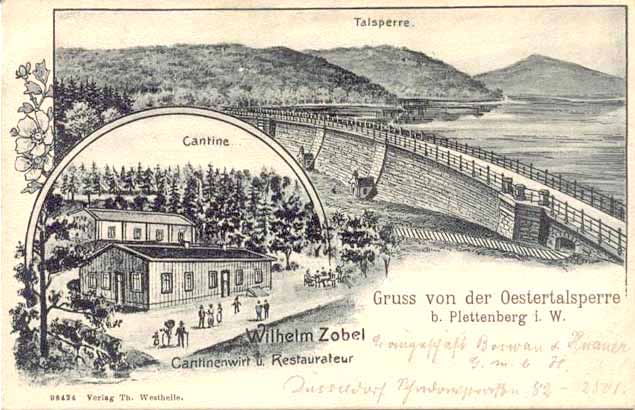(HH) Infolge der Sprengung der Mauer der Möhnetalsperre - durch den Abwurf von
Spezialtorpedos durch die englische Luftwaffe - in der Nacht vom 16. auf den
17. Mai 1943 wurden auch in Plettenberg Überlegungen angestellt, welche
Auswirkungen eine Bombardierung der Oestertalsperrenmauer auf das unterhalb
liegende Stadtgebiet haben würde. An der Lenne rechnete man mit einer Fluthöhe
von bis zu 4 Metern. Die Innenstadt wäre also völlig überflutet, die meist aus
Holzfachwerk und Lehm gebauten Häuser komplett weggeschwemmt worden. Obwohl
die Flutwelle sicherlich alles mitgerissen hätte, glaubte man, das Wehr der Firma
Brockhaus-Söhne könnte ein Hindernis sein. Deshalb prüfte man, welche Stellung
der Schütze des Wehres - Schütze unten, halb gezogen, Schütz hochgezogen - den
Wassermassen und dem Treibgut den geringsten Widerstand bieten würde.
Hier ein Auszug aus einer der damaligen Überlegungen:
Abschrift, Plettenberg, den 31. Mai 1943, Signatur C I 1698
(drei Seiten, A 4 maschinengeschrieben, Archiv Dirk Thomee)
Niederschrift über die Beobachtungen bei der Öffnung des Wehres der Firma
Brockhaus Söhne in Plettenberg-Bhf. zur Verhütung von Hochwasserkatastrophen.
Auf Veranlassung des Bürgermeisters der Stadt Plettenberg wurde
mit dem Inhaber der Firma Brockhaus Söhne, Herrn Brockhaus, vereinbart, dass
am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr das Schützenwehr gezogen und festgestellt
werden soll, wie sich das Wasser unterhalb des Wehres auswirkt und in welcher
Zeit das Heben der Schütze erfolgen kann, um bei einer Talsperrenkatastrophe
das Öffnen der Schütze schnell und sicher zu ermöglichen.
Es waren erschienen:
1) Für die Behörde: Bürgermeister Brüggemann, Stadtbaumeister Schulte,
Polizeileutnant Merz
2) Für die Firma: Fabrikant Hermann Brockhaus, Elektro-Inst. Köster,
Turbinenwärter May
sowie 24 Mann des Einsatztrupps der TN [Technische Nothilfe] mit dem
Standortführer Kalheber.
Zur Klarlegung der Verhältnisse wird voerst folgendes erwähnt:
Das Wehr der Firma Brockhaus Söhne in Plettenberg-Bhf. besteht aus
6 Flutöffnungen und zwar von links nach rechts gezählt:
Öffnung 1 und 2 je 6,00 Meter breit mit einer Sohle auf 201,50 Meter über NN;
Öffnung 3 und 4 je 12,00 Meter breit mit einer Sohle auf 200,20 Meter über NN;
Öffnung 5 ist 6,00 Meter breit mit einer Sohle auf 200,20 Meter über NN;
Öffnung 6 ist 6,00 Meter breit mit einer Sohle auf 201,50 über NN.
Ob. Kante Wehr liegt auf 203,14 NN. Demnach sind die mittleren Schütze 1,30 Meter
höher als die äußeren. Die Schütze 3, 4 und 5 können vom Werk aus durch den mittels
Turbinen erzeugten Strom elektrisch gehoben werden, während die übrigen mit der
Hand hochgedreht werden müssen.
Die Mannschaft der TN wurde auf die einzelnen Wehröffnungen zum Hochdrehen der
Schütze verteilt. Um 17.15 Uhr wurde vom Wehr aus dem Turbinenwärter ein Signal
zum Einsetzen des Motors gegeben, der die Schütze 3, 4 und 5 hochdreht. Zur
gleichen Zeit begann die Mannschaft die drei Seitenschütze hochzudrehen. Nach
5 Minuten Drehzeit waren die mittleren großen Schütze flutfrei. Nach 8 1/2
Minuten setzte bereits die Turbine und damit der Motor aus. Die elektrisch
gehobenen Schütze waren aber erst bis zur Hälfte hochgedreht.
Um 17.27 Uhr, also nach 12 Minuten, war das Stauwasser abgelaufen. Die Mannschaften
mussten nun mit einer Handkurbel die Schütze hochdrehen.
Beim Ansetzen der Kurbel stellte sich heraus, dass die Kurbel nicht herumgedreht
werden konnte, weil eine eiserne Schutzklappe des Getriebes hinderte. Nach der
Beseitigung des Hindernisses wurde beim Drehen des Schützes 3 festgestellt,
dass die Kupplung mit dem elektrischen Antrieb nicht gelöst werden konnte, ferner
dass die Auskupplungsstange beim Drehen der Kurbel hinderlich ist.
Mit allen Kräften versuchte die Mannschaft die mittleren Schütze hochzudrehen.
Trotz aller Anstrengungen war [k]eine Hubleistung feststellbar. Ein weiteres Übel
wurde darin erblickt, dass der Griff der Kurbelstange nur so lang war, dass eben
drei Fäuste anfassen konnten, nicht aber 4 oder 5. Die Aussparung des Betons für
die Kurbel war zu eng, um beim Drehen die ganze Kubellänge ausnutzen zu können.
Um 17.35 Uhr waren die Schütze 2, 5 und 6 hochgedreht, also innerhalb 20 Minuten.
Das Schütz 1 war so schwer zu drehen, dass ein volles Heben nicht erfolgte.
Nachdem festgestellt wurde, dass das Hochdrehen der großen Schütze nur sehr langsam
und mit großer Kraftanstrengung möglich war, musste von dem weiteren Heben abgesehen
werden.
Der Stadtbaumeister hatte Veranlassung genommen, die Flut bei den Wehren des Ohler
Eisenwerkes in Ohle und in Elhausen beobachten zu lassen. Die erste Welle überfloss
das Wehr in Ohle, das ca. 1.300 Meter unterhalb liegt, nach 7 Minuten und erreichte
nach 12 Minuten den höchsten Stand von 0,30 Meter Wehrüberflutung.
Die erste Welle wurde nach 17 Minuten am Wehr in Elhausen, dass ca. 4.000 Meter
unterhalb des Wehres Brockhaus liegt, beobachtet. Der Wasserstand erhob sich dort
nur noch um 2 Zentimeter. Die gesamte Wassermenge des Staus Brockhaus wird auf
ungefähr 20.000 Kubikmeter geschätzt.
Bei einer Talsperrenkatastrophe würde von der Oestersperre die erste Welle
vielleicht in 12 bis 15 Minuten und von der Listersperre vielleicht in 60 bis
70 Minuten am Wehr Brockhaus sein. In dieser Zeit muss das ganze Wehr geöffnet
sein, um nicht für die Ortsteile Böddinghausen und Bredde noch eine weit
größere Gefahr zu verursachen als schon besteht. Wenn die Schütze bis zum
Höchststand gezogen sind, liegt die unterkante auf 204,68 über NN, also ist
nur in der Mitte eine Fluttiefe von 4,48 Meter vorhanden.
Die Beobachtungen beim Hochwasser im November 1940 haben gezeigt, dass die
Flut die Schütze ca. 10 bis 15 Zentimeter hoch berührten, so dass bei einer
Talsperrenkatastrophe mit einem höherem Wasser ein Rückstau immer erfolgt
und dadurch eine ernste Bedrohung der anliegenden Wohnstätten und Werke
eintritt.
Es muss deshalb dafür gesorgt werden, dass wenigstens das Wehr bei der
Ankunft der Flut hoch ist, damit die Auswirkungen auf das geringste Maß
herabgesetzt werden.
Der Stadtbaumeister brachte in Vorschlag, das Heben der Schütze durch
elektrischen Strom erfolgen zu lassen und zwar derart, dass, wenn die
Turbinenkraft versagt, ein durch Akkumulatoren-Batterie gespeister Motor
unabhängig vom Werk das Heben fortsetzt.
Ein weiterer Vorschlag, einen Benzinmotor anzubringen, wurde erörtert. Bei
letzterem wurden hinsichtlich der Beschaffung von Brennstoff und der
Betriebssicherheit Bedenken erhoben.
Herr Brockhaus brachte zum Schluss der Übung zum Ausdruck, dass er bemüht
sein wolle, auf dem schnellsten Wege die ihm bisher unbekannten Mängel
beseitigen zu lassen. Zur weiteren Untersuchung der Möglichkeiten, die
Schütze elektrisch oder auf eine andere selbsttätige Art und Weise zu heben,
soll das erforderliche sofort veranlasst werden.
Abschrift - Plettenberg, 15.6.1943 (eine Seite, A 4 maschinengeschrieben, Archiv Dirk Thomee)
Was, wenn die Oestertalsperrenmauer bricht?
Auswirkung der Wehranlage Brockhaus-Söhne bei einer Hochwasserkatastrophe
Zu der Frage, ob das Heben der Schütze des Wehres der Firma Brockhaus-Söhne
in Plettenberg-Bhf. überhaupt ratsam ist, wenn das Heben nur bis zur halben
Höhe erfolgen kann, wird wie folgt Stellung genommen:
Kommt die Flutwelle von der Oestertalsperre, die durch das starke Gefälle
und die geringe Durchflussbreite des Tales eine sehr große Geschwindigkeit
haben wird, in einer Höhe bis zu 4 Meter an, tritt bei einem vollkommen
geöffneten Wehr vermutlich kein wesentlicher Rückstau durch das Wehr ein,
weil die Hauptschütze 4,48 Meter höher als die Sohle stehen.
Anders ist es jedoch, wenn die Schütze nur bis zur halben Höhe gezogen werden.
Eine Flutwelle von 4 Meter Höhe wird dann um die Höhe der Schütze höher
gestaut, so dass die Flut sofort die Dämme überströmt. Ferner werden sich die
Schwimmstoffe, Balken, Bretter, Bäume usw. wahrscheinlich sofort am Wehr
festsetzen. In einem derartigen Fall ist es zweckmäßig, die Schütze überhaupt
nicht zu ziehen. Die Gefahr des Festsetzens der Schwimmstoffe ist dann nicht
so groß. Es tritt jedoch ein größerer Stau ein.
Wenn jedoch eine noch weit höhere Flutwelle am Wehr ankommt, wird das Wehr
ein gewaltiges Hindernis bilden, das eine gewaltige zerstörende Überflutung
der anliegenden Ortsteile verursacht. Sind dann die Schütze ganz hochgezogen,
wird durch den Wasserdruck eine wesentlich größere Menge Wasser abgeführt
werden können. Die Überschwemmung ist jedenfalls geringer. Die Schütze in
halber Höhe werden vermutlich das größte Hindernis darstellen.
Stadtbaumeister



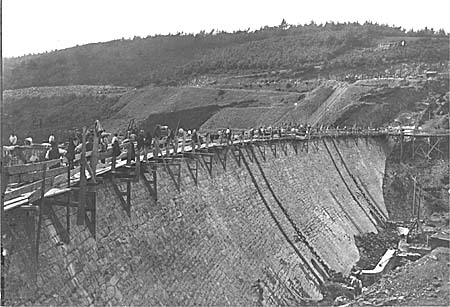 Im Juni 1906 werden immer neue Tagesrekorde bei der Verarbeitung von
Mauerwerk gemeldet. Die Sperrmauer wächst rasant.
Im Juni 1906 werden immer neue Tagesrekorde bei der Verarbeitung von
Mauerwerk gemeldet. Die Sperrmauer wächst rasant.