|
Quelle: SÜDERLAND - HEIMATLAND, heimatkundliche Beilage zum Süderländer
Tageblatt, Nr. 75, Samstag, 08. April 1978 - Autor: Horst Hassel
Am 23. März 1903 wurde die Baugenehmigung erteilt
Plettenberg. In diesem Jahr kann das 75jährige Bestehen der Oestertalsperre
gefeiert werden. Die Entwicklung hat gezeigt, daß der Wille der Erbauer "Zum Segen
für das Oestertaler Land" sich erfüllt hat. Aus diesem Grund ist ein kleiner Rückblick
sicher angebracht.
Zwei neuzeitliche Einrichtungen, die Eisenbahn und die Ausnutzung des Wassergefälles
zur Erzeugung von elektrischem Strom, machten deutlich, daß die Wasserkraft als
Antriebskraft zum wichtigen Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region
werden kann. Deshalb überlegten die Herren Ernst und Paul Brockhaus in Himmelmert
schon zu Beginn der 90er Jahre, wie man durch die Anlage eines Staubeckens im Ebbetal
die Ausnutzung der Wasserkraft verbessern könnte. Bei großer Trockenheit kamen die
am Oesterbach gelegenen Fabriken oft in arge Verlegenheit, und wenn im Herbst oder
Frühjahr große Wassermassen zu Tal stürzten, bangten die Wasserwerkbesitzer um ihre
Anlagen.
Als man im Jahre 1895 den Bau der Eisenbahn unter dem Namen "Plettenberger Kleinbahn"
in Plettenberg beschloß und diese auch bald darauf gebaut wird, forcieren die beiden
Brockhäuser ihre Bemühungen um ein Staubecken.
Eine Talsperre oberhalb Himmelmert
Alle wollen die Baukosten tragen |
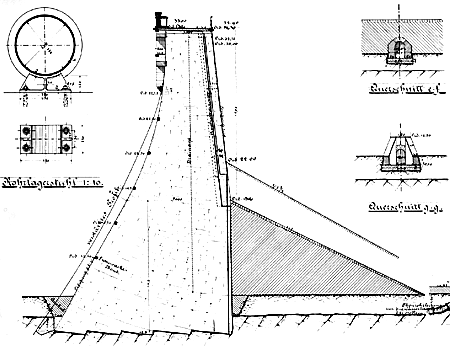 Original-Pläne für den Bau einer Talsperre im Ebbecketal |
Wie das "Süderländer Wochenblatt" in seiner Ausgabe vom 8. Februar schreibt, scheint 1896 die "Frage einer Thalsperre nun einer Lösung nahe geführt". Die Zahl der anwesenden Wasserwerksbesitzer entsprach etwa 80 Prozent der die Wasserkraft des Oesterbaches nutzenden Fabrikbesitzer. Sie beschlossen zunächst die zur Bildung einer Wassergenossen- schaft notwendigen Unterlagen nämlich: genaue Projektzeich- nungen, ein tabellarisches Verzeichnis des Wasserver- brauches und des Gefälles der einzelnen Werke, Unter- suchungsergebnisse des erforderlichen Steinmaterials usw. zu beschaffen. Die dafür aufzuwendenden Kosten beschloß man gemeinsam aufzubringen. |
|
Die Fabrikanten W. Kissing, Karl Mylaeus und Paul Brockhaus wurden einstimmig als
Mitglieder eines provisorischen Vorstandes gewählt. Paul Brockhaus übertrug man die
Aufgabe, die notwendigen Korrespondenzen und die Einleitung der Verhandlungen mit
den in Frage kommenden Persönlichkeiten zu führen.
Als wesentliches Moment für das Zustandekommen des Projektes sah man 1896 eine
Weiterführung der im Bau befindlichen Schmalspurbahn bis ins Oestertal. Die
Beförderung der außer Steinen zum Verbauen (rund 20.000 cbm Mauerwerk) notwendigen
Materialien sei per Achse (Pferdefuhrwerk) wohl zu teuer und könne nur per Schiene
durchgeführt werden. Die Bahn hätte andererseits durch die Beförderung dieser
Massengüter zunächst eine hohe Einnahme und würde nach Fertigstellung der Talsperre,
infolge des dadurch bestimmt zu erwartenden Aufschwunges der Industrie im Oestertal,
auch in Zukunft gute Ergebnisse erzielen.
Ein Telegramm des Prof. Intze aus Aachen vom 14. November 1899 besagt: "Drei Millionen Stauinhalt Oestertaler kostet 1,1 Millionen Mark - stop - 2,5 Millionen cbm Inhalt 920.000 Goldmark - stop - Brief unterwegs - stop - Entscheidung wie groß Sie wünschen - stop - morgen erwünscht - stop - da Dienstag Sitzung des Vorstandes - stop - Intze." Die Antwort lautete: "Wollen an 3 Millionen festhalten - stop - Brief unterwegs - stop - Brockhaus." Im gleichen Jahr 1903, in dem auch die Verlängerung der Kleinbahn bis ins Oestertal fertiggestellt wurde, erhielt die Genossenschaft die Baugenehmigung zur Anlage der Talsperre.
Die Baugenehmigung ist erteilt
1. Die Bauausführung der Sperrmauer muß unter technischer Aufsicht des Staates
erfolgen. Die Ansetzung der Fundamente darf erst erfolgen, nachdem das tragende
Felsgestein durch meinen technischen Referenten geprüft und für einwandfrei befunden
worden ist. Nach Erhalt der Baugenehmigung traten die Mitglieder der Oestertalsperrengenossenschaft am 23. April 1903 zur ersten Hauptversammlung in Plettenberg zusammen. In Erledigung der Tagesordnung wurde durch Zuruf der Vorstand gewählt. Es waren dies: 1. Vorsitzender Paul Brockhaus, als Beisitzer die Herren Carl Reinländer, Wilhelm Allhoff, Wilhelm Niggemann, Ernst Hanebeck (alle Plettenberg). Stellvertreter dieser Beisitzer wurden Karl Mylaeus jr., P. W. Fischer, Julius Brockhaus und Fritz Rump (Altena). Das Protokoll unterschrieben außer den Vorgenannten: Wilhelm Damm, Franz Meyer, Fr. Hammerschmidt und C. Kaiser. Das Protokoll schloß mit der Unterschrift des königlichen Landrates Thomee als Kommissar des Regierungspräsidenten in Arnsberg.
 Am 4. April 1905 hatte man mit den Gründungsarbeiten für die Oestersperrmauer begonnen.
|