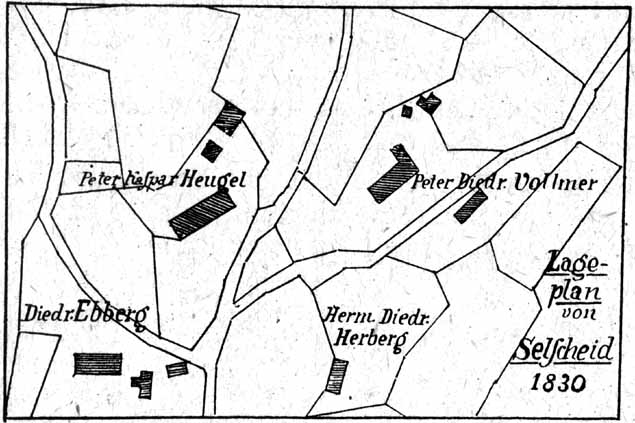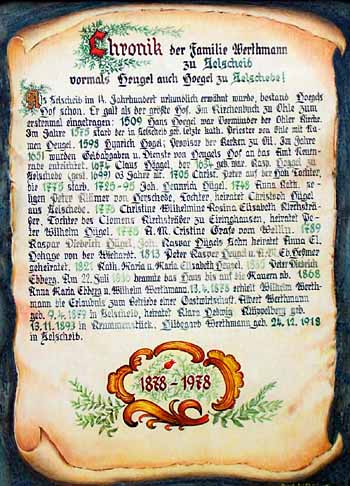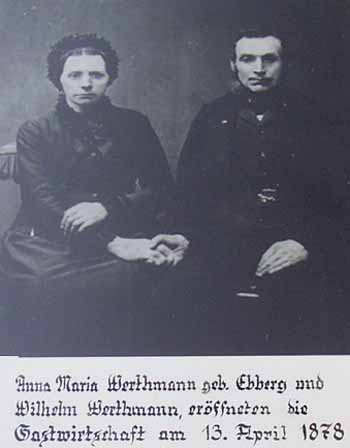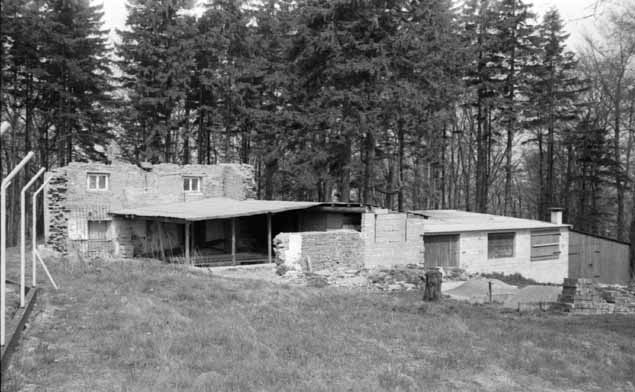Selscheid
Quelle: "Von der Hünenburg auf dem Sundern bei Ohle und ländlichen
Siedlungen in ihrer Umgebung", von P. D. Frommann, Weihnachten 1949, S.74 ff.
Erläuterung: E = Erbe K = Kauf FK = Feuerkasse
Das nur aus wenigen Häusern bestehende Selscheid liegt 370 Meter
über dem Spiegel der Nordsee in einer Einsattelung zwischen dem
früher Ebberg genannten Sohlberge und dem Hasenberge. Weil der
Verkehr von jeher diese Einsenkung bevorzugte, so bildete letztere
eine Art Durchlass oder Sielen, worauf der Stamm "Sel" in dem
Namen der Siedlung hinweist, während die Endung "scheid" von dem
hohen Alter derselben zeugt.
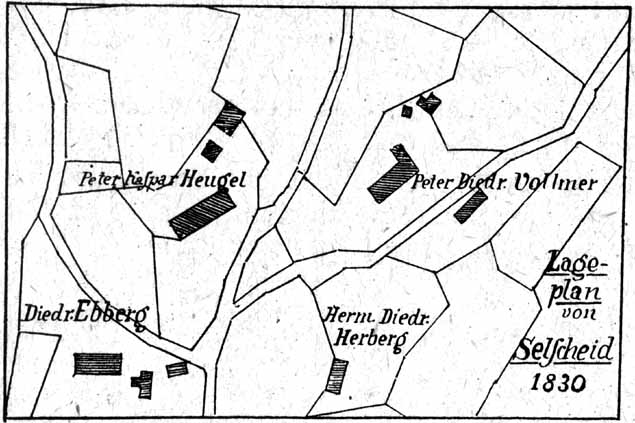
Urkundlich erwähnt ist Selscheid im 14. Jahrhundert. Es war damals
ein Teil der Grafschaft Arnsberg, und deren Grafen hatten den Johannes
de Wesselberg mit dem Zehnten zu Selscheid und Grimminghausen belehnt.
Zu der Zeit gab es in Selscheid vier Bauerngüter. Als Haupthof galt
anscheinend der größte, der von den andern umrahmte Hoegels Hof.
Das Obereigentumsrecht an den Selscheider Gütern war später versplittert.
1474 verfügte über Heugels Hof der aus Plettenberg gebürtige Heinrich
Steynhoff, Probst zu Worms und Kanonikus an der Kirche der hl. Apostel
zu Köln; er wies die 4 rheinische Gulden betragenden Einkünfte aus dem
Hofe der von ihm damals an der Kirche zu Plettenberg gegründeten Neuen
Kapelle zu, und zwar zum Unterhalt des Vikars an derselben. In den
folgenden Jahrhunderten bezog die Kirchengemeinde zu Plettenberg
aus dem Gute 7 1/2 Rtlr., 1 Schuldschwein im Werte von 2 Rtlr. und vier
Hühner, jedes mit 3 Stübern berechnet.
1639 war der Erbpächter mit seinen Abgaben arg im Rückstande. "Sämtliche
Geistliche, Kirchen- und Schuldiener zu Plettenberg" berichteten über
ihn an die kurfürstliche Regierung: "Der Pächter ist allezeit ein fleißiger
Mann gewesen und hat wohl bezahlet. Er ist aber zu hoch belastet und
nun in Rückstand geraten." Wenn er nicht auf den dritten Teil seiner
bisherigen Schatzung (seiner Steuern) gesetzet werde, wolle er das Gut
quittieren. Sie baten, ihn auf ein Drittel zu setzen. Heugels Gut blieb
in Abhängigkeit von der Plettenberger Kirchengemeinde, bis Peter Kaspar
Heugel es 1813 für 1650 Franken loskaufte.
Der in Frilentrop wohnende Johann v. Ole trat sein Anrecht an dem Gut
1556 an seinen Vetter Christoph von Plettenberg zu Schwarzenberg ab
gegen ein ihm bequemer liegendes Gut in Frilentrop. Die von Ohle
besaßen eine Zeitlang das Obereigentumsrecht an demselben.
Das zweitgrößte Selscheider Gut war das Ebbergs Gut, das seinen Namen
von seiner Lage am Fuß des Ebberg hat. Die Gutsinhaber scheinen im
16. Jahrhundert recht wohlhabend gewesen zu sein; denn Johann Ebberch
lieh Kaspar Rump zu Grimminghausen 34 Rtlr. gegen Verpfändung eines
ihm gehörenden Landes bei Selscheid. - Vollmers Gut war zehntpflichtig
nach Grimminghausen.
1642 hatte jedes der vier Güter ein Viertel Messehafer an die Ohler
Kirche zu liefern. 1651 wurden folgende Geldabgaben und Dienste für
das Amt in Neuenrade vereinbart:
| |
Rtlr. |
Stbr. |
Lenzdienste |
Herbstdienste |
| Heugell |
1 |
16 |
1 |
1 |
| Ebberich |
1 |
5 |
1 |
1 |
| Volmars Johan |
0 |
37 |
0 |
0 |
| Hendrick under der Eicke |
0 |
22 |
2 |
0 |
Daß Vollmer nicht zu Diensten verpflichtet war, kam daher, daß sein Besitztum
mit Abgaben nach Grimminghausen belastet war. Die Adeligen hatten schon im
16. Jahrhundert Befreiung von Diensten gegnüber den Amtleuten für die von
ihnen abhängigen Bauernhöfe. Diese Aufstellung ist auch unterschrieben worden
von "Volmar, Ebberich, Jasper Heugell".
Über die Größe und Ertragsfähigkeit der einzelnen Selscheider Güter gibt
nachstehende Übersicht aus dem Jahre 1705 Auskunft.
| |
Malterscheid
Land |
Fuder Heu |
Pacht Rtlr. |
Pacht Stbr. |
Kontribution
Rtlr. |
| Diederich Ebberg |
18 |
6 |
18 |
30 |
30 |
| Christoph Heugel |
24 |
6 |
9 |
45 |
36 |
| Rötger u. der Eichen |
5 |
0 |
7 |
30 |
9 |
| Johan Volmers |
10 |
2 |
12 |
41 1/2 |
15 |
Zu der Zeit scheint auch Rötger unter der Eiche Pacht, und zwar nach
Grimminghausen entrichtet zu haben. - Als man die Herscheider Mark aufteilte,
etwa 1777, wurden Hoegel und Ebberg zu den Bauern, Vollmer zu den
Halbbauern und Eickesmann zu den Köttern gerechnet.
Selscheid hatte 1765 nur 35 Einwohner, die sich auf fünf Familien in folgender
Weise verteilten:
| |
Peter Henr.
Ebberich |
Kaspar
Heugel |
Diederich
Volmersmann |
Diederich
Eickesmann |
Andreas
Wolf |
| Personen unter 12 J. |
1 |
3 |
4 |
0 |
0 |
| Personen über 60 J. |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
| Personen überhaupt |
8 |
9 |
11 |
4 |
3 |
| Mägde |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Knechte |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| Töchter |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
| Söhne |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
| Verwandte |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
| Frauen |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
| Männer |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Selscheid musste damals sein Getreide in der staatlichen Mühle zu Versevörde
mahlen lassen.
Der letzte katholische Priester in Ohle starb 1575, war gebürtig aus Selscheid
und hieß Heugel. Weil die Ohler Gemeinde zu seinem Nachfolger den lutherischen
Vikar Peter Geck zu Herscheid berief, so muss sich die Gemeinde schon zu
Heugels Zeit der Reformation zugewandt haben. Nicht selten wurden Selscheider
Landwirte in den Vorstand ihrer Kirchengemeinde berufen. Als Kirchmeister,
Provisoren oder Vormünder sind erwähnt: 1509 Hans Högel, 1522 Hermann Ebberch
zu Selsche, 1599 und später Hynrich Hogell, 1768 Joh. Hügel. Andere waren als
Gemeinderäte tätig, wie Pet. Diedr. Vollmer 1844 bis 1863.
Der 1618 geborene Clemens Pieper, dessen Vater unter der Eiche zu Selscheid
wohnte, war erst Jäger und Fischer zu Pungelscheid und später kurfürstlicher
Frone zu Altena. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlernten vier
Selscheider Knaben das Tuchmacher-Handwerk in Plettenberg, darunter zwei Brüder
Middendorf.
Im vorigen Jahrhundert brannten zwei Selscheider Häuser bis auf die Grundmauern
ab, und zwar am 25. Januar 1826 Vollmers und am 22. Juli 1836 Hügels Haus. -
1878 erhielt Wilhelm Werthmann die Erlaubnis zum Betriebe einer Gastwirtschaft.
Die wiederholten Bemühungen der Bewohner von Selscheid und Umgebung zwecks
Erlangung einer Bauerschaftsschule hatten zur Folge, dass am 6. Januar 1919 in
dem duch einige Zimmer erweiterten "Spieker" auf Vollmers Gute die Schule mit
11 Knaben und 16 Mädchen, die bis dahin in Ohle eingeschult gewesen waren,
durch den von Bremcke nach Selscheid versetzten Lehrer Karl Büscher eröffnet
werden konnte.
In den letzten Jahrzehnten sind den Selscheidern mehrere vorteilhafte Neuerungen
zuteil geworden: 1928 erhielten sie eine bessere Verbindung mit Ohle durch eine
neue, allmählich steigende Straße, 1930 eine Wasserleitung und 1937 ein neues
Schulhaus mit Lehrerwohnung. Die Schule ist gegenüber dem 1932 auf dem alten
Ebbergschen Gute errichteten, aus Wohnhaus mit angefügtem Stall- und Wirtschaftsgebäude
bestehenden Neubau, vorn am Wege nach Grimminghausen erbaut und am 15. Juli 1937
bezogen worden. Ebbergs Hof ist seit 1835 in das "alte" und "neue" Ebbergs Gut
geteilt, und das alte Ebbergs Haus hat man nach 1932 abgebrochen.
Heugel zu Selscheid
1509 Hans Hoegel war Vormünder der Ohler Kirche
1598 Hynrich Hogell, Provisor der Kercken zu Oil
1674 Claes Höggel, der 1634 geboren war
1813 Pet. Kasp. Heugel und A. M. Elisabeth Heßmer
1821 Kath. Maria und Maria Elisabeth Heugel
1835 Pet. Diedr. Ebberg
22.07.1836 brennt Hügels Haus bis auf die Grundmauern ab.
1868 Anna Maria Ebberg und Wilhelm Werthmann
1979 Inschrift im Fachwerk des Gasthofes Werthmann:
ANNO 1748 HANS HINDERICH HENGEL UND LASEN X ANDRES WNLF
BANMEISTER BERG UND HNCEI DES HERIN PASALEM 48
Schuldverschreibung des Christopff Höggel zu Selscheid
Quelle: Ev. Kirchenarchiv Ohle, Bemerkungen zur Kirchenrechnung von 1797.
17.15, Febr. 17 - Nr. 146
Christopff Höggel (Heugel) und Ehefrau Anna Cath. bekunden, dass
die Kirche zu Ohle ihnen aus "unvermeidlicher notturfft" 20 Rtl.
vorschoss, wofür jährlich auf St. Petri ad cathedram 1 Rtl.
gewöhnliche Pension zu zahlen ist. Die Auszahlung der 20 Rtl.
sei durch den Kirchmeister Joh. zu Erkelse bar und richtig erfolgt.
Zur Sicherheit verschreiben die Schuldner ihre Bestialien, Pferde,
Kühe usw. als Unterpfand. Eintragung der Obligation in das
Kirchenregister in Gegenwart des Pastors Joh. Hengstenberg, des
Kirchmeisters Joh. zu Erkelse und der Vorsteher Joh. auf der Wort
und Peter zu Elhausen.
Ende April 1927 stirbt Landwirt Fritz Hügel, und damit der letzte
männliche Nachkomme der Familie Hügel, vom "Nien Ebbes Hof"
(neuen Ebberg-Hof)
Unter der Eiche zu Selscheid
(wohnten)
1539 vermutlich Johann Dunker, der aus Neuenrade stammte und
ein Bruder des 1577 als "Scholmester zu Ohel" erwähnten Clemens Dunker war
1598 Dyrich under der Eych
1630 Pieper, der Vater des Altenaer Fronen Clemens Pieper
1642 vielleicht Henrich Volmer
1791 war Besitzer Joh. Pet. Ebberg
1813 Joh. Diedr. Ebberg
1815 Gebr. Herberg
1843 Pet. Diedr. Ebberg
1844 Diedr. Wilh. Holthaus
dann Kasp. Holthaus
Ebberg zu Selscheid
1522 Herm. Ebberch, Vormünder der Kirche zu Ohle
1532 Hans Ebberch, der Rump in Grimminghausen gegen Verpfändung
eines Landes bei Selscheid 34 Rtlr. lieh
1556 Herm. Ebberch
1572 Joh. Ebberch
1598 Herm. Ebberch
1698 Diedr. Wilh. im Neuenhause zu Pungelscheid, ∞Mrg. Ebberg in Selscheid
1708 Joh. Rötg. Ebberg zu Selscheid, ∞Else. M., des Wilh. auf
dem Hofe zu Werdohl Tochter
1629-1705 Diedr. Ebberg, †1715 die alte Ebbersche im Alter von 72 Jahren
1664-1727 Joh. Ebberg; seine Fraue Christine (1645-1717)
1763-1819 Pet. Kasp. Ebberg, der Bruder und Knecht Diedr. Wilhelms,
hatte zwei Kinder; sein Sohn Pet. Diedr. Ebberg bekam ein Teil des Gutes,
das 1835 geteilt wurde; er ∞1837 A. M. vom Hofe von Heerwiese.
Vollmer zu Selscheid
(auf Vollmers Gute lebten)
1595 Lambertes Volmar
1598 Lambertes Volmar
1642 Volmers Johann
1650-1710 Johann Vollmers und seine Frau Else
1682-1757 Joh. Diedrich Vollmersmann
1727-1798 Joh. Diedrich Volmers
1756-1823 Peter Wilhelm Volmers
1794-1863 Peter Diedrich Vollmer
25.01.1826 Vollmers Haus brennt bis auf die Grundmauern ab.
1838 kaufte Pet. Diedr. Vollmer für 1950 Tlr. Grundstücke
und das halbe Haus von Heugels Gut. Bei Selscheid entstand die
neue Siedelung.
Zu den Eigenhörigen des Hauses Brüninghausen gehörte 1570 ein "Lammert tho Selsschede"
(Quelle: Adelsarchiv v. Werde-Amecke, Nr. 171, 12. April 1570)
Quelle: Heimatblätter des mittleren Lennegebietes 1928, S. 92:
Von den Selscheider Gütern hat Volmers Gut wohl die günstigste Entwicklung
durchgemacht. 1695 lebte Johann Volmers in mißlichen Verhältnissen; denn
er bekannte am 15.06.1695 urkundlich auf dem Hause Grimminghausen: "Ich
bezeuge Kraft dieses, daß ich von rückständigem Zehendkorn an den Herrn
von Mascherel richtig berechneter Schuld annoch schuldig geblieben nach
geschehenem Nachlass 8 Rtlr. Verspreche solche in Jahresfrist richtig zu
bezahlen, bei Fehlens dessen hernach darob gewöhnliche Interessen zu
entrichten."
Er war "Schreibens unerfahren". Dagegen war es Pet. Diedr. Vollmer, dem
6 seiner Nachkommen und Nachfolger im Besitz des Gutes, möglich, 1838
für 1.950 Tlr. den größten Teil von Heugels Gut zu kaufen und damit seinen
Grundbesitz beträchtlich zu vergrößern. Außer Fleiß und Sparsamkeit der
Familienmitglieder, die ja zum Wesen der heimischen Bevölkerung gehören,
haben noch andere Umstände zur Besitzvermehrung der Familie Vollmer
beigetragen, die aus folgender Übersicht zu erkennen sind:
(S. 93)
Bekannte erwachsene Kinder Johann Vollmers (1650-1710) sind:
1. Anna Else, heiratete 1706 Hans Becker zu Deilinghofen.
2. Sybilla, heiratete 1708 Joh. Dedr. Winterhoff
3. Johann Diedrich (1682-06.06.1757), 75 Jahre
4. Anna (1699-1762), starb unverheiratet zu Selscheid, 63 Jahre alt.
5. Johann Wilhelm.
Kinder des Johann Diedrich Vollmers (1682-1757):
1. Anna Katharina (1709-1771), 61 Jahre.
2. Anna Sybilla (1712-1766), starb in Selscheid unverheiratet im Alter
von 54 Jahren.
3. Anna Elisabeth Christina (1714-1771), starb in Selscheid unverheiratet
im Alter von 58 Jahren.
4. Ana Christina (1716-1729).
5. Johann Wilhelm (1723-1724).
6. Johann Diedrich (09.03.1727-04.11.1796), 69 Jahre.
7. Henrich Wilhelm, geb. 1729, wurde 1744 konfirmiert, weiteres ist nicht bekannt.
8. Anna Christina, geb. 1733, heiratete 1763 Joh. Diedr. zu Versevörde.
Die Mutter der Kinder 1-5 hieß Sybilla (1683-1723), die der Kinder 6-8
Anna Katharina Kersting aus Versevörde (1692-1766), 74 Jahre, 3. Frau.
(S. 94) . . . Johann Vollmer (1650-1710) stand in verwandtschaftlicher
Beziehung zu Joh. Kellermann in Hilferinghausen; denn Anna Maria Vollmer
starb 1704 und Else Vollmer zu Selschede, die 1718 in Frehlinghausen
starb, sind keine Schwestern gewesen.
. . . Eigenartig ist in der Familie Vollmer die Vorliebe für die
Holzbearbeitung. Der 1719 zu Hohenhagen im Alter von 74 Jahren gestorbene
Vollmers Rötger, wahrscheinlich ein Oheim oder Bruder Johann Vollmers zu
Selschede (1650-1710) war der Gehülfe des Kaspar Voßloh. Die beiden
trieben 1685 am Ohler Pfarrhause die Sparren und Giebel wieder gerade
und arbeiteten 1690 am kirchlichen Backhause, Schuppen und Kruzifixhause
zu Ohle. Beide Söhne des Schreiners D. Wilh. V. zu Neuenrade (1762-1817)
waren Schreiner. Zeitweilig arbeiteten sie gemeinsam in Neuenrade, später
zog der 1808 geborene Friedrich Wilhelm V. nach Witten, wo er 1829 Maria
Wünnemann heiratete und wo noch Nachkommen von ihm leben. Sein Bruder
Joh. Heinrich V. (1814-1885) kam auf seiner Gesellenwanderschaft sogar
nach Paris und arbeitete dort längere Zeit. Das von seinem Vater gegründete
Geschäft vererbte er an seinen Sohn Wilhelm Hermann V. (1850-1918) von
welchem es auf Heinrich Vollmer, den jetzigen Inhaber überging.
Ein Sohn des Schuhmachers Peter Kaspar Vollmer zu Broshagen hieß ebenfalls
Pet. Kaspar und war 1802 auch als Schuhmacher in Erkelze tätig.
Am Schlechtenweg
1838 waren Besitzer Pet. Kasp. Heugel und A. M. Heßmer
1839 Pet. Kasp. Windfuhr und Kath. M. Ebberg
1895 August Windfuhr
100 Jahre Gastwirtschaft Werthmann in Selscheid
In der Gastwirtschaft Werthmann in Selscheid hängt seit 1978
die nebenstehende Tafel, auf der aus Anlass des 100-jährigen
Bestehens der Gastwirtschaft Werthmann die Geschichte der Familie
festgehalten wurde. Hier die Abschrift:
Chronik der Familie
Werthmann zu Selscheid
vormals Heugel auch
Hoegel zu Selschede
Als Selscheid im 14. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde, bestand Hoegels
Hof schon. Er galt als der größte Hof. Im Kirchenbuch zu Ohle zum erstenmal
eingetragen: 1509 Hans Hoegel war Vormünder der Ohler Kirche. Im Jahre 1575
starb der in Selscheid geb. letzte kath. Priester von Ohle mit Namen Heugel.
1598 Hynrich Hogel; Provisor der Kerken zu Oil. Im Jahre 1651 wurden
Geldabgaben u. Dienste von Hengels Hof an das Amt Neuenrade entrichtet.
1674 Claus Höggel, der 1634 geb. war. Kasp. Hoggel zu Selschede (gest. 1699)
63 Jahre alt. 1705 Christ. Peter auf der Höh Tochter, die 1776 starb.
1725-95 Joh. Hennrich Hügel. 1748 Anna Kath. seligen Peter Klämer von Herschede,
Tochter, heiratet Christoph Hügel aus Selschede. 1776 Christine Wilhelmine
Rosina Elisabeth Kirchsträßer, Tochter des Clemens Kirchsträßer zu Eiringhausen,
heiratet Peter Wilhelm Hügel. 1778 A. M. Christine Grafe vom Wellin. 1789
Kaspar Diedrich Hügel, Joh. Kaspar Hügels Sohn, heiratet Anna El. Hohage
von der Wiehardt. 1813 Peter Kaspar Heugel u. A. M. Eb. Heßmer geheiratet.
1821 Kath. Maria u. Maria Elisabeth Heugel. 1835 Peter Diedrich Ebberg.
Am 22. Juli 1836 brannte das Haus bis auf die Mauern ab. 1868 Anna Maria Ebberg
u. Wilhelm Werthmann. 13.04.1878 erhielt Wilhelm Werthmann die Erlaubnis
zum Betriebe einer Gastwirtschaft. Albert Werthmann geb. 09.04.1879 in Selscheid,
heiratet Klara Hedwig Klüppelberg geb. 13.11.1893 in Krummenstück. Hildegard
Werthmann geb. 24.12.1918 in Selscheid.
1878-1978
|
|
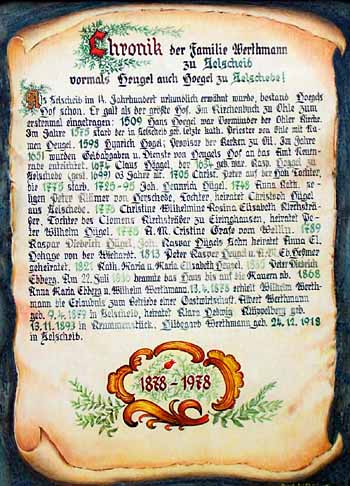
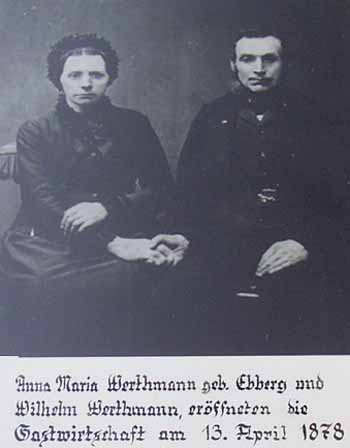
|
Quelle: Süderländer Tageblatt vom 04.03.1953
Goldenes Wirtsjubiläum im Ohler Gebirge
Interessantes Kapitel Heimatgeschichte - Werthmanns Hof in 4 Jahrhunderten
Plettenberg-Selscheid. Am heutigen Mittwoch sind 50 Jahre
ins Land gezogen, dass der jetzige 74-jährige Selscheider Wirt,
Herr Albert Werthmann, die Konzession erhielt, die von seinem
Vater Friedrich-Wilhelm Werthmann im Jahre 1878 gegründete, damals
noch recht bescheidene Bauernwirtschaft weiter fortzuführen.
Dieses alte Bauernhaus, das in einer besonderen Talmulde zwischen
dem Sohlberge und dem Hasenberge weitab vom Lärm und der Unruhe
unserer Zeit versteckt liegt, ist wohl eines der ältesten
Häuser aus Selscheids Vorzeit. Der alte Torbogen über der
Eingangstür trägt die Zahl 1748, desgleichen bezeugt der 118. Psalm
mit seinem "danket dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Güte
währet ewiglich", die wahre Herzensgesinnung der Erbauer dieses
Hauses.
Weil der Chronist zu berichten weiß, dass einst in Selscheid ein
mächtiger Feuersbrand vier Häuser eingeäschert hat, ist zu vermuten,
dass Werthmanns Haus im Jahre 1748 zum zweiten Mal aufgebaut worden
ist. Denn dieser Hof gehörte einst dem Geschlecht der Hoegel oder
Heugel, und im Jahre 1575 starb in Ohle der letzte katholische
Priester dieser Gemeinde, ein gewisser Heugel, der aus Selscheid
und dem jetzigen Werthmannschen Hause stammte. Nach dem katholischen
Priester Heugel aus Selscheid berief die Ohler Gemeinde einen
lutherischen Vikar, und es ist gewiss, dass schon zu Zeiten des
Priesters Heugel sowohl Selscheider als auch Ohler Bürger der
Reformation zugetan waren.
Der durch Einheirat und Kauf an die Familie Werthmann übergegangene
Hof war in alter Zeit so groß, dass, so erzählt der Chronist, sieben
Holzfäller in den zum Gut gehörenden Waldungen Bäume fällten, ohne
dass einer den anderen hören konnte. Die uralte, unter Naturschutz
stehende Linde vor dem Hause - leider durch Blitzschlag zerstört -
hat der Gattin des Jubilars den schönen Namen "Lindenwirtin" eingebracht.
Es entwickelte sich aus der anfangs kleinen Bauernwirtsstube, die in
diesem Jahr zugleich auf ihr 75-jähriges Bestehen zurückblicken kann,
die heutige modernisierte Gaststätte mit Pensionsbetrieb. Das alte
Haus, das gänzlich renoviert wurde, erhielt durch Anbau eine sonnige
Veranda. Desgleichen wurde in den Fremdenzimmern fließendes Wasser
angelegt. Viele erholungsbedürftige Menschen aus den verschiedensten
Großstädten unseres Vaterlandes fanden hier im Laufe der Jahre nicht
nur gute Aufnahme und beste Verpflegung, sondern vor allem auch die
so sehr gesuchte Ruhe und Entspannung.

So sind nun viele Generationen über die alte Schwelle dieses Hauses
hinweggeschritten, denn urkundlich ist Selscheid bereits im 14.
Jahrhundert als ein Teil der Grafschaft Arnsberg erwähnt. Mithin
werden dann auch in dieser geschützten Mulde des Werthmannschen
Anwesens die Vorfahren ihre Heimstätte errichtet haben. Dankbar
blickt heute der so hoch betagte Jubilar, ein aufrechter Sauerländer
von bescheidenem und aufrechtem Wesen, mit seiner lieben Ehegefährtin
auf die langen Jahre des gemeinsamen Schaffens und Wirkens zurück.
Auf ihrer Hände Arbeit ruht der Segen des Allerhöchsten.
Noch vor Tagen durch den Schatten der Vergänglichkeit erschreckt,
darf Opa Werthmann wieder der Genesung entgegensehen und im Kreise
seiner Angehörigen dieses nicht alltägliche Fest begehen. Auch die
Dorfgemeinschaft und alle Freunde des Hauses aus nah und fern werden
heute abend in einer kleinen Feierstunde ihre Anteilnahme und Freude
zum Ausdruck bringen. Möge dem biederen Herrn Werthmann und seiner
Lebensgefährtin, das ist der Wunsch der Heimatzeitung, noch manches
Jahr gemeinsamen Wanderns in Zufriedenheit und Gesundheit beschieden
sein.
"Vor meines Vaters Haus steht eine Linde,
vor meines Vaters Haus steht eine Bank,
und wenn ich sie einst wiederfinde,
dann bleib ich dort mein Leben lang . . ."
Schulte zu Breitenfeld (liegt bei 51.23°N 7.8°O)

1865 Landwirt Friedrich Schulte erbaut das Haus, ∞Hulda geb. Wertmann
1928 wohnten in Breitenfeld: Landwirt Fritz Schulte, Kraftfahrer Willy Kohlhage, Knecht Albert Dietz
bis 1955/56 wurde das Gebäude landwirtschaftlich genutzt
1958 K des Nebengebäudes durch Walter und Maria Schrader
1958 K des Haupthauses durch Paul-Heinz (†1998) und Magdalene Decker geb. Schrader
1980 K Friedhelm Bank (†2005)
1998 Gabriele Leyendecker geb. Decker

Schloß Grimminghausen
Haus Grimminghausen - der Loerhof
Nachdem Johann von Rump seinen Anteil an dem Gute Brüninghausen verkauft hatte,
lebte die Familie Rump in Grimminghausen, nach Johann Rump Diedrich, der 1539
den Loerhof oder das Hofgut "nutzte", 1564 wird noch seine Witwe Matharina geb.
Wrede erwähnt. 1526 bebaute Hans Lohagen das Lohagen-Gut zu Grimminghausen.
Das Obereigentumsrecht an Grimminghausen besaß die Familie Ruispe. Hermann
und Guntermann von Ruispe verkauften dasselbe an Hinrich Wyscherd zu Plettenberg
und seine Hausfrau Hunne. Deren Enkel traten es wieder an die von Ruispe ab, und
zwar der Plettenberger Bürger Heinemann Hunolt und Frau bezüglich Lohagen-Gut
1526 an Gerd von Ruispe und Wilhelm Hunolt und Frau zu Sonsbeck betreffs des
Loerhofes 1539 an die Witwe Gerhards von Ruispe (Quelle: Urkunden im Archiv des
Freiherrn von Wrede). 1569 wohnte Jasper Rump zu Grimminghausen, 1573 bis 1612
Kasper Rump.

Durch Verheiratung der Katharina Rump mit Ahasverus von Plettenberg aus Neilen (Nehlen?)
kam die Familie von Plettenberg-Neilen dorthin. Später gehörte Grimminghausen der
zur Reformationszeit ihres Glaubens wegen aus Luxemburg geflüchteten Familie von
Mascherell, und zwar bis 1681 dem Rentmeister von Hörde, Joh. v. Mascherell, der
sich eifrig um den Bergbau in unserer Gegend bemühte. Nach ihm erbte es seine
Schwester, die die Gemahlin des Soester Bürgermeisters Andreas von Dael war. Deren
Tochter Christine Marg. von Dael heiratete Joseph von Katzler, der erst im kaiserlichen
Heere diente, dann im Schwedisch-Polnischen Kriege im Heer des Großen Kurfürsten mit
großem Ruhme ein Schwadron führte und deshalb zum Range eines Obersten aufstieg.
Später befehligte er im holländischen Dienste eine Brigade. Seine Frau starb 1733
in Grimminghausen. Sein Sohn und Erbe Wilhelm Ludolf starb schon 1700 als holländischer
Hauptmann (Hinweis: Dessen Witwe, Helene Christine geb. von der Bersword, starb 1744
in Grimminghausen). Dessen Sohn Niclas Andreas brachte es hier zum preußischen
General-Lieutnant und zeichnete sich im siebenjährigen Kriege aus.
Niclas Andreas von Katzeler kaufte 1751 für 300 Tlr. von der Ohler Kirchengemeinde, die bis dahin der Kirche
zustehenden Einkünfte aus den beiden Gütern zu Erkelsen, welche bestanden seitens
des oberen Gutes in 1 Schwein, 4 Hühner, 1 Pflug- und 2 Handdiensten und des untern
Gutes in 3 Rtlr. 45 St., 1 Pfund Wachs und 2 Hühnern. Niclas Andreas Gemahlin, eine
geborene von Bardeleben, ist 1767 in Grimminghausen gestorben. Der Familie von
Katzeler diensten Jäger Adolf Christoph Hoffmann (†1754) und Schäfer Bernd
Sönnecken (†1763). 1663 wohnten in Grimminghausen noch die Witwe von Mascherell,
Klara geb. Pfreundt, die in dem Jahre den Hof Voßloh für 140 Tlr. von der Ohler
Kirchengemeinde an sich brachte.
1770 kaufte der Freiherr von Haus zu Niederhofen bei Hörde das Gut Grimminghausen, von
dem es 1800 der Freiherr von Kessel zum Neuenhof erwarb, dessen Nachkommen es noch
besitzen (Stand: 1949)....
...Zu Grimminghausen gehören 10 Höfe: Grimminghausen 3, Hohenhagen, Voßloh, Hechtenberg,
Sechtenbecke, Höh, Kleeschlade und Wiehardt...
...Das Haus Grimminghausen ist mit Ausschluss der beträchtlichen Kellerräume im Erdgeschoss
ein zweistöckiges Gebäude von gewöhnlicher Form und Größe und unterscheidet sich nur
durch seine Größe und ein Schieferdach von den übrigen Wohnungen. Die südöstliche Hälfte
des Hauses wurde 1675 angebaut. Ursprünglich soll das gegenwärtige Viehhaus von der
Herrschaft bewohnt worden sein, eine Annahme, welche durch den näheren Augenschein an
Wahrscheinlichkeit gewinnt.
Pächter auf den beiden Bauernhöfen in Grimminghausen: 1725 Wilh. Wulf, 1749 Jürgen Wulf,
1792 Kasp. D. Lengelsen, 1813 Pet. Kasp. Lengelsen (seine Frau A. Chr. Schulte stammte
aus Elhausen), 1759 D. W. Heßmer, dann Joh. Pet. Heßmer, 1825 Joh. Jak. W. Heßmer, Herm.
D. Lösenbeck, 1837 P. W. Lösenbeck und A. Kath. Holthaus. 1844 kam aus der Bubbecke Matth.
P. Kalthoff. 1856 Holthaus. 1821 wohnte in Grimminghausen Maurer Nikolaus Sturm, 1853
starb hier Zimmermann J. W. Hüttebräucker.
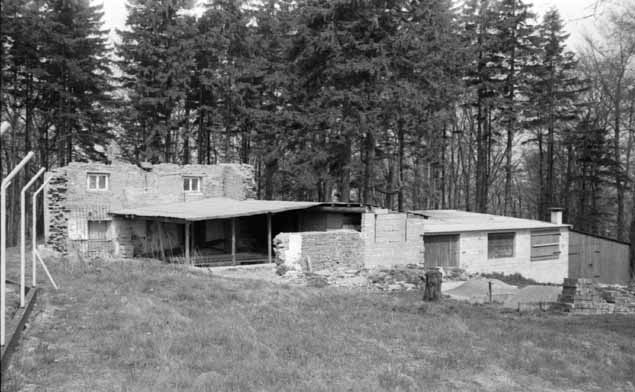
Die Reste von Hohagen Ende der 1950er Jahre. (Archiv: H. Hassel)
Hohagen
1645-1719 Rötger Volmer, der 1685 und 1690 als Zimmermann in Ohle arbeitete
1694-1749 Eberhard auf dem Hohagen
vor 1745 Anton Glingener
1713-1766 Joh. Diedr. Ludemert ∞1746 Christina Glingener (1711-1757)
1758 A. Christine Sirringhaus von Rärin
1734-1776 Joh. Henr. Glingener, Antons Sohn, ∞1761 Elisab. Bröcker von
Hüinghausen; diese ∞1777 Herm. Henr. Clemens Rentrop vom Ramsloh bei Hülscheid
1768-1843 Joh. P. Glingener, Joh. Henr. Sohn, ∞1790 A. Kath. Holthaus,
Tochter des Pet. Kasp. Holthaus auf der Höh. A. M. Kath. Glingener, die Tochter
des J. P. Glingener, ∞1831 Joh. Pet. Becker, Kötter auf der Schibbecke
1723-1803 Wilh. Hollweg und A. M. Christine Mölhof (1760 bis 1802)
1851 P. D. Glingener
1928 wohnte auf dem Hohagen: Landwirt Julius Lengelsen, Packer Julius Lengelsen,
Fabrikarbeiter Wilhelm Lengelsen
Quelle: Einwohnerbuch für Lüdenscheid und den Kreis Altena, 1926/27,
III. Teil Amt Plettenberg, Gemeinde Ohle, S. 359
Einwohner von Hohagen (Post Ohle)
Lengelsen, Heinrich, Fabrikarbeiter
Lengelsen, Heinrich, Fabrikarbeiter, Nr. 35a
Lengelsen, Julius jr., Packer, Nr. 35a
Lengelsen, Julius sen., Landwirt, Nr. 35
Lengelsen, Wilhelm, Gießer, Nr. 35a
Voßloh
Voßloh wurde 1663 Grimminghauser Pachtgut, Hechtenberg noch später.
1599 Joh. Kranß
1682-1716 Adam im Voßloh und A. Else
1723 † Kasp. Biermann (1640-1723)
1808 Pet. Diedr. Voßloh, Friedrichs Sohn, ∞M. Elisab. Hoppe
aus Hüinghausen
1842 † Pet. Wilh. Eick
1926 wohnten auf Voßloh: Landwirt Wilhelm Bangert (Nr.33),
Fabrikarbeiter Ewald Schmidt (Nr. 33a)
1928 wohnte in Voßloh: Invalide Ewald Schmidt
Zu den Eigenhörigen des Hauses Brüninghausen gehörte 1570 "Kranß im Voßloe
tho Gryminckhusen hie selbst, syn moder und syn frauwe und kynder und
alle syn broder und suster" (Quelle: Adelsarchiv v. Werde-Amecke, Nr. 171,
12. April 1570)
Hechtenberg
1644-1718 Volmer Voßloh und A. geb. Hechtenberg (1642-1717)
1675-1745 Joh. Adolf vom Hechtenberg
1761 Joh. Pet. Hechtenberg, Adolfs Sohn, ∞A. Kath. Grote (1740-1795),
Tochter des Moritz Grote aus der Lingenbecke
1766-1822 Andreas Hechtenberg, Joh. Pet. Sohn, ∞1803 Christine
Elisab. Holthaus, Tochter des Kasp. Holthaus auf der Höh
Diedrich W. Holthaus
1926 wohnten in Hechtenberg: Fabrikarbeiter Gustav Mittendorf (Nr. 32),
Landwirt August Werthmann (Nr. 32)
1928 wohnte in Hechtenberg: Landwirt August Werthmann
Hechtenberg, noch mit Stroh gedeckter Einöd-Hof am Wege von Grimminghausen nach Wellin; wurde in der
Nacht zum 7. September 1949 durch Blitzeinschlag in Brand gesetzt und brannte bis auf die Grundmauern
ab; Pächter war damals Hubert Arns, Eigentümer Werthmann aus Erkelze (vermutlich eher aus Selscheid);
Quelle: Einwohnerbuch für Lüdenscheid und den Kreis Altena, 1931/32
Einwohner in Hechtenberg (Post Ohle)
Middendorf, Gustav Fabrikarbeiter
Werthmann, August, Landwirt
Höh
1650-1728 Pet. Eberh. Wolf, kath., und A. Kreikebaum (1675 bis 1734)
1691-1753 Jürgen Wolf
1758 Joh. Kasp. Wolf, Jürgen Wolfs Sohn, ∞Kath. Elisab. Greve vom
Herscheider Baum
1767 Joh. Diedr. Dickehage auf der Höh
1730-1772 Christoph Holthaus und Frau A. Gertr. (1697-1772)
1696-1780 Joh. Herm. Dunker
1730-1808 Joh. Pet. Holthaus und Frau A. Marg. (1733-1800)
1813 Pet. Wilh. Holthaus
1840 Kasp. Diedr. Holthaus und A. Kath. Elisab. Birke aus Bremcke
Karl Vollmer (*25.06.1858), und Frau Karoline geb. Alberts (*01.02.1868), auf
der Höh; feierten 1940 ihre Goldene Hochzeit
1926 wohnten in Höh: Landw.-Geh. Karl Vollmer jr., Landwirt Karl Vollmer
sen., Landw.-Geh. Wilhelm Vollmer
1928 wohnte in Höh: Landwirt Karl Vollmer
Sechtenbecke

1648-1722 Henrich Schnieder in der Sechmecke und Gertrud (1656-1723)
Wilh. in der Sechmecke und Kath. Elisab. (1711-1747)
1685-1755 Joh. Pet. i. d. Sechmecke und Maria (1681-1757)
1748 Joh. Wilh. ∞als Witwer A. Elisab. Hügel aus Böddinghausen (1712-1757)
1758 Klara A. Syb. Rottmann aus Böddinghausen (1731-1758)
1759 A. Gertr. Sur aus Erkelsen
1810 P. Kasp. Sechtenbeck
1767-1841 Friedrich Sechtenbeck und A. Syb. Chr. Pieper
1841 Karl Fr. Wilh. Sechtenbeck ∞Wwe. Eick im Voßloh, ∞1848 A. M. Cordt
1926 wohnten in der Sechtenbecke: Landwirt Eduard Schmidt (Nr. 28),
Fabrikarbeiter Emil Schmidt (Nr. 28), Landwirt August vom Wege (Nr. 28a)
1928 wohnten in der Sechtenbecke: Meister Albert Schmidt, Rentner Eduard Schmidt,
Speisewirtschaft und Landwirt August vom Wege

Die Sechtenbecke in den 1960er Jahren. Foto: Martin Zimmer
Quelle: "Alt Ohle im Bild", September 1982, Martin Zimmer;
mit Zeichnungen von Peter Krasemann
Die "Alte Sechtenbecke"
Östlich des heutigen Parkplatzes Grimminghausen hinter Selscheid
liegt der Hof Sechtenbecke. Er wurde jahrhundertelang von der
Familie gleichen Namens als selbständiger Bauernhof bewirtschaftet
und bewohnt.
Bei so manchen älteren Bewohnern Selscheids und der umliegenden
Bauernschaften weckt der Name Sechtenbecke noch heute Erinnerungen
an längst vergangenen Zeiten. So weiß man zu erzählen, dass dieses
Gehöft schon seit vielen Jahren zu den Besitzungen von Schloss
Neuenhof bei Lüdenscheid gehört und ihre Bewohner neben der
Entrichtung von Pachtgeld verpflichtet waren, diesen Hof in
Ordnung zu halten. Dazu gehörten u. a. Ausbesserungsarbeiten
am Strohdach, an Türen, Fenstern und Mauerwerk.
Um 1880 änderten die Bewohner der "Alten Sechtenbecke" erstmals
ihren Namen. Eine Familie Schmidt aus Holthausen zog dort gleich
zwanzig Kinder groß! Einer der Schwiegersöhne, August vom Wege
aus Holthausen, eröffnete später eine Sommerwirtschaft. Sie wurde
gern von Ohler Spaziergängern am Sonntag besucht. Eine kühle
Flasche Bier, die vom Wege in seinem selbst angelegten Keller
unweit des Hauses lagerte, soll schon diese Wanderung wert
gewesen sein.
Alljährlich am Silvestertage, wenn die Neujahrssänger von Selscheid
durchs Ohler Gebirge ziehen, und auf den entlegenen Gehöften das
neue Jahr ansingen, sind es auch die Bewohner des Hofes Sechtenbecke,
die diesen Gruß vernehmen.

Kleeschlade
1696 Wilm vom Brinke in Frehlinghausen
1743 Pet. Birkenhof und Frau Christina (1685-1749)
1759 Joh. Herm. Kohlhage
1778 Joh. Wilh. Hollweg, starb 1803 im Alter von 80 Jahren
1780 Pet. Kasp. Inne; Joh. Anton Hesmerg aus Landemecke bei
Herscheid, ∞Joh. W. Hollwegs Tochter A. Christ. M.
1784-1836 Kasp. Leopold Hesmer und M. Kath. Funke
1834 Oet. Wilh. Hesmerg
1905 Heinrich Geisweidt
Am Anfang dieses Jahrhunderts (nach 1900) ist das Haus abgebrannt.
Vor 60 Jahren saß der rote Hahn
auf dem Hof Kleeschlade
Alter Bauernhof sank vor sechs Jahrzehnten in Schutt und Asche -
Er wurde nicht wieder aufgebaut - Wie Ohle den Brandopfern half
- Zur morgigen Wanderung der Plettenberger SGV-Abteilungen zur
Kleeschlade
Es war am Tage nach Pfingsten und etwa um das Jahr 1905. In Ohle war
Kirmes. Der Pfingsdienstag war bekanntlich der Hauptkirmestag. Am
morgendlichen Kirchweih-Gottesdienst erschien nicht eine Familie aus
dem Ohler Gebirge. Auch am Nachmittag, als der Kirmestrubel begann,
waren keine Bauersleute, auch keine Kinder "vom Berge", wie man früher
sagte, zu sehen. Ich weiß noch, wie mein Vater zum Pastor Haverkamp
sagte: "Wenn bis heute abend noch keiner vom Berge kommt, dann müssen
wir hinauf, dann ist etwas passiert."
Eine Tragödie in den Bergen
Am Abend gegen 6 Uhr kamen die ersten Bergbauern zur Kirmes. Da erfuhren
wir auch, warum sie nicht schon am Morgen gekommen waren. Die "Kleeschlade"
war um 10 Uhr morgens abgebrannt, und alle Bauernfamilien von Erkelze,
Selscheid und den Grimminghauser Höfen waren zur Hilfeleistung zur
Kleeschlade geeilt.
Aber jede Hilfe kam zu spät. Das strohgedeckte Bauernhaus brannte
vollkommen nieder. Der Bauer, der mit seiner Frau auf dem Felde arbeitete,
konnte kein Stück Möbel oder Hausgerät retten. Die Frau wurde allgemein
bedauert, ihr gesamter Vorrat an Leinen war ein Raub der Flammen geworden.
Der Bauer hies Heinrich Geisweidt und stammte vom Grävinglöh, wo sein
Vater, der "Kleubur", um diese Zeit der Besitzer war.
Vorbildliche Hilfsbereitschaft
Dem abgebrannten Heinrich Geisweidt wurde jedoch eine unerwartete Hilfe
zuteil. Auf Anregung des langjährigen Ohler Gemeindevorstehers Fritz Maiweg
wurde eine Geldsammlung durchgeführt. Im Dorf Ohle musste ich die Sammlung
vornehmen. Die Bauern gaben alle Zehnmark-Goldstücke, einige sogar ein
Zwanzigmarkstück. Viele kleine Leute gaben fünf Mark oder zumindest einen
Taler. So wurde den armen Abgebrannten durch diese schöne Opferbereitschaft
der Dorf- und Volksgemeinschaft in der ersten Not geholfen.
Nur am Rande sei noch erwähnt, dass wir am ersten Schultag nach den
Pfingstferien aus Schillers "Lied von der Glocke" die Feuersbrunst lesen
und auswendig lernen mussten. Unser Lehrer Carl Hüser legte großen Wert
darauf.
Die Kleeschlade, ein Pachtgut des Grafen Busche-Kessel und zum Gut
Grimminghausen gehörend, wurde nicht wieder aufgebaut. Nach dem Brande
wurden Felder und Wiesen zunächst in eine große Viehweide umgewandelt.
Heute stehen dort dicke Tannen. Nur unter der kundigen Führung von
Wanderfreund Klaus Schötke werden die Plettenberger Abteilungen des SGV
am morgigen Sonntag die Stelle wiederfinden, wo einst Heinrich Geisweidt
in harter Arbeit den Acker bestellte und an einem schönen sonnigen
Kirmestag den Untergang seines Besitzes erleben musste.
Viele Höfe sind im Laufe der Jahrhunderte im Raum Ohle abgebrannt. Die
meisten wurden wieder aufgebaut. Unter denen, die nicht erneuert wurden,
waren beispielsweise zwei kleine Kotten in der Nähe von Grävinglöh, deren
Stätte unbekannt ist.
Sodann war auf dem Sundern an der "Sundes Vuahr" in der Nähe von Elhausen
ein Jägerhaus, ferner auf der Burg ein Bauernhof, dessen Standort man noch
nicht festgestellt hat. Im Brüninghauser Tal befand sich ebenfalls ein
Jägerhaus, die "Brüninghauser Höh", und ein weiterer Kotten , die
"Brüninghauser Becke", aber davon ein andermal.
(Quelle: ST 1965, Autor: Ewald Baberg)

Wiehardt
1697 starb die alte "Wiehärdtsche", aus Maastricht gebürtig, im
Alter von 70 Jahren
1698 und 1709 Heimann auf der Wiehardt; er mauerte auch
1652-1750 Joh. Wilh. auf der Wiehardt gen. Luxemburg
1750 Joh. Jost Hohage und Helene Christine (1704-1738)
seit 19?? Wanderheim der SGV-Abteilung Lüdenscheid (26 Betten,
8 Matratzenlager, 50 Sitzplätze)
1926 wohnten auf der Wiehardt: Landwirt Gustav Hurst (Nr. 31),
Landwirt Wilhelm Hurst (Nr. 31)

Das SGV-Heim der Abteilung Lüdenscheid auf der Wiehardt im Juni 2010.
Foto: Hassel
Brüninghauser-Becke
1694-1739 Joh. Herm. Hink
1740 Joh. Diedr. Hink
1673-1743 Hans Becker
1752 starb der alte Schneider Honigmann
1798 Joh. Pet. Sur, Joh. Henr. Sohn, ∞Kath. Elisab. Brinkmann
aus Vorrats Hause.
Das Haus brannte ab und wurde nicht wieder aufgebaut.
Brüninghauser-Höh
1664-1711 Wilm Brinkmann aus Frehlinghausen, er wohnte erst auf
der Kleeschlade, seit 1696 auf der Br.-Höh; seine Söhne Joh. Diedr. (*1700)
und Christoph (*1702) erwarben 1728 bzw. 1730 Bürgerrecht in Plettenberg
1713 Pet. Birkenhof ∞Christine vom Oberen-Holte, Wilms Witwe
und 3. Frau
Das Haus wird abgebrannt sein.
Quelle: Einwohnerbuch für Lüdenscheid und den Kreis Altena, 1931/32,
III. Teil Amt Plettenberg, Gemeinde Ohle, S. 467
Einwohner in Selscheid (Post Ohle)
Baberg, Ernst, Holzhandlung u. Landwirt, F. Werdohl 172
Herzog, Albert, Fabrikarbeiter, Nr. 39a
Holthaus, Karl, Fabrikarbeiter
Holthaus, Karl, Rentner
Holthaus, Wilhelm, Fabrikarbeiter
Mittendorf, Fritz, Landw.-Geh.
Mittendorf, Wilhelm, Landw.-Geh.
Mittendorf, Wilhelm, Landwirt
Schmidt, Eduard, Rentner
Simon, Friedrich, Lehrer
vom Wege, August, Landwirt
Werthmann, Albert, Fabrikarbeiter
Werthmann, Albert, Gastwirtschaft
Windfuhr, August, Fabrikarbeiter
Quelle: Text zu einem Dia-Vortrag "Aus der Geschichte der Bauerschaft Selscheid"
von Martin Zimmer (in den 1990er Jahren)
Aus der Geschichte der Bauerschaft Selscheid
Name: Das in hiesigen Flur- und Ortsnamen enthaltene fränkische
Grundwort "scheid" (scetha) ist im märkischen Sauerland häufig
vertreten, ebenfalls im Bergischen, an der unteren Sieg und
westlich vom Rhein bis Saarbrücken. Ursprünglich Flurnamen.
Renscheid und Timscheid in der Ohler Gemarkung sind unbesiedelt.
Ortschaften Herbscheid und Walscheid bei Werdohl entstanden erst
nach Teilung der Marken.
Scheid: meistens eine Grenz-, Wasser o. sonstige Scheidung. Südwestlich
vom Sundern grenzen aneinander die Fluren von Selscheid, Erkelze und
dem Berge Renscheid.
Sel (Sielen): Einsattelung im Gebirge, Durchlass für den Verkehr.
Statt Erkelze schrieb man im 16. Jahrhundert Erkelsche (Platt so
gesprochen).
Plattdeutsch: Statt Selscheid "Selsche". Richtige Form des Namens
von Erkelze = Erkelscheid. Östlich von der Lenne und nördlich von
der Ruhr hat "scetha" unter sächsischem Einfluss die Form "schede"
erhalten, z. B. Leinschede, Dröschede, Brenschede (viele fränkische
Flur- und Ortsnamen mit "ing" und "scheid" = Gebiet der ripuarischen
Franken, von in alter Zeit besiedelt).
Aus Selscheids Vorzeit
Auszüge aus P. D. Frommann "Von der Hünenburg auf dem Sundern . . .",
S. 74: Selscheid zwischen Ebberg (Sohlberge) und Hasenberg in Einsattelung,
Senke - Sel = Art Durchlass oder Sielen. Urkundlich erwähnt im 14.
Jahrhundert, damals Teil der Grafschaft Arnsberg. Deren Grafen hatten
Johannes Wesselberg mit dem Zehnten zu Selscheid und Grimminghausen
belehnt. Zu jener Zeit gab es vier Bauerngüter in Selscheid:
Hoegels Hof = Haupthof, Obereigentumsrecht war später versplittert.
1474 verfügte über Heugels Hof der aus Plettenberg stammende Heinrich
Steynhoff, Probst zu Worms und Kanonikus an der Kirche hl. Apostel zu
Köln. Er wies 4 rhein. Gulden, die als Einkünfte aus dem Hof kamen, der
damals neu gergündeten Kapelle der Kirche Plettenberg zu - zum Unterhalt
für den Vikar. In den folgenden Jahrhunderten bezog die Kirchengemeinde
zu Plettenberg vom Gut 7 1/2 Rtlr., 1 Schuldschwein, 4 Hühner.
Ebbergs Gut zweitgrößtes, der Name stammt von der Lage am Fuße
des Ebbergs. Im 16. Jahrhundert anscheinend recht wohlhabend, denn Johann
Ebberch lieh Kaspar Rump zu Grimminghausen 34 Rtl. gegen Verpfändung
eines Landstücks.
Vollmers Gut: Noll (Middendorf), erwähnt 1598 Lamberts Volmar,
zehntpflichtig nach Grimminghausen, Abgaben an die Ohler Kirche, u. a.
aich Lehns- und Herbstdienste. S. 76: Als 1777 die Herscheider Mark
aufgeteilt wurde, wurde Vollmer den Halbbauern zugerechnet, Hoegel und Ebberg zu Bauern, Eickesmann zu Köttern.
S. 77: 1765 hatte Selscheid nur 35 Einwohner, die sich auf 5 Familien
verteilten: Peter Heinrich Ebberich, Kaspar Heugel, Diederich Volmersmann,
Diederich Eickesmann, Andreas Wolf.
Getreide musste in der stattlichen Mühle zu Versevörde gemahlen werden.
Der letzte katholische Priester von Ohle hieß Heugel. Er starb 1575. Nicht
selten wurden Selscheider Landwirte in den Ohler Kirchenvorstand berufen
als Kirchmeister, Provisoren oder Vormünder.
1618 war Clemens Pieper, dessen Vater in Selscheid unter der Eiche wohnte,
erst Jäger und Fischer zu Pungelscheid, später kurfürstlicher Frone zu
Altena. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlernten vier Selscheider
Knaben das Tuchmacherhandwerk in Plettenberg (u. a. zwei Brüder Middendorf).
Am 25. Januar 1826 brannte Vollmers Gut ab und am 22. Juli 1836 Hügels Haus.
1878 wurde die Schankkonzession für Wilhelm Werthmann erteilt.
Verwaltungsgeschichte
Am 3. Dezember 1940 Antrag der Gemeindevertretungen von Stadt Plettenberg
und Amt Plettenberg auf Zusammenschluss zur Stadt Plettenberg. Ohle stimmte
nicht zu (4 Gegenstimmen, 1 Enthaltung, 1 dafür). Am 21.12.1940 wurde mit
Wirkung zum 1. April 1941 durch den Oberpräsidenten bestimmt: "Die Gemeinden
Plettenberg-Stadt, Plettenberg-Land und Ohle im Kreis Altena werden zu einer
Gemeinde, Stadt Plettenberg, zusammengeschlossen."
Geschichte dieses Beschlusses: Der Ursprüng von Plettenberg liegt im 9./10.
Jahrhundert. 1144 erste Erwähnung "Pletenbreth", vorher unter "Heslipho"
bekannt. Um 1000 Entstehung der Kirchengemeinde Ohle, das von ca. 1301 an,
als die Burg Schwarzenberg gebaut wurde, vom bisherigen Verwaltungsgebiet
Hunenburg in das Amt Schwarzenberg integriert wurde.
1350 kommt Plettenberg durch Verkauf in den Besitz der Grafen von der Mark.
Plettenberg verließ damit das Amt Schwarzenberg und wurde als Stadt (Stadtrechte
1397 durch Graf Dietrich) eigenständig (Befestigung mit Mauern, Türmen, Gräben).
Plettenberg lag zentral, umgeben vom restamt Schwarzenberg, der späteren
Landgemeinde mit ca. 100 qkm Ausdehnung.
Das Kirchspiel Ohle (mit Bauerschaften, Gehöften im Ohler Gebirge) wurde
1353 dem neu gegründeten Amt Neuenrade zugeschlagen. Die Dreiteilung des
Plettenberger Stadtgebietes war vollzogen. Die weitere Entwicklung der einzelnen
Gemeinden sollte ab jetzt über 5 Jahrhunderte getrennt verlaufen.
Quellen zur Geschichte des Amtes Plettenberg:
1486 Schatzbuch der Grafschaft Mark. Es berichtet von 120 Bauernfamilien
(21 kölnischen, 58 freimärkischen, 41 Hofesleuten). Die Verwaltung erfolgte
von der Burg Schwarzenberg aus, daher auch Amt Schwarzenberg.
von 1809 bis 1866 stand das Amt unter gemeinsamer Verwaltung mit der Stadt
und durch eine gemeinsame Bürgermeisterei, von Vereinigung war aber keine Rede.
In den Landgemeinden gab es eigene Gemeindevorsteher und Amtmänner. Eine
Veränderung der Situation ergab sich durch die französische Fremdherrschaft unter
Napoleon. Am 28. Juli 1809 wurde Freiherr Karl Christoph Adolf Johann zu
Plettenberg zum Maire (Bürgermeister) bestimmt. Dabei war der Raum Plettenberg gar
nicht auf eine kommunale Neugliederung vorbereitet. Stadt und Amt waren in ihrer
wirtschaftlichen Struktur, ihrer verwaltungstechnischen und gemeindepolitischen
Einstellung zu verschieden. Demzufolge kam es 1866 wegen persönlicher Interessen
und Machenschaften zur Verwaltungstrennung. Die strukturellen Gegensätze zwischen
Stadt und Amt: Stadt = Die Bevölkerung lebte auf engem Raum, führte ein städtisches
Leben. Amt = Der Charakter war geprägt von ländlich gebliebenen Eigenarten.
Bäuerliche Interessen domonierten in diesem nur locker besiedelten Bereich. Diese
Kriterien erforderten eine eigene, den Besonderheiten angepaßte Verwaltung.
Ohles Abschied von Neuenrade und die Eingliederung ins Amt Plettenberg geschah 1890
freiwillig. Bedingung war die Wahrung der Selbständigkeit mit eigenem Bürgermeister,
Rat und Etat. Lediglich die Beziehungen zum anderen Pol, dem Amt, sollten vertieft
werden. Die Stadt Plettenberg entfaltete inzwischen ein Eigenleben. Ihre Zentralität
strahlte natürlich ins Amt aus. Alt Mittelpunkt des Flußachsenkreuzes (Else/Oester,
Grüne) und als Verkehrsknotenpunkt war sie von großer Bedeutung und von allen
Amtseingesessenen schnell zu erreichen. Hinzu kam die kulturelle Entwicklung (Bau
der Realschule/Gymnasium, Schützenhalle), die allerdings ohne Unterstützung des
Amtes nicht möglich gewesen wäre. Inzwischen wurden die Siedlungsflächen langsam
eng, nicht zuletzt bedingt durch die steigende Zahl der Wirtschaftsbetriebe. mehr
Raum war notwendig. Die Notlage nach dem I. Weltkrieg trieb die Neuordnung voran...
Auszüge aus der Schulchronik (von Lehrer Dieter Dringenberg, S. 1-192)
I. 1. Geschichte des Schulortes
S. 1 Haus Albert Werthmann, wahrscheinlich ältestes Haus, einst im Besitz
eines gewissen Höggel. Er hatte den größten Grundbesitz.
1920 wohnten in Selscheid folgende Familien: Mittendorf gen. Vollmer,
Holthaus gen. Äikes, Baberg gen. Ollen Ebbes (Ebberg, früherer Besitzer),
Hügel gen. Nien Ebbes (Neuen Ebberg, durch Erbteilung aus dem Ollen Ebbes
entstanden), Herzog gen. Häöih (Höh bei Grimminghausen, weil dort früher gewohnt),
Windfuhr am Schlechten Weg (ca. 200 m südöstlich von Selscheid).
S. 2 Wirtschaft des Ortes in Händen von Albert Werthmann; wochentags selten
besucht, von älteren Leuten gar nicht. Sonntags kommen ältere Besucher aus der
Umgebung zum Skatspielen, hat aber nachgelassen, weil "die Jugend, halbwüchsige
Jungen und auch Mädchen, durch lauten Lärm und anstößiges Benehmen ruhigeren Leuten
den Aufenthalt verleidet." Bewohner Selscheids reden sich mit "Du" an, das bedeutet
aber nicht besondere 'Herzlichkeit des Verkehrs'.
Den größten Grundbesitz hat gegenwärtig der Landwirt Mittendorf: einschließlich
Wald rd. 300 Morgen zusammenhängender Grund, deshalb auch eine eigene Jagd.
Landwirtschaft betreiben außerdem noch Baberg und Hügel. Die übrigen Einwohner
sind im Hauptberuf Fabrikarbeiter in Kleinhammer/Werdohl. Sie besitzen - außer
Herzog, der nur gepachtet hat - alle etwas Grund und Boden, halten sich 1 bis 2
Kühe und lassen sich ihre Äcker von den Landwirten gegen Bezahlung mit dem Pferd
bearbeiten.
Die Häuser in Selscheid waren bis vor 30 Jahren (um 1890) sämtlich mit Stroh
gedeckt. 1920 waren es nur noch die Häuser von Holthaus, Werthmann und Hügel.
Die Eigentümer bedauern, dass sie in der Inflationszeit keine Ziegel gedeckt
hatten. Strohdächer erforderten viele Reparaturen, die der Decker aus Herscheid
(der alte Lohmann von Oberholte) ausführt.
S. 3 - Bei fast allen Bauernhäusern befand sich ein Backes (Backhaus). In ihm wohnten
früher fast überall Mieter. Gegenwärtig (1920) sind keine Mieter mehr vorhanden.
Der Grund dafür: "Man würde sich auch mit Händen und Füßen dagegen sträuben,
da man sich nicht gern in die Fenster sehen lässt und am liebsten ganz abgeschlossen
für sich ist. Ich schließe daraus, dass die Landwirte auf diese Einnahme heute nicht
mehr angewiesen sind, es ihnen also besser geht als früher."
Wiesen und Felder bringen dank besserer Düngung mehr Erträge. Trotzdem preist man
'die gute alte Zeit'. Alle Besitzer haben heute Pferde, früher fast nur Ochsen.
"Viel Verkehr pflegen die Selscheider nicht untereinander."
1924 Streit zwischen Baberg und Mittendorf wegen Wegegeschichte mit Rechtsstreit.
Chronist: "Für eine Person, die in geselligen Verhältnissen groß geworden ist,
ist das Leben in Selscheid nicht besonders angenehm. Die herrliche Umgebung
vermag allerdings über manches hinweg zu helfen."
S. 4 - Der Ackerbau ist wegen des steinigen Bodens wenig ergiebig. Die Viehzucht
bringt mehr ein. Die Milch wird verbuttert, entrahmte Milch zur Viehaufzucht verwendet.
Die Alltagskost der Menschen ist einfach. Auf eine besondere Zubereitung wird wenig
Wert gelegt.
1920 - Selscheid erhält elektrisches Licht. Die Landwirte kaufen sich Elektromotoren
zum Antrieb der Dreschmaschinen, Kreissägen und Mühlen. - Hinter Werthmanns Haus
liegt der alte Brandteich, der schon lange Jahre leer ist. Gegen Brand und
Blitzschlag ist man völlig schutzlos.
1922 - Inflationszeit. Landwirt Baberg lässt seinen Schoppen zu einem Wohnhaus
umbauen, das im Sommer 1923 von Bankdirektor "Lagarie" aus Barmen bewohnt wird.
1927 - Es gibt Pläne für einen Straßenbau von Selscheid nach Ohle. Der Baubeschluss
wird laut Zeitungsbericht am 02.06.1927 gefasst. Im Juli 1927 wird in der Jeutmecke
eine große Baracke aufgestellt als Unterkunft für rund 100 Wegebau-Arbeiter. Die
einzelnen Teile der Baracke werden mit dem Auto bis zum Kanal in Elhausen gebracht,
von hier aus geht es weiter über den 'Schlechten Weg' am Bach entlang bis zur Jeutmecke.
Beginn der Arbeiten ist dann im August 1927 in dem Buchenwald westlich vom Brauck.
Ende April 1927 - Landwirt Fritz Hügel vom "Nien Ebbes Hof" (neuen Ebberg-Hof) in
Selscheid stirbt. Damit endet die Geschichte des Namens Hügel in Selscheid (früher
Höggel/Hügel), jetzt Werthmann'sches Haus. Aus diesem Haus stammte auch der letzte
katholische Geistliche von Ohle (1555, vor der Reformation).
S. 6 - Am 01.10.1927 sind die Erdarbeiten für die Straße Selscheid - Ohle abgeschlossen,
am 01.06.1928 ist die Baustraße bis Selscheid fertiggestellt., im Oktober 1928 ist
die Fahrbahn fertig, die Straße ist nunmehr mit schweren Lasten befahrbar. Der Beweis:
ein schwerer Lastwagen mit der Drei-Zimmer-Einrichtung für den Lehrer kam glatt den
Berg hinauf. - Seit Fertigstellung der Straße kommt zunehmend Kfz-Verkehr nach Selscheid,
was anfänglich ein großes Staunen bei der Selscheider Bergbevölkerung auslöst. Die
Straße wird zunehmend genutzt: Ärzte, Kranke, Lieferanten und 'bequeme Leute' freuen
sich über die Möglichkeit, mit dem Kfz bequem nach Selscheid zu kommen. Darunter sind
auch solche, die diese Straße als 'Bergprüfungsstrecke' nutzen und 'mit ihrem
Geknatter die sonst stille Gegend erfüllen. Selscheid - Dornröschen - erwacht!
Als angenehm empfinden es die Leute, dass uns die 'Monarchen' (Erdarbeiter) verlassen
haben. Sie waren uns etwas zu lebhaft. Das Schwingen von Beilen und Knüppeln,
Gewehrgeknatter und lärmendes Johlen, der Anblick von bis zur Bewußtlosigkeit
betrunkenen, viehisch und oft in schamloser Weise entblößt am Wege liegende Gestalten,
all' die Unruhe, sie liegt hinter uns wie ein böser Traum. Gott sei Dank!
Geplant war die Weiterführung der Straße bis Grimminghausen/Solmecke nach
Kleinhammer - der bisherige Waldweg dortin war in einem schlimmen Zustand -
doch Geldmangel verhinderte die Weiterführung des Straßenbaues. Waldwege waren
früher reine Interessentenwege, sie wurden von den Grimminghauser Bauern unterhalten.
Besondere Verdienste um den Ausbau zu einem befahrbaren Weg (früher war dort nur
ein Weg, der durch das Wasser der Solmecke und sumpfigen Boden führte) hat sich der
alte August Kirchhoff in seinen jüngeren Jahren erworben.
1930 - Im Sommer wird eine Wasserleitung zur Schule verlegt. - Der Brandteich
neben dem Werthmannschen Haus wird von der Feuerwehr für Übungen genutzt.
1931 - Im Sommer Aufstellung der Selscheider Feuerwehr. - Die Ohler Feuerwehr
erhielt eine Motorspritze, so dass die Handspritze an die Selscheider abgegeben
werden konnte. Damit gibt es in Selscheid erstmalig einen selbständigen Löschzug
(20 Mann).
1932 - Renovierung der Schule während der Herbstferien (neuer Innenanstrich,
außen wird das Holzwerk erneuert, der Abort außen gestrichen) durch zwei Erwerbslose,
die zwei Tage in der Woche Pflichtarbeit für die Gemeinde leisteten. "Wenn die Arbeit
auch nicht ganz sachgemäß ausgeführt wurde, so hat die Schule doch ein freundlicheres
Aussehen erhalten."
1932 - Zwischen Grimminghausen und Voßloh wird ein Brandteich (Feuerlöschteich)
angelegt. - Im Sommer
baute Landwirt Baberg ein neues Wohnhaus mit Stallgebäude. "Vorzügliche Steine
-Grauwacke - wurden aus dem 'Penninghahn' (?) gebrochen." Das alte Wohnhaus wurde
wegen des schlechten Daches abgebrochen.
S. 7 - 1933 - Am 30. Januar wird der Führer der nationalsozialistischen Bewegung
zum Reichskanzler ernannt. "Wenn auch die Not in unserem deutschen Volke (rund
6 Millionen Erwerbslose) in unserer engeren Heimat weniger spürbar ist, so griff
sie doch auch hier in einzelne Haushalte. Doch jetzt geht es aufwärts!"
1933 - März, Wahlergebnis im Ohler Gebirge: 80 Prozent Nationalsozialisten, der
Rest deutschnational. - Am 1. Mai beteiligen sich die Selscheider und die Schule
an den Mai-Feiern in Ohle. - November 1933: Die Bevölkerung unseres Schulbezirkes
bekennt sich restlos (100 Prozent) zum Nationalsozialismus.
1934 - Juni: Der Wiederaufbau bringt auch den Steinbruch in der Solmecke wieder
in Betrieb. Erleichterung für die Abfuhr durch Straßenneubau von Kleinhammer durch
das Tal der Solmecke. - Die Verbindungswege zwischen den einzelnen Gehöften lassen
sehr viel zu wünschen übrig, sind bei regnerischem Wetter fast unbegehbar.
September 1934: Der Schulbezirk Selscheid wird der Ortsgruppe Ohle der NSDAP als
selbständiger Block angeschlossen. Die Zahl VIII, eingeteilt in zwei Blockbezirke
(Selscheid und Grimminghausen).
1935 - April: Keine Arbeitslosigkeit mehr.
1936 - März: Planungen für einen Schulneubau durch die Regierungskommission, gleichzeitig
Planung einer Wasserleitung, da in trockenen Sommern die vorhandenen Brunnen nicht
ausreichen.
1936 - Juli: Das Grundstück für den Schulneubau - gegenüber dem Babergschen Haus - wird
erworben.
1936 - August: Die geplante Wasserleitung wird vermessen. Das Wasser soll unterhalb
des großen Teiches an der Solmecke aufgefangen und über den Hasenberg geleitet werden.
Ein Hochbehälter soll oberhalb von Selscheid am Hasenberg errichtet werden.
1936 - Juni bis September: Der Weg Selscheid - Grimminghausen wird ausgebaut und mit
einer festen decke versehen.
1936 - Oktober: Baubeginn für die Wasserleitung in der geplanten Weise. Infolge
anhaltender Regenfälle gestalten sich die Arbeiten sehr schwierig. - Beginn der
Ausschachtungsarbeiten für die Schule. Die gestalten sich schwierig, weil viel Fels
ansteht.
S. 10 - 24.11.1936: Richtfest für den Schulneubau.
1937 - 15. Juli: Einweihung der neuen Schule.
1938 - Karl Baberg beginnt neben dem Babergschen Haus mit Ausschachtungsarbeiten
für ein Wohngebäude. Material- und Arbeiterknappheit wegen des Baus des Westwalls.
Der Bau wird auch 1939 nicht fertig.
1939: Die Gutsverwaltung von Grimminghausen läßt am Wege zur Sechtenbecke ein neues
Waldarbeiterwohnhaus entstehen. Der Ausbruch des Krieges im August verzögert die
Fertigstellung.
S. 11 - Die Schulgemeinde wurde 1919 gebildet und umfasst folgende Ortschaften bzw.
Gehöfte: Selscheid, Erkelze, Winterhof, Sechtenbecke, Höh, Wiehard, Hechtenberg,
Voßloh, Grimminghausen, Hohagen und Breite(n)feld. Bis 1919 besuchten die Kinder
die zweiklassige Schule in Ohle. Von den Orten bzw. Gehöften der Schulgemeinde
gehören Grimminghausen, Voßloh, Hechtenberg, Höh, Wiehard, Hohagen und Sechtenbecke
zur gräflichen Herrschaft Grimminghausen im Besitz des Grafen Busche Kessel Ysenburg,
verwaltet von der Rentei-Verwaltung Neuenhof bei Lüdenscheid.
Schloss Grimminghausen ist in gutem baulichen Zustand, wird bewohnt von Förster
Kuhlmann. Reste des Wassergrabens sind noch gut erkennbar. - Die beiden Pachthöfe
in Grimminghausen, Schmidt und Kalthof, wurden früher von der Herrschaft verwaltet.
Die jetzigen Wohnhäuser der Pächter waren zu jener Zeit Scheune und Viehhaus.
Gegenwärtig ist die Familie Kalthoff seit 100 Jahren als Pächter in Grimminghausen
ansässig.
Dicht bei Grimminghausen liegt ein Land, das den Namen "Hopfengarten" führt -
wahrscheinlich wurde auf den naheliegenden Höfen einst Bier gebraut. Auch Kalk wurde
hier gebrannt. Das Holz der Hochstämme wurde in Kohlegruben verkohlt.
S. 12 - Die Namen der übrigen Pachthöfe stammen fast alle von ehemaligen Bewohnern,
z. B. Hechtenberg, Sechtenbecke, Voßloh. Die gegenwärtigen Pächter heißen:
Grimminghausen = Schmidt, Kalthoff
Voßloh = Schmidt und Bangert
Hechtenberg = Werthmann
Hohagen = Lengelsen
Höh = Volmer
Wiehardt = Hurst
Sechtenbecke = bis 1922 Schmidt, derzeit vom Wege.
Alle Pächterhäuser sind in keinem guten Zustand. Die Bewohner führen ein eintöniges
Leben. Elektrische Beleuchtung haben diese Häuser nicht, man geht also früh ins Bett,
im Winter teilweise schon um 20 Uhr. Die übrigen Höfe der Schulgemeinde in Erkelze,
Winterhof, Selscheid und Breitefeld gehören nicht zur Herrschaft Grimminghausen.
In Erkelze (früher Erkelsen) wohnen augenblicklich die Landwirte Becker (früher
Maiweg) und Schmidt. Außerdem wohnt im Hause des Landwirts Schmidt der Lehrer Büscher
und in einem Backhaus der Fabrikarbeiter Klüppelberg. Auf dem Winterhof wohnt der
Landwirt Hesmer und auf dem Breitenfeld der Landwirt Schulte und der Fabrikarbeiter
Kohlhage.
S. 13 - 1929: August vom Wege zieht nach Selscheid, bisher Gut Sechtenbecke. Er
pachtet das Hügel'sche Gut. In der Sechtenbecke wohnt nun Karl Neuhaus, bisher
Kleinhammer.
1930: Förster Kuhlmann von Grimminghausen tritt in Ruhestand, Nachfolger wird Förster
Alex Klärbaum (Grafen Busche-Kessel).
1932: Von Hohen[hagen] verzieht die Waldarbeiterfamilie Lengelsen. Nachfolger wird
die Familie Völlmecke aus Züschen/Winterberg.
1933: Im Februar verlässt Fam. Schmidt den Hof Voßloh und zieht nach Plettenberg.
Neuer Pächter wird der Invalide Focke de Wall aus Kleinhammer. - Auf der Wiehardt
wechseln die Pächter. Neuer Pächter wid Bauer Kohlhage aus Werdohl-Kleinhammer.
1934: Die Sechtenbecke wird niedergerissen und neu aufgebaut.
1935: Der Grimminghauser Bezirk erhält elektrisches Licht.
1936: Weg durch Solmecke von Kleinhammer zum Steinbruch wird ausgebaut.
1939: Pächter August Kohlhage von der Wiehardt verzieht nach Mühlenschmidthausen.
Neuer Pächter ist A. Löcken von Fröndenberg.
1939/1940: Forstverwaltung Grimminghausen errichtet neue Waldarbeiterwohnung am Wege
von Grimminghausen nach der Sechtenbecke. Waldarbeiter Völlmecke zieht von Hohenhagen
in das neue Haus. Auf dem Hohenhagen wird eine weitere Familie untergebracht: Familie
Brockmann von der Verse.
zurück
|