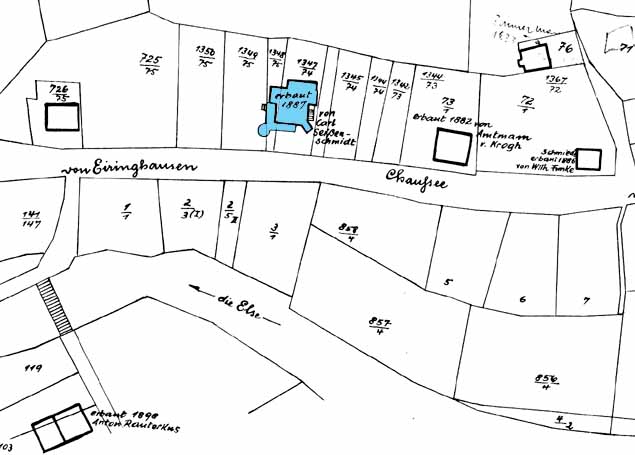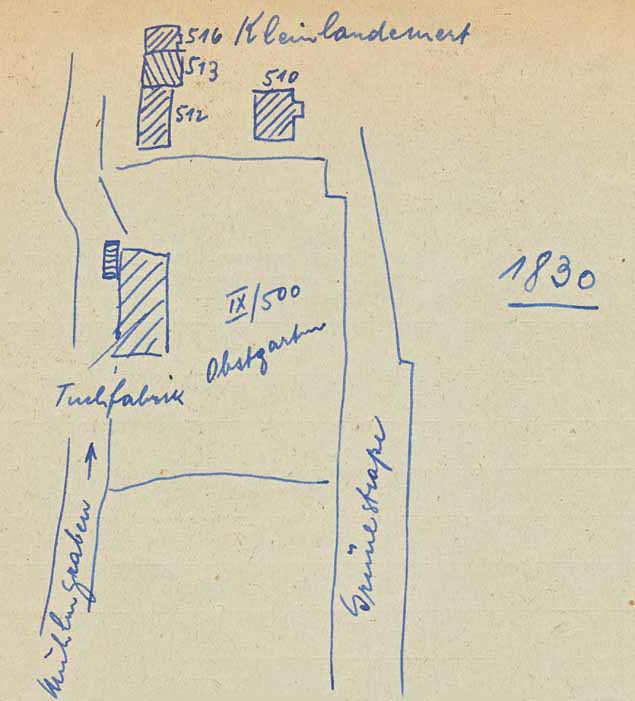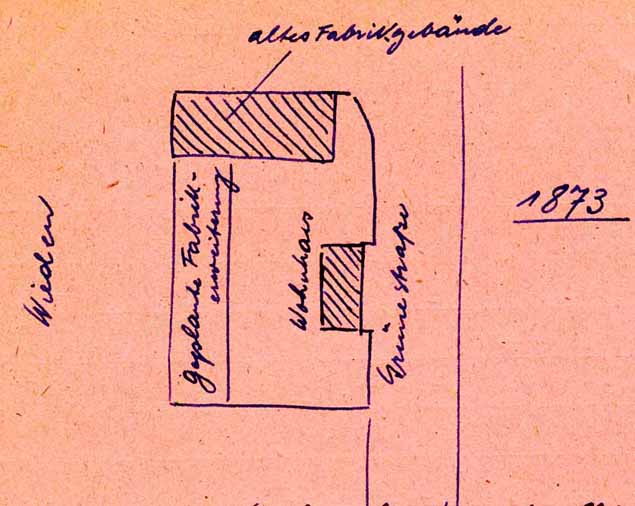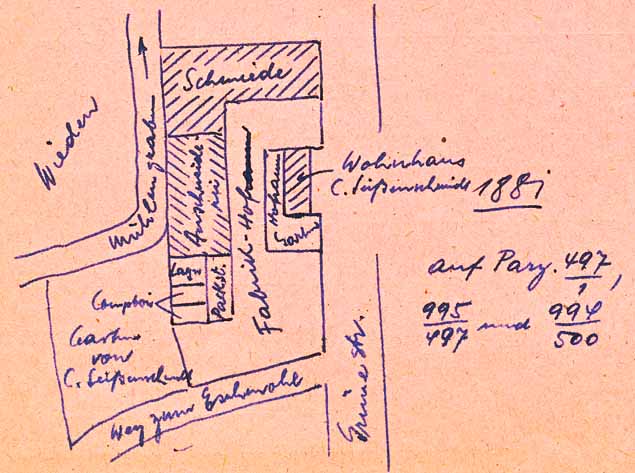|
Familie und Firma Seissenschmidt
Bereits in einer alten Urkunde des Boeler Hospital-Gutes aus dem
Jahre 1600 ist ein "Willem" aus der Familie Seissenschmidt erwähnt.
In der Folgezeit erscheinen in den Annalen immer häufiger
Mitglieder dieser Familie, nis sie etwa in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
die breiteste Streuung bzw. Verästelung erfahren hat. Dann tritt
die Familie immer weniger auf, heute sind Familien dieses Namens nicht
mehr in Plettenberg vertreten.
Obwohl, wie der Name besagt, der Stammvater dieses Geschlechts sich
mit der Sensenschmiederei befasst hatte, und dies sicher so intensiv,
dass ihm sein Beruf zum Familiennamen wurde, ist seit dem 30-jährigen
Kriege kein Sensenschmied mehr mit diesem Namen benannt. Fast
ausnahmslos waren die letzten Seissenschmidt-Familien Tuchmacher.
Der erste in der lückenlosen Stammfolge dieser Familie auftretende
Stephan Seissenschmidt war Küster der lutherischen Kirchengemeinde
und befasste sich außerdem mit der Tuchweberei. Unmittelbar nach
Beendigung des 30-jährigen Krieges, 1648, gründete er mit 17 anderen
Tuchmachern das Amt bzw. die Zunft der Plettenberger Tuchmacher.
Das Stammhaus der Familie Seissenschmidt ging im Stadtbrand 1725
völlig unter. An gleicher Stelle geschah in unveränderter Form
der Wiederaufbau. Weil das Haus in einem krummen Bogen der alten
Stadtmauer am Untertor lag, hatte es den Namen "In den Müren". Die
letzten Seissenschmidts, die das Haus bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts
bewohnten, hatten den Beinamen "in den Müren", meist unter
Auslassung des Familiennamens Seissenschmidt.
Doch ein Blick zurück auf die Anfänge der unternehmerischen Tätigkeit
der Familienmitglieder Seissenschmidt: Zwischen 1783 und 1788 kam die Familie Seißenschmidt in den
Besitz des Hauses Nr. 104 (IX/218), jetzt Westhelle, Wilhelmstraße.
Das Haus war sehr lange der Familie Wolff zu eigen. 1758 besaß
es der Sensenschmied und Kaufmann Joh. Christoph Wolff, 1783 dessen
Sohn, der Sensenschmied Christoph Diederich Wolff. Der erste
Besitzer aus der Familie Seissenschmidt war 1788 Joh. Christoph
Seissenschmidt. 1809 hatte es bereits Adam Seissenschmidt geerbt.
Nach dem Ableben der Eheleute Adam Seissenschmidt kam der
Tuchfabrikant Hermann Bernhard Seissenschmidt in den Besitz des
Hauses. Die gerichtliche Übereignung ist am 17.05.1832 vermerkt.
Nach dessen Tod wurde entsprechend einem im Jahre 1856 aufgestellten
Testament die Witwe H. B. Seissenschmidt geb. Wilhelmine Dunkel im
Jahre 1860 als Besitzerin vermerkt. 11 Jahre später erhielten die
beiden Söhne Wilhelm und Carl Seissenschmidt gegen Leibzucht und
Abfindung ihrer Schwestern das Haus.
1881 beantragte er die Genehmigung zum Anbau an der Hinterseite
des Hauses, die auch erteilt wurde. Mit dem verhältnismäßig großen
Anbau wurde sofort begonnen. Und es dauerte nur einige Monate und
das Richtfest konnte gefeiert werden. Sein Bruder Carl hatte inzwischen
auf dem Fabrikhof an der Grünestraße ein Wohnhaus gebaut. An der
Südseite war ein geräumiger Garten. Aber die unmittelbare Nähe der
tagein tagaus dröhnenden Hämmer behagte ihm nicht. Er brauchte am
Feierabend Ruhe. Beim Gang der schweren Hämmer klirrte das Geschirr
in den Schränken. Immer schwerere Maschinen wurden angeschafft, bis
Carl 1887 kurz entschlossen den Iserlohner Architekten Otto Leppin
mit dem Entwurf eines neuen Wohnhauses an der Bahnhofstraße
beauftragte. Mit dem Bau wurde sofort begonnen.
Durch den geplanten Anbau musste der Teich bei der Oester verschwinden
und der Mühlengraben verengt werden. Trockene Böschungsmauern wurden
errichtet. Müller Dunkel war einverstanden. Entschädigung für die
Benutzung des Wiedens für die Heranschaffung des Baumaterials wurde
gezahlt.
Die beiden Firmeninhaber wurden mit der Zeit uneins und schließlich
kam es zum Bruch. Schmalenbach verkaufte im Jahre 1844 seine ideelle
Hälfte am Fabrikgebäude und dem daran liegenden Baumhof sowie der im
Fabrikgebäude befindlichen Fabrikgerätschaften an den Plettenberger
Kaufmann P. D. Wever. Obwohl das Verkaufsrecht vertraglich so geregelt
war, dass jede der beiden Parteien gleichberechtigt war, d. h., wenn
einer verzichtete, das Verkaufsrecht auf den anderen überging, ließ
Seissenschmidt diesen Verkauf geschehen. Nur räumte er bei abermaligem
Verkauf für sich das Vorkaufsrecht wieder ein. Investiert wurde allerdings
nun weiter nichts, denn dazu war die allgemeine Wirtschaftslage zu
schlecht geworden.
Inzwischen war zwischen Nürnberg und Fürth die erste Eisenbahn in
Deutschland gebaut worden, und schon bald nach der Einweihung dieser
Bahn wurde der Wunsch allerorten laut, auch über eine solche Bahn oder
ein ähnliches Verkehrsmittel verfügen zu können. Besonders in stark
konzentrierten Gewerbegebieten wie z. B. Wuppertal, Ennepetal, Hagen
und Dortmund bildeten sich Komitees, die solche Projekte vorbereiteten.
Von einer deutschen Industrie von Eisenbahnbedarfsartikeln war zu jener
Zeit überhaupt noch keine Rede. Aber bald erwachte, speziell in Westfalen,
deutscher Gewerbefleiß zu eigenem Schaffen auf diesem Gebiete. So begann
auch Hermann Bernhard Seissenschmidt, zunächst nur in seiner bescheidenen
Fabrikhälfte zwischen Grünestraße und Wieden, im Oktober 1846 mit der
Produktion von Schwellenschrauben, Unterlegplatten, Waggonbeschlagteilen
etc..
Im Jahre 1852 ging P. D. Wevers Anteil durch Verkauf an D. W. Schulte
über, wogegen aber Hermann Bernhard Seissenschmidt sein vertragliches
Voraufsrecht geltend machte und in den Kaufvertrag eintrat. Abermals sah
er sich vor eine schwere Aufgabe gestellt. Die Finanzierung machte
Schwierigkeiten. Der Firmeninhaber nahm schließlich Verbindung zu einem
Kölner Bankhaus auf und damit neue Kapitalien unter Verpfändung eines
Teils seiner Liegenschaften auf. Dann wurde die ganze Fabrikanlage
vergrößert und die Schmiedeanlage erweitert. Der Wasserantrieb wurde
verbessert bzw. erneuert. Weitere Ambosse wurden angeschafft und
schließlich kamen kleine Fallhämmer hinzu, die damals noch von Hand gezogen
wurden. Gleichzeitig wurden auch viele Versuche angestellt, um ein
brauchbares Gewinde auf die verschiedenen Sorten Schrauben günstig
anbringen zu können. Als einer der ersten Plettenberger Firmeninhaber
stellte Seissenschmidt im Jahre 1858 bei der Regierung in Arnsberg
einen Antrag zum Aufstellen eines Dampfkessel und einer Dampfmaschine...
|