|
von P. D. Frommann (Druck und Verlag: Süderländer Tageblatt, 1953)
Bemerkungen des Verfassers: Diese Beiträge zur Geschichte Plettenbergs sind keine
zusammenhängende Arbeit, sondern eine Zusammenstellung von im Laufe der letzten Jahre
im Süderländer Tageblatt erschienenen Aufsätze. Daraus erklärt sich, daß wenige Tatsachen
zweimal erwähnt werden.
|
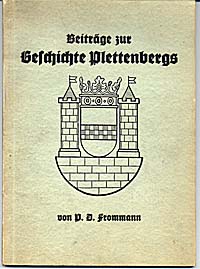
|
Manche Orts- und Flurnamen werden im täglichen Leben gebraucht, ohne daß der Sprecher die
in dem Wort enthaltene Bedeutung kennt. Das ist deshalb bedauerlich, weil viele dieser Namen
wertvolle Aufklärung über Bodenform, Bodenart und -wert, über Namen und Beschäftigung
einzelner Personen vergangener Geschlechter, über Tiere und Pflanzen der Vergangenheit und
Gegenwart geben. Andere führen uns in Geschehnisse längst vergangener Jahrhunderte zurück,
gestatten Einblicke in die Rechts- und Kultus-Verhältnisse der Vorfahren.
|
|
Es gibt auch Orte, denen man willkürlich einen anderen Namen gegeben hat. Die "Schöttlerei" hieß vor Jahrhunderten Kalmecke, "Marl" hieß Marendal, "Hengstey" 1409 noch Hemsteden. Dasselbe Wort hat auch nicht überall denselben Inhalt. Bollwerk bezeichnete bei Dahl eine ehemalige Bergbefestigung, bei Oberbrügge ein Hammerwerk; Hasley bei Hagen eine mit Haseln bewachsene Aue, bei Frehlinghausen eine von Hasen belebte Waldfläche, ein "Hasenlöh". Aber nach der Überwindung der Deutungsschwierigkeiten werden die Orts- und Flurbezeichnungen wertvolle und zuverlässige Quellen für die Geschichte unserer Heimat. An die frühere Form der Talsohle an der mittleren Lenne erinnert noch der mehrmals dort vorkommende Flurname Wert oder Werder, der eine Flußinsel bezeichnet. Oestlich von Eiringhausen ist der Bannewerd, bei Teindeln der lange Werd. In Ohle heißt ein Haus auf dem Werde, obwohl dort keinerlei Spuren von einem Wasserlauf mehr zu sehen sind. Daß früher aber solche gwesen sind, beweisen die tiefen Rinnen in der Weide zwischen Ohle und Elhausen, besonders bei hohem Wasserstande. Eine Vertiefung an der Nordseite der Eisenbahn zwischen Ohle und Brüninghausen ist noch so wasserreich, daß man dem Wasser einen Durchlaß unter den Eisenbahnschienen hat lassen müssen. Im unteren Elsetale liegt liegt in der Gegend des Amtshauses der Rennewert. Jetzt gibt es noch einen kleinen Werder bei Ohle und einen größeren in Werdohl zwischen dem Zoppe genannten Lennearm und dem Lennebett. Neben Werder fällt an der mittleren Lenne der Name Ohl auf, der ein von einem Flusse, meistens an einer Krümmung angeschwemmtes Gelände bezeichnet. Dort kommt dreimal Ohl vor. Zur Unterscheidung von dem Ohle, auf dem das Dorf erbaut ist, hat man das untere Eynole (aus "te Eynole" ist Teindeln geworden) und das der Blemke-Mündung gegenüber Blemole genannt. Ein viertes Ohl gibt es auch an der Else, nicht weit von ihrer Mündung. An der mittleren Lenne haben viele Orte das Grundwort Ohl: Bamenohl, Pasel, Siesel, Ohle, Teindeln, Wintersohl, Werdohl, Dresel und Stortel. Pasel hieß ursprünglich Palsole, wohl deshalb, weil auf dem dortigen Ohle viele Salweiden mit Palmkätzchen wuchsen. Werdohl errichtete man auf einem Ohl gegenüber von einem Werder. In dem von Franken besiedelten bergischen Lande gibt es auch manche Ortsnamen mit Ohl an der oberen Agger und an der Wipper. An die frühere große Bodenfeuchtigkeit des Lennetales erinnern noch die Namen: Soen (Sout = Sumpf), Wiebecke (Wie = Wiehen oder Weiden), Brockhausen, Eschen, Mähbruch bei Eiringhausen, Elhausen (Erlenhausen). In den Namen der in die Lenne fließenden Bäche: Raffelmecke, Bommecke, Sugmecke, Wörtmecke, Jeutmecke (alte Form "Jäupecke", abgeleitet von Jauberg), Wiebecke, Blemcke, Sillbecke, Olmecke (sie mündet auf dem Ohl; die Ölmühle an diesem Bache ist erst im vorigen Jahrhundert erbaut) ist nur in Wiebecke und Sillbecke das Grundwort Becke noch unverändert geblieben. In den meisten mit Becke zusammengesetzten Namen ist statt der letzten Silbe des Bestimmungswortes und des B des Grundwortes ein "m" gekommen. So wurden auch aus Bredenbecke Bremcke, aus Beerenbecke Bermke, aus Langenbecke Lamecke, aus Lingenbecke Limecke. Einige Berge zu beiden Seiten des Lennetales hatten in alter Zeit besondere Bedeutung für unsere Vorfahren. Auf dem Sundern bei Ohle, den die Franken im 8. Jahrhundert aus dem Markengebiet für den Landesherrn aussonderten, errichtete man schon unter der sächsischen Herrschaft ein großes Heerlager, die Hünenburg, von welcher unsere Gegend lange Zeit beherrscht worden ist. Auf den dunklen Schieferfelsen des Schwarzenberges ließen märkische Drosten im 14. Jahrhundert eine Grafenburg erbauen, die 5 Jahrhunderte lang der Sitz der Verwaltung des Amtes Schwarzenberg, später Plettenberg genannt, gewesen ist. Zu ihr gehörte auch das von der Lenne umflossene und geschützte Talgelände, das den Burgbewohnern als Baumhof gedient hat. Kultische Bedeutung hat offenbar schon zur Zeit des Heidentums der Heiligenstuhl gehabt, dem der Rabenkopf vorgelagert ist. Weil der Rabe der Vogel Wodans war, so hat man auf dem Heiligenstuhl vermutlich Wodan verehrt. Nach der Christianisierung unserer Vorfahren machte man anscheinend die gewohnten Wallfahrten nach dieser Bergeshöhe auch noch weiter, gab ihnen aber eine andere Bedeutung und errichtete dort als christliches Symbol den Heiligenstuhl, der 1560 aber nicht mehr dort war. Der Gipfel des nach den dort wachsenden Himbeeren (Hemmeten) benannten Hembergs scheint eine Stätte des Donarkultes gewesen zu sein, zu der man auch im Mittelalter noch wallfahrtete. Pastor Reininghaus bezeichnete um 1750 als "heilige Oerter" das heilige Land bei der Bremcker Linde, an der Bracht das Heiligenhaus und den Kluseners Siepen, auch einen solchen in der Almecke. Heiligenhäuser standen standen im Mittelalter auch bei Pasel und bei der Bremcker Linde. Die Flurnamen Hillenborn bei Köbbinghausen und Holthausen, Heilgenbrunn bei Herscheid, Hilgen Busch beim Winterhof, deuten auch auf heidnischen Kult, der Name ter Klusen bei Holthausen auf einen Einsiedler. Im Gebiet der Stadt Plettenberg liegen 8 Orte, deren Namen mit "inghausen" endet: Bödding-, Eiring-, Brüning-, Hilfering-, Grimming-, Frehling-, Köbbing-, Dingeringhausen. Die Orte mit inghausen sind größtenteils Familiengründungen und deshalb Dörfer und Weiler. Ihr Bestimmungswort enthält meistens den Namen des Gründers der Ortschaft. Dieser ist aber vielfach schon so sehr verdunkelt, daß schon daraus auf ein hohes Alter geschlossen werden muß. Cramer bezeichnet die mit ing als altfränkisch. Im märkischen Sauerlande gibt es 75 dieser Ortsnamen, im Bergischen nicht viel weniger. Im Kreise Iserlohn hat man die Silbe "hau" fallen lassen, z. B. Evingsen, abenfalls in der Gemeinde Werdohl, im Amte Herscheid seit dem 18. Jahrhundert sogar ghausen, z. B. Rärin, Sirrin, Alfrin, nicht in Hüinghausen.
Das auch in einigen hiesigen Flur- und Ortsnamen enthaltene fränkische Grundwort
"scheid" (scetha) kommt sehr viel vor im märkischen Sauerlande, im Bergischen, an
der unteren Sieg und westlich vom Rhein bis über Saarbrücken hinaus. An manchen
Ortsnamen mit "scheid" kann man deutlich erkennen, dass sie ursprünglich Flurnamen
gewesen sind. Renscheid und Timscheid in der Ohler Gemarkung sind
heute noch nicht besiedelt. Die Ortschaften Herbscheid und Walscheid
bei Werdohl entstanden erst in den letzten Jahrhunderten nach Teilung der Marken.
Scheid bezeichnet meist eine Grenz-, Wasser- oder sonstige Scheidung. Südwestlich
vom Sundern grenzen aneinander die Fluren von Selscheid und Erkelze
und dem Berge Renscheid. Sei (Sielen) ist eine Einsattelung im Gebirge, ein
Durchlass für den Verkehr. Statt Erkelze schrieb man im 16. Jahrhundert
Erkelsche und wird es auch so gesprochen haben, wie man auch jetzt im Platten statt
Selscheid noch Selsche sagt. Darum ist die richtige Form des Namens Erkelscheid.
Oestlich von der Lenne und nördlich von der Ruhr hat "scetha" unter sächsischem
Einflusse die Form "schede" erhalten, z. B. Leinschede, Dröschede, Brenschede. |