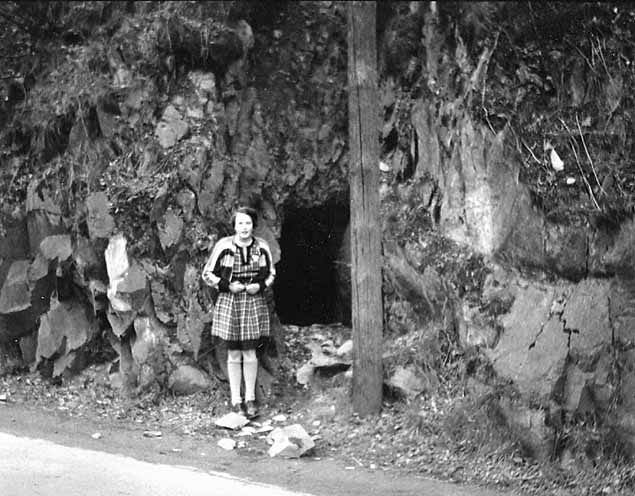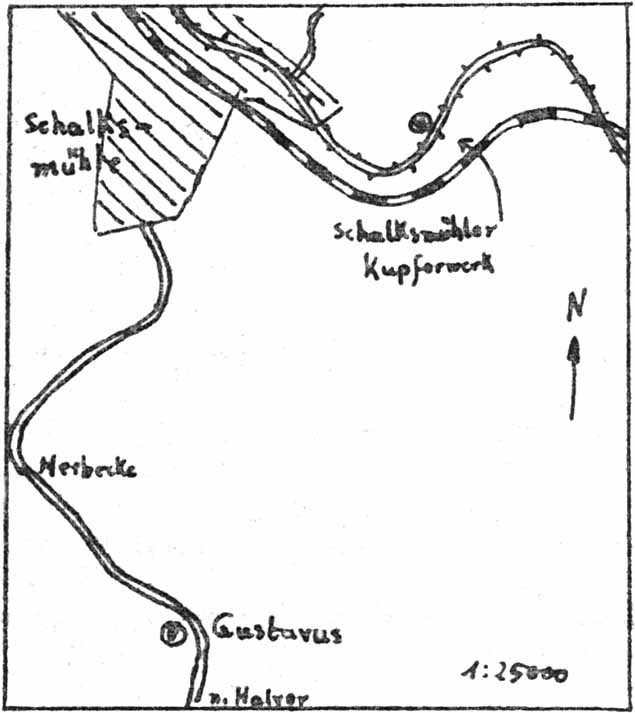|
Sprengstofffabrik im Sterbecketal
Quelle: WR Schalksmühle vom 20.10.2009
Karsten Binzyk erforscht Stollen
Schalksmühle.
Verlassen, verschüttet und vergessen interessieren sie heute nur noch einen kleinen Kreis
von Heimatforschern, die dieses Kapitel heimischer Industriegeschichte für die Nachwelt
bewahren wollen. Zu den fleißigsten Forschern im Märkischen Kreis gehört Karsten Binczyk.
Der Lüdenscheider hat jetzt am Ortseingang von Schalksmühle ein altes Kupfererzbergwerk
aus dem 19. Jahrhundert erforscht.
Mosaikstein für Dokumentation
Beim Betreten des Stollens zeigte sich ein Gang in einer Länge von acht Metern. Er hat eine
lichte Höhe von 1,70 Meter und eine Breite von 70 Zentimetern. „Ich habe so gerade hineingepasst”,
scherzt Karsten Binczyk. Der Stollen wurde von Hand in den Felsen geschlagen. „Reste von
Bohrlöchern, die vom Sprengen herrühren, habe ich nicht gefunden.” In heimatkundlichen
Veröffentlichungen wird der Stollen als verstürzt und eingefallen bezeichnet. „Das ist nicht
so”, korrigiert der Bergwerksforscher. „Der Stollen endet ganz einfach nach acht Metern. Eine
Förderung von Erzen hat im diesen Teil des Grubenfeldes nicht stattgefunden.”
Dass überhaupt an dieser Stelle nach Kupfererz gegraben worden ist, kann Karsten Binczyk
jedoch verstehen. Aus alten Dokumenten geht hervor, dass der Schalksmühler Ingenieur Albert
Reinecken und der Obersteiger Theodor Schulte am 6. Dezember1880 beim Bergamt eine Mutung
auf Kupfererze einreichten. Sie vermuteten ein gewinnbringendes Kupferzvorkommen, da das
Areal im Bereich einer tektonischen Störung liegt und sich dort durch hydrothermale Lösungen
Quarzgestein gebildet hatte, das häufig Kupfererze enthält. In diesem Fall war der Gang
jedoch taub und damit die ganze Arbeit umsonst.
Deswegen konzentrierten sich die Arbeiten damals auf den Bereich der gegenüberliegenden
Talseite. Dort, wo heute die Bahntrasse verläuft, wurde tatsächlich Kupfererz gefunden.
Quelle: Fritz Bertram "Bergbau im Bereich des Amtsgerichts
Lüdenscheid" von 1952-54, S. 214
3. Schalksmühler "Kupferwerk"
Dieses Grubenfeld wurde in den Gemeinden Halver, Hülscheid und Lüdenscheid
von Albert Reinicke und Obersteiger Theodor Schulte aus Schalksmühle am
06.12.1879 gemutet und an diese am 09.07.1880 verliehen. Es ist leider nicht
mehr zu erfahren, ob hier ein größerer Betrieb umgegangen ist. Alte Leute
berichten, dass im Laufe der Zeit immer wieder in dieser Grube gearbeitet
worden ist.
Der Stollen wurde unmittelbar am nördlichen Straßenrand der Bundesstraße 54
(Brügge - Hagen) angefahren. Man kann das Mundloch noch sehr gut erkennen
und leicht finden, wenn man unmittelbar hinter der ersten großen Kurve hinter
Schalksmühle gemäß Karte auf Seite 213 den linken Straßenrand betrachtet.
Der Stollen setzt unmittelbar an der Straße an und ist heute noch etwa 5 m
weit zu begehen, dann ist er eingefallen. Die beiden Bilder 78 und 79 geben
uns eine Anschauung der heutigen Situation wider.
Quelle: "Schalksmühle", Beiträge zur Heimat- und Landeskunde,
herausgegeben vom Heimatbund Märkischer Kreis eV, Sept. 1996, S. 26 ff.:
Bodendenkmäler in Schalksmühle von Bernd Gohlicke
Gruben, Pingen und Verhüttungsplätze
In Schalksmühle wie auch in den übrigen Städten und Gemeinden des
Märkischen Kreises existieren viele Spuren, die auf den Abbau und
die Weiterverarbeitung heimischer Bodenschätze hinweisen. Neben
alten Steinbrüchen, die Baumaterial lieferten, fallen besonders die
bergbaulichen Anlagen zur Gewinnung von Erzen und Mineralien auf.
Mit einfachsten Werkzeugen wurden die Lagerstätten in früheren Zeiten
ausgebeutet. Pingen, das sind tiefe Mulden im Gelände, Stollen,
Luftschächte oder Schutthalden zeugen noch heute davon.
Auch Kupferabbau hat in Schalksmühle stattgefunden. Hierfür stehen die
Gruben "Schalksmühler Kupferwerk" bei Niederworth und "Gustavus"
südlich von Herbecke. Von der Grube Gustavus sind noch ein Stolleneingang,
eine Mulde und einige Halden vorhanden.
Quelle: Fritz Bertram "Bergbau im Bereich des Amtsgerichts
Lüdenscheid" von 1952-54, S. 213
2. Kupfererzgrube "Gustavus"
Dieses Lager wurde zufällig von dem Gustav Göbel an der Straße von
Schalksmühle nach Halver (Oeckinghausen) entdeckt. Der Mutungsbericht
der Mutung vom 30.06.1862 besagt, dass das Kupfererzlager direkt zu
Tage ausstrich und der Malachit deutlich zu sehen war. Man hatte einen
5 Ltr. tiefen Stollen getrieben in Grauwackenschiefer, der h W 5 1/4
streichend mit 60 Grad nach Süden einfiel. Man fand 19 Zoll mächtigen
Quarz mit Funken und größeren Partien von Kupferkies. Der Malachit war
nicht nur auf den Klüften, sondern auch in den Quarzmassen und Hohlräumen
zu finden. Selbst das Liegende führte im Grauwackenschiefer noch
Kupferkies.
Nach dem Tode des Inhabers wurden seine 5 Kinder als Inhaber der Grube
Gustavus eingesetzt. Mit Schreiben vom 08.07.1918 begehrte der Leutnant
von Maenen als Alleinerbe sämtliche Kuxen. Und mit Schreiben vom
18.08.1934 begegnen wir demselben H. v. Maenen, nun Postoberinspektor
a. D. aus Köln-Nippes, der wiederum seine alten Rechte wahrnimmt (GBA
Lüdenscheid). |