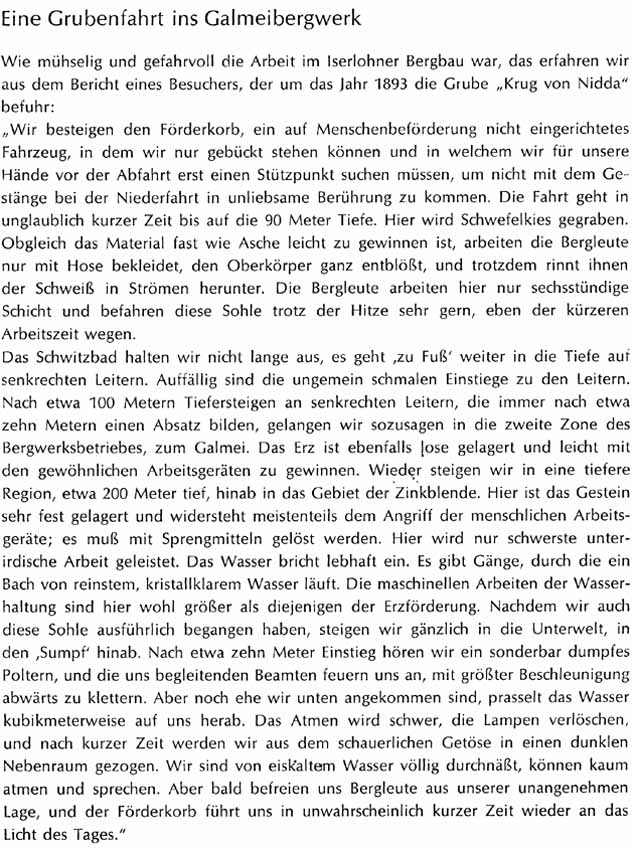|
Quelle: "Liebes altes Iserlohn",
Herausgegeben von Fritz Kühn,
Neuausgabe 1967, S. 39; Verlag: Buchhandlung Alfred Potthoff - Iserlohn/Westf.
. . . stillgelegte Schächte des
". . . Iserlohn hatte nun eine neue Wasserversorgung,und Disselhoff
wurde der erste Technische Direktor des Wasserwerks. Und die
Iserlohner waren glücklich, das köstliche Wasser aus den angrenzenden
Bergen genießen zu können. Sie zahlten dafür
25 Pfennig pro Kubikmeter bei einer Abnahme bis zu 100 Kubikmeter,
bis zu 500 Kubikmeter wurden 20 Pfennig verlangt, und
wer mehr als 500 Kubikmeter bezog, zahlte 15 Pfennig.
Allerdings ergab sich recht schnell neuer Handlungsbedarf.
Zur Jahrhundertwende war die Einwohnerzahl auf nahezu
27.000 gewachsen, und der Pro-Kopf-Verbrauch stieg ständig.
Hinzu kam, dass die Quellen weniger ergiebig waren als in früheren
Jahren. Für kurze Zeit wurde erwogen, eine Talsperre im
Wermingser Tal oder im Obergrüner Tal zu errichten; aus
Kostengründen ließ man diesen Plan jedoch wieder fallen. Eine
Trockenperiode im Jahr 1901 führte dazu, dass neue Wasservorkommen
aus dem Bereich stillgelegter Schächte des Galmeibergbaus
erschlossen wurden. Nach langwierigen Verhandlungen
gelang es, vom Bergwerksverein sowohl den Westiger
Schacht als auch den Schacht »Krug von Nidda« zu erwerben.
Das Wasserwerk »Krug von Nidda« hat seinen Namen von
»Seine Exzellenz, der Wirklich Geheime Rath, Oberberghauptmann
Dr. Otto Krug von Nidda« aus dem preußischen Ministerium
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
Der Westiger Schacht liegt etwa 50 Meter tief im Kalkgebirge und
besitzt ein ausgedehntes Stollennetz. Der Schacht wurde zu
einem Pumpwerk ausgebaut; zunächst mit einer durch Sauggasmotor angetriebenen Tiefbrunnenkolbenpumpe – eine
zweite, gleicher Art, wurde einige Jahre später eingebaut. Der
Westiger Schacht konnte innerhalb von 24 Stunden etwa
3.000 Kubikmeter Wasser fördern.
Die Anlage samt der 4,5 Kilometer langen Rohrleitung zum 85
Meter höher gelegenen Hochbehälter auf der Hardt war 1905
fertig gestellt. In diesem Jahr begann man auch mit dem Bau
eines zweiten Hochbehälters am Mühlenberg. Er liegt 26 Meter
höher als der Hochbehälter auf der Hardt. Um die Quellen im
Lägertal besser ausnutzen zu können, wurde dann im Jahr 1914
eine zweite Rohrleitung von 175 Millimeter Durchmesser von
der Brunnenkammer im »Rudolfstollen« zum oberen Behälter
am Mühlenberg verlegt. Gleichzeitig förderte die vorhandene
Leitung das Wasser aus den tiefer gelegenen Siepen- und Sickerleitungen
nach wie vor zum unteren Hochbehälter auf der Hardt.
Wie sinnvoll diese Investitionen waren, sollte sich spätestens
im Jahr 1921 zeigen. Es herrschte eine beispiellose Trockenheit.
Die Quellgebiete versiegten zuweilen fast vollständig; wenn
sie vorher täglich 3.500 Kubikmeter geliefert hatten, dann
gaben sie jetzt nur noch 700 Kubikmeter oder weniger. So
wurde das Westiger Werk mit seiner inzwischen auf zwei Tiefbrunnenpumpen
erweiterten Anlage sozusagen zum Retter in
der Not. Die Pumpen arbeiteten Tag und Nacht. Damit sie nicht
trocken liefen, musste sogar ein Taucher die Saugrohre im
Schacht tiefer legen. Außerdem musste eine provisorische
Pumpenanlage im »Krug von Nidda«, die eigentlich nur als
Aushilfe gedacht war, voll eingesetzt werden. So überstand
man den ungewöhnlich heißen und trockenen Sommer . . ."
|