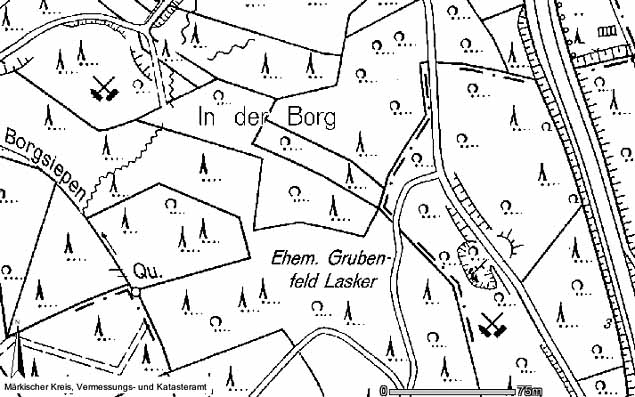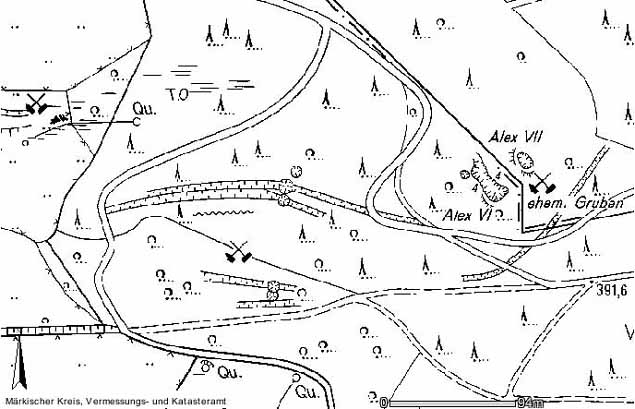|
Quelle: Kierspe - Märkischer Kreis, Festschrift zum Kreisheimattag 1990, S. 67-71 Das Hülloch
Der Erzbergbau
Von Willi Binczyk
Unser Gebiet war bereits zur Steinzeit von Menschen bewohnt. Mit Sicherheit
trifft diese frühe Besiedlung für Nachbarregionen, wie z. B. für das
Hönnetal zu. Die dortigen Höhlen boten den frühen Bewohnern Schutz gegen
wilde Tiere und gegen die Unbilden der Witterung.
Die Menschen lebten damals von der Jagd und Fischerei. Hinzu kam später
die Landwirtschaft als Haupterwerbsquelle. Mit zunehmender Besiedlung
reichten jedoch die Erträge aus der Landwirtschaft nicht mehr aus, da
die wenig fruchtbaren Böden, in Verbindung mit den ungünstigen klimatischen
Verhältnissen, unserer bergigen Landschaft zu wenig hergaben. Auf der
Suche nach neuen Existenzgrundlagen brauchte man sich jedoch im märkischen
Sauerland nicht lange aufzuhalten, denn beim Graben nach Bodenschätzen
wurden die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes schnell fündig, indem
man auf Eisenerz stieß.
Auf Kiersper Stadtgebiet findet man noch heute die Spuren dieses frühen
Erzabbaus (Stollen-, Graben- und Trichtergrubenpingen). Das Eisenerz
wurde meist im Tagebau mit einfachen Werkzeugen geschürft. Die Gruben
und Gräben nennt man Pingen. Durch einen Waschvorgang wurden die lehmigen
und tonigen Verunreinigungen der Erze beseitigt. Es wurde jedoch auch
Erz durch Vortreiben von unterirdischen Stollen gefördert. Diese Form
des Erzabbaus ist ebenfalls noch gelegentlich aufgrund von erhaltenen
Stollenmundlöchern und Berghalden erkennbar. Auch Spuren der frühen
Eisenverhüttung sind noch aufzuspüren. Vor dem Schmelzen wurde das Erz
durch Rösten für die Verhüttung vorbereitet, dann in den sogenannten
Rennöfen (früheste Form der Eisenverhüttung) und später in den Massenhütten
geschmolzen. Die Verarbeitung des Metalls zu einfachen Geräten und
Werkzeugen geschah anfangs in den Waldschmieden.
Durch den damals großen Waldreichtum war stets gewährleistet, dass
ausreichend Holz zur Herstellung des Brennmaterials für die Erzverhüttung
vorhanden war. Aufmerksamen Wanderern fallen in den Wäldern die noch
an vielen Stellen vorhandenen kreisrunden, schwarzen, ehemaligen
Kohlenmeilerplätze auf.
Vom 14. bis in das 20. Jahrhundert lieferten auch in Kierspe die
Bachläufe die Energie für den Antrieb der Wasserräder, wie beispielsweise
für das Wasserrad, welches vermutlich den Blasebalg des nur 200 m
südlich von Haus Rhade Ende des 13. Jahrhunderts bereits in Betrieb
befindlichen Masse- oder Stückofens angetrieben hat. In unmittelbarer
Nähe, im "Gokesberg" zwischen Rhade und Bollwerk, ist übrigens in
den dort heute noch vorhandenen Gruben bereits in sehr früher Zeit
Erz im Tagebau gewonnen worden. Ferner ist in einem Vertrag aus dem
Jahre 1725 die Nutzung der Rhader Kalkgrube - Kalk ist als Zuschlag
für die Eisenverhüttung erforderlich - im einzelnen geregelt.
Abbauwürdige Erzgänge und -lager befanden sich außerdem in Griesing,
Homert-Wehrhahn, Arney, Graefingholz, auf der Mark sowie in der
Ebbeverwerfung. Es wurde überall nach Erz gegraben. Nur der Ortskern
von Kierspe selbst blieb vom Bergbau frei.
Nachstehende Aufstellung gibt eine interessante Übersicht für die von
1858 bis 1902 in und um Kierspe verliehenen Bergwerksfelder:
Gruben Alex VI und VII
Die meisten erzführenden Verwerfungen sind heute noch für den Kenner
leicht an der Geländestruktur zu erkennen. Auf den Verwerfungen wurden
Schürfschächte abgeteuft und eisenhaltige Gangvorkommen angefahren. Die
Gänge wurden vermessen und am Fuß des Berges im Stollen wieder aufgeschlossen.
Man stellte 2 1/2 Zoll mächtiges Erzvorkommen und 20prozentiges Brauneisen
fest. Nach diesem Aufschluss wurden die Arbeiten wieder eingestellt und
die Grubenfelder mehrmals verkauft. 1987 sind sie ebenfalls "ins Freie"
gefallen. |