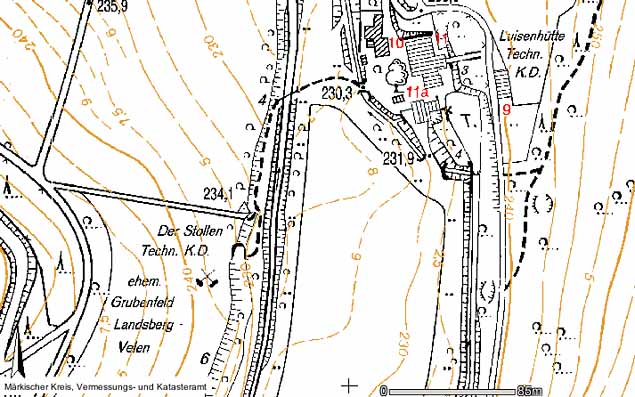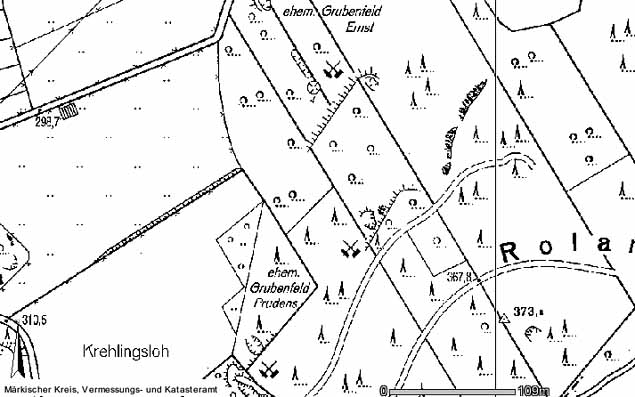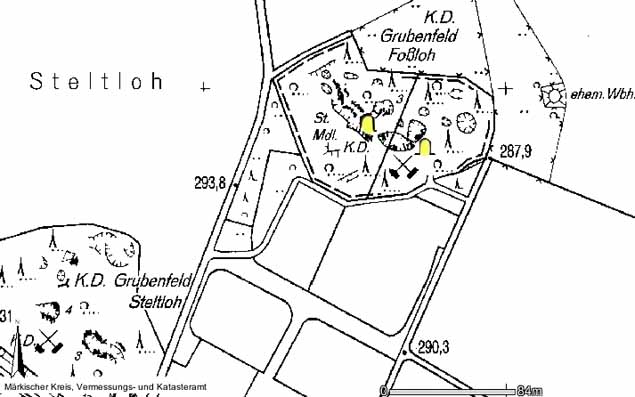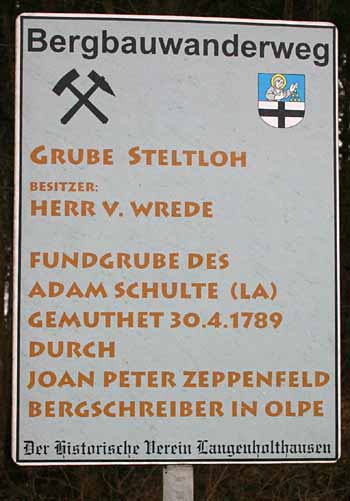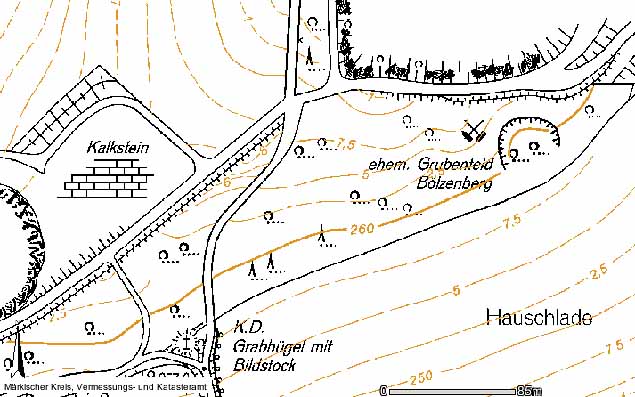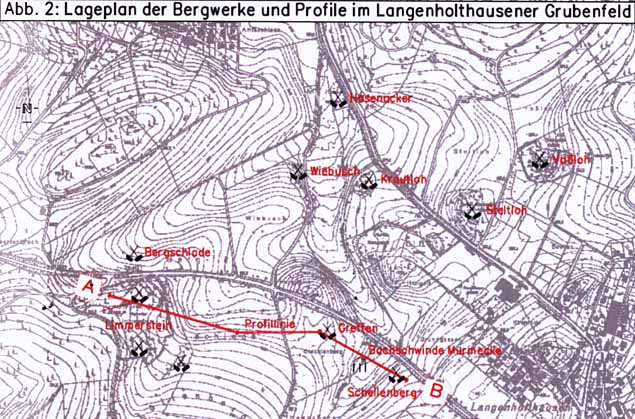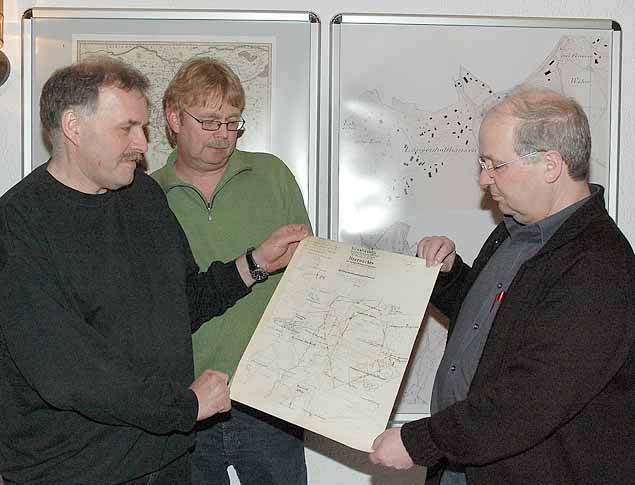|
Quelle: Balve - Buch vom Werden und Sein der Stadt, 1930 zur 1000-Jahr-Feier, S. 297-311 (in Auszügen)
Bergbau und Hüttenwesen im Bereich Balve
Von 1. Bergrat i. R. Adolf Goebel, Arnsberg
. . . Das Gebiet des Amtes Balve umfasst 40 Grubenfelder, von denen
20 auf Eisenstein, 5 auf Schwefelkies, 5 auf Zinkerz, 2 auf
Blei- und Zinkerz, 1 auf Eisen- und Manganerz, 1 auf Eisen-
und Zinkerz und 3 auf Marmor verliehen worden sind. Einige
Felder greifen in ihrer Erstreckung über die Amtsgrenze hinaus.
Die Lage der Felder ist auf der amtlichen Mutungs-Übersichtskarte
eingetragen.
Die Namen der Felder, in den einzelnen Erzgrubben nach der
Buchstabenfolge geordnet, mit den Namen der gegenwärtigen Besitzer
oder Repräsentanten und dem Jahre der Verleihung, dem amtlichen
Bergwerksverzeichnis entnommen, sind nachstehend aufgeführt:
Eisensteinfelder
Eisen- und Manganerzfeld
Eisen- und Zinkerzfeld
Schwefelkiesfelder
Bleierzfelder
Zinkerzfelder
Blei- und Zinkerzfelder
Marmorfelder
Von diesen sämtlichen Feldern ist gegenwärtig kein einziges in Betrieb. Im Betrieb
gewesen, wenn auch nur vorübergehend und in bescheidenem Umfange, sind
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die sperrgedruckten Namen (3, 6, 8, 9, 11,
14, 16, 20, 31, 37) - 8 Eisenerz-Felder und je 1 Zinkerz- und 1 Blei- und
Zinkerzfeld. Die übrigen Felder sind nicht über die Verleihung hinausgekommen.
Seit etwa 1865, also fast seit 70 Jahren, ruht jeglicher Bergwerksbetrieb im
Amte Balve.
e) Bergtechnisches
Henseneiche, bereits 1790 dem Grafen Johann Ignatz Franz von
Landsberg als Längenfeld verliehen, liegt am untersten Hammer bei
Wocklum und baute sowohl auf einem, in spätigem Kalkstein des Massenkalks
aufsetzenden Roteisensteingang, als auch auf einzelnen, in Lettenschichten
des Kalkspats eingebetteten edlen Eisensteinnieren. Zuerst wird 1811
ein Betrieb erwähnt, dann erst wieder 1825; jahrelang war er unterbrochen.
Die Gruben "Husenberg", "Glückauf" und "Landsberg"
markscheiden miteinander. Auf allen drei Gruben trat Rot- und schwarzer
Toneisenstein mit Schiefer im Hangenden und Grünstein im Liegenden auf.
Der Eisenstein war so stark mit Schwefelkies durchsetzt, dass er nicht
verhüttet werden konnte, "sofern er nicht durch Rösten oder Auslaugen
seine schädlichen Eigenschaften verlieren sollte". Edle Mittel
wechselten mit tauben ab.
Voßloh. Die Grube kam 1848 als Längenfeld zur Verleihung auf
Eisenstein, Bleierz und Galmei, die nesterartig auf der Scheide
zwischen Massenkalk und Schiefer am sog. Voßloh in der Gemarkung
Langenholthausen auftraten. Da in den ersten Jahren des Betriebes
von 1851 bis 1853 die Gewinnung sich lediglich auf Eisenstein
beschränkte, wurde von anderer Seite die Freierklärung des Feldes
für Blei- und Zinkerze beantragt, der Antrag jedoch 1854 vom
Bergamt Siegen mit der Begründung zurückgewiesen, dass es für die
Erhaltung einer Berechtsame gleichgültig sei, ob der Bergwerkseigentümer
ein oder alle verliehenen Minerale abbaue.
Nach mehrjähriger Ruhe wurde der Betrieb anfangs 1858 wieder
aufgenommen und bis 1860 fortgesetzt. Da schließlich nur
minderwertiger kalkhaltiger Roteisenstein gefördert wurde, auch
weitere Aufschlüsse durchaus ungünstig ausgefallen und die
Wasserzugänge immer stärker geworden waren, kam die Grube
noch im selben Jahr zum Erliegen.
Bölzenberg. Das Feld am Bölzenberg, in den Bergkaulen
bei Wocklum gelegen, führte zinkhaltigen Brauneisenstein und
als Seltenheit reinen ausgeschiedenen kohlensauren Galmei. Die
Grube war schon in alten Zeiten, lange vor der Besitznahme des
Landes durch Preußen, bebaut worden, das Feld dann aber wieder
ins Freie gefallen. 1849 wurde es dem Grafen von Landsberg auf
Eisenstein und Galmei aufs neue verliehen und 1867 dem Grafen
Friedrich von Landsberg Velen und Gemen zu Gemen bis zu der
zulässigen Größe erweitert. Seit 1851 hat die Grube stillgelegen.
Förderung hat nicht stattgefunden, da der Betrieb sich
ausschließlich auf Versuchsarbeiten beschränkte, die zu keinen
abbauwürdigen Aufschlüssen führte.
Quelle: "Der Holter", Ortskundliche Zeitschrift für die ehem.
Freigrafschaft Langenholthausen, Heft 2, Dezember 2010, "Die Erzlagerstätten
im Raum Balve und Neuenrade, ihr Inhalt und ihre montangeschichtliche
Bedeutung (Volker Haller), S. 23-29, Hrsg.: Der historische Verein
Langenholthausen
2. Grube Schellenberg
Bezüge zum Bergbau sind vorhanden. So weist die Lagerstätte der Grube
"Schellenberg" deutliche Unterschiede zu allen anderen im Langenhausener
Grubenfeld auf. Weiterhin ist die Grube hier die einzige von wirtschaftlicher
Bedeutung gewesen, welche sich nicht im Besitz des Grafen Landsberg befand.
Eigentümer war der Freiherr von Wrede. Die Grube bildet daher im gewissen
Sinne auch eine Interessengrenze früherer Jahrhunderte.
Lagerstätte, Erze und Gangarten: Die Lagerstätte selbst ist nicht mehr zugänglich.
Für die Untersuchungen standen die heute in einer Ackerfläche befindlichen
Überreste der ehemaligen Halden des Bergbaus und Material des Erzlagerplatzes
der Langenholthausener Eisenhütte zur Verfügung. Eine Beschreibung der Lagerstätte
durch Goebel . . .
Quelle: Die Geschichte der Wocklumer Eisenhütte 1758 - 1864, 1977, S. 74-75
1. Die usprünglichen Wocklumer Gruben auf kurkölnischem Gebiet
...Auffallend für den Wocklumer Bereich - im Gegensatz zu dem
1775 hinzukommenden märkischen Bereich um Sundwig - ist von Anfang
an die große Zahl der in Betrieb genommenen Gruben. Zeitweilig
werden bis zu fünfzehn Gruben gleichzeitig betrieben. Es ist daher
nahezu unmöglich, hier alle Wocklumer Gruben aufzuzählen. Es finden
im folgenden daher nur die Gruben Erwähnung, in denen über einige
Jahrzehnte hinweg mit gutem Erfolg gefördert wurde. Dies trifft
für folgende Gruben zu (Die aufgeführten Fe-Gehalte werden auf einer
Tabelle in der Hütte wiedergegeben):
1. Henseneiche, in der Nähe der Wocklumer Hütte am Beckumer Kirchweg.
...Entsprach der auf den Hämmern erzeugte Stabstahl in Qualität und
Ausbringung den erwarteten Ansprüchen, so betrieb man während des
Kampagnenverlaufs nur die Gruben weiter, deren Eisenstein für die
Hochofenbeschickung geeignet war. Da jedoch auch während einer
Hüttenreise noch häufig Qualitätsschwankungen des erzielten Produkts
eintraten, was bei solch empirischem Vorgehen leicht verständlich
wird, so änderte der Hüttenmeister die Melange wieder und konnte
hierbei erneut auf Eisenstein aus anderen Gruben zurückgreifen.
S. 73
Das Pulver zum Lossprengen des Gesteins wurde während der gesamten
Wocklumer Bergbautätigkeit sehr häufig von der Firma Theodor Goebel
aus Breckerfeld bezogen, einer Gemeinde, die sich durch ihre zahlreichen
Pulvermühlen auszeichnete und auch den Steinkohlebergbau der Grafschaft
Mark und später des Ruhrreviers mit Pulver versorgte (Quelle: StA Münster,
Dep. v. L. Fasc. H 55. Fol. 504. 100 Pfund Sprengpulver kosten im Jahre
1834 19 Rhtlr.). |
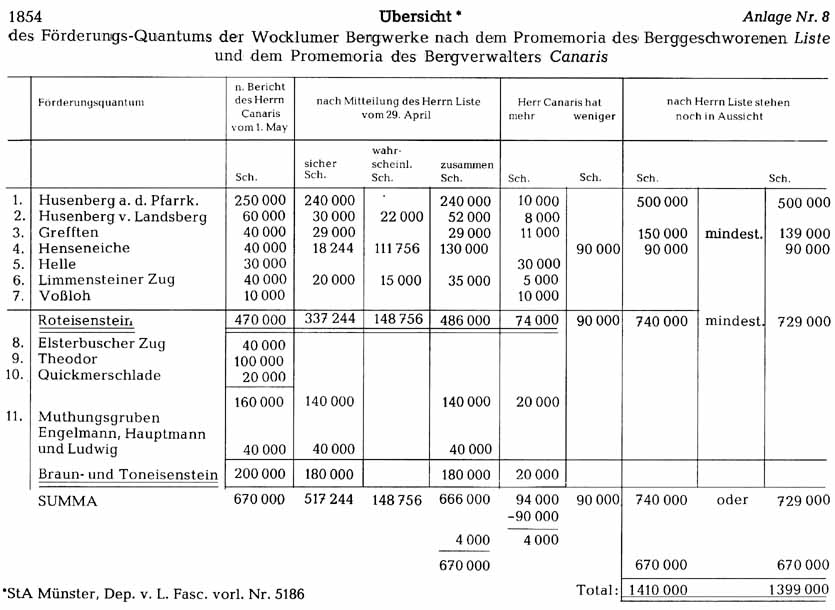
|
Quelle: DerWesten.de vom 31.07.2011 20:04 Uhr
Historischer Verein...
Langenholthausen. (uba) Die Exponate wirken für den Betrachter unspektakulär und doch erzählen die Roteisensteine, die in der alten Grube Limmerstein gefunden worden sind, eine lange Geschichte. Sie gelten nach aktuellen Forschungsergebnissen als Nachweise für älteren Erzabbau in Langenholthausen, der sich nun auf ein Alter von 2 000 Jahren datieren lässt.
Dem Historischen Verein Langenholthausen ist seit Jahren daran gelegen, den Erzabbau in Langenholthausen aufzuarbeiten und die Geschichte lebendig zu halten. Das Dorf verfügt über eine hohe Dichte von Gruben, in denen Blei- und Zinkerze sowie Eisenerze abgebaut wurden. Im April eröffnete der Verein den neugestalteten Bergbauwanderweg, der auch an der von den Mitgliedern freigelegten Bergbaugrube Limmerstein vorbeiführt. Von dort stammen die Roteisenfunde. „Die ursprüngliche Triebfeder, warum wir danach gesucht haben, war eigentlich ein gefundener römischer Bleibarren. Es gibt die Theorie, dass die germanische Siedlung in Garbeck eine Bleilagerstätte war“, berichtet Ronald Förster vom Historischen Verein.
Dies habe das Interesse geweckt, die Erzfunde vom Limmerstein zu untersuchen und eine mögliche Verbindung zur Siedlung in Garbeck herzustellen. Ein Besuch im LWL-Museum in Münster, in dem die Funde der germanischen Siedlung seit 1984 untersucht wurden, und die Unterstützung von Prof. Dr. Reinhard Schaeffer, der als Mentor für Lagerstättenforschung gilt, brachten neue Erkenntnisse.
„Wir haben alle Stätten untersucht und Proben genommen. Uns ist der Nachweis geglückt“, berichtet Volker Haller von der Naturwissenschaftlichen Vereinigung Lüdenscheid, der den Historischen Verein als Experte bei seinen Untersuchungen unterstützt. Die Langenholthausener Grube Limmerstein liege etwa 1 200 Meter von der alten germanischen Siedlung in Garbeck entfernt. „Wir können nun annehmen, dass der in Langenholthausen gefundene Roteisenstein im 1. Jahrhundert in der germanischen Siedlung verhüttet wurde“, erklärt Ronald Förster.
Roteisen finde man in Gesteinsklippen. Für die Germanen sei es dadurch einfach gewesen, Erze abzubauen und damit Eisen zu erzeugen. Dafür würden unter anderem die Reste von Brennöfen sprechen, die in der germanischen Siedlung bei archäologischen Ausgrabungen gefunden worden seien. „Die Frage, ob damit in Garbeck gehandelt wurde, können wir nicht beantworten“, so Volker Haller. Es seien allerdings Hinweise auf einen Handelsplatz gefunden worden.
„Über all dem steht jedoch, dass Langenholthausen durch die aktuellen Forschungsergebnisse zu den ältesten Bergbauplätzen im Sauerland zählt“, betonte der Heimatforscher aus Lüdenscheid. Und dass die Experten bei ihren Untersuchungen auf die Verhüttung in der germanischen Siedlung Garbeck gestoßen sind, lässt diese Schlüsse zu. Uta Baumeister
Quelle:
Westfalenpost vom 20.09.2006
Bergbau-Wanderweg
Langenholthausen. (sim)
Drei heimatverbundene Männer
haben sich die Aufgabe gestellt,
die Bergbaugeschichte
Langenholthausens zu erforschen
und ihre Erkenntnisse
der Nachwelt zugänglich zu
machen. Das größte Projekt
ihrer Arbeit ist der Bergbau-
Wanderweg rund um Langenholthausen.
Der ist mittlerweile
fertiggestellt und so können
Ronald Förster, Michael
Aßhoff und Engelbert Lazer
für Sonntag, 24. September,
zur offiziellen Einweihung des
Wanderweges einladen.
Für diese Einweihung, die
um 10.30 Uhr auf dem Barbara-
Träger-Platz beginnen soll,
haben die Mitglieder des Historischen
Vereins Langenholthausen
auch einen Vertreter
des Oberbergamts und
den Museumsleiter des Märkischen
Kreises, Stephan Sensen,
eingeladen. Ebenso die
Familien, die früher einmal
Bergbau im Gebiet von Langenholthausen
betrieben haben.
„Graf Landsberg musste
leider absagen, weil er am 24.
September im Ausland ist”,
berichtete Ronald Förster im
Vorfeld.
Auch die Stadt Balve wird
vertreten sein. Zwar hat der
Bürgermeister selbst keine
Zeit, er hat aber die Entsendung
eines Vertreters zugesagt.
An die Feier vor dem Hinweisschild
auf dem Barbara-
Träger-Platz soll sich eine
Führung über den Bergbauwanderweg
rund um Langenholthausen
anschließen. In
dieser Führung will Engelbert
Lazer die acht Gruben, den
Stollen, das Heiligenhäuschen,
das einmal von einem
Steiger gestiftet wurde, den
Platz der ehemaligen Eisenhütte
und die ehemalige Mühle
von Langenholthausen vorstellen.
Alle diese Punkte wurden
vom Verein mit Hinweisschildern
ausgestattet, so dass
der Wanderer eine genaue
Vorstellung von der früheren
Eisengewinnung in Langenholthausen
bekommen kann.
Der Bergbau-Wanderweg
in Langenholthausen weist
auch eine direkte Verbindung
zur Luisenhütte in Wocklum
auf, so dass alle, die an der
Technik-Geschichte des
Sauerlandes interessiert sind,
diese beiden Sehenswürdigkeiten
gut miteinander verbinden
können.
|