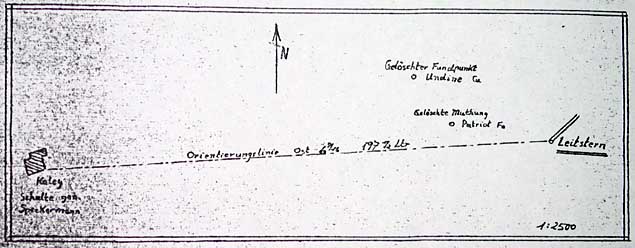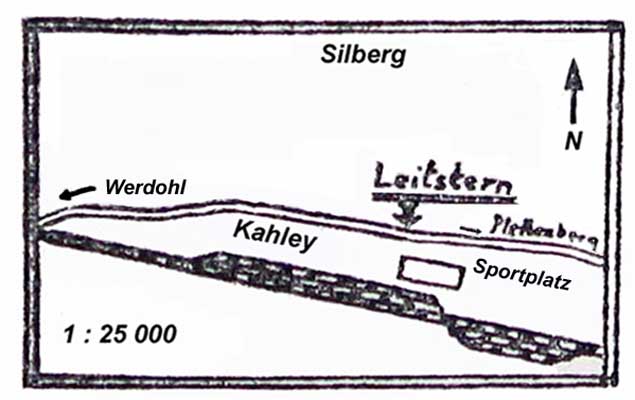|
Quelle: "Bergbau im Bereich des Amtsgerichtes Plettenberg", Fritz Bertram, 1952-1954, S. 28
9. Leitstern - Kupfererzgrube am Silberg bei Eiringhausen
Wenn wir einen alten Muthungsbericht lesen, so stoßen wir
regelmäßig auf eigenartige Ortsdefinitionen. Wir müssen
bedenken, dass vor 100 Jahren unsere heute vollkommen
ausgebildete Polygonenzüge noch recht mangelhaft waren
und somit die bergamtlichen Markscheider auf markante
Punkte im Gelände zurückgriffen.
Und so will ich die
Muthung der Grube Leitstern benutzen, um hier einmal das
Verfahren der Vermessungen zu demonstrieren: Das bekannteste
Gebäude und somit der markanteste Punkt im Gelände war das
Haus Schulte, genannt Spiekermann, im Kahley. Die Südostecke
dieses Hauses war der zu vermessenden Grube Leitstern am
weitesten zugewandt. Und so wurde zunächst die Richtung vom
Fundpunkt festgelegt, die in diesem Falle h O 6 3/4 ergab
(Art der Richtungsfestlegung vgl. Seite 5). Dazu kam dann
die Entfernungsmessung, die im Lachtermaß angegeben wurde
und hier 191 1/2 Ltr (in der Szizze dazu stehen 197 1/2 Ltr.)
ergab. Somit war der Punkt im Gelände festgelegt, wobei man
aber nicht bedachte, dass ein Haus mal abgebrochen werden
kann oder abbrennt, denn heute z. B. steht das Haus nicht
mehr, und selbst die genaueste Lachtervermessung oder
Stundenangabe kann uns nichts mehr helfen.
Zwar war in diesem Falle die Stelle der alten Fundpunkte
leicht zu finden, oft aber bedarf es Umfragen bei alten
Leuten und Einsicht alter Karten, um die alten Fundpunkte
wiederzufinden. Sowie einmal eine Betrachtung über alte
Vermessungen.
Kehren wir zu der Muthung zurück, so lesen wir, dass der
Stollen unmittelbar an der Landstraße Plettenberg-Werdohl
aufgefahren wurde und sich in östlicher Richtung (Nordost)
23 Ltr. weit ins Gebirge erstreckte. Der Stollen wurde im
Streichen der mit 30 - 35 Grad nach Norden einfallenden
Grauwackeschichten vorgetrieben, wobei man auf eine
quarzreiche Grauwackenbank stieß, die 50 Zoll mächtig war
und als die Kupfererzlagerstätte angesprochen werden konnte.
Diese Bank wurde 6 1/4 Ltr. weit verfolgt, so dass man das
Lager als 5 - 6 Fuß mächtig erkennen konnte. Das Lager bestand
aus Kupferkies, das Hangende aus erzführender Grauwacke auf
30 Zoll Höhe und 15 Zoll Breite mit derbem Kupferkies durchsetzt.
Eine Analyse ergab 34,80 Prozent Kupfer, die Verleihung
geschah am 16.01.1861. Später legte man einen zweiten
Parallelstollen ca. 5 Meter östlich vom alten Stollen an.
Dieser Stollen verfiel aber bald wieder, da er taub blieb.
Der linke, zuerst genannte Stollen, wurde im zweiten Weltkrieg
zum Luftschutzstollen ausgebaut (1943). Er ist heute noch
auf etwa 30 Meter befahrbar, das Mundloch ist auch heute noch
durch sogenannten Splitterschutz verwehrt und gibt eine Ansicht,
wie es auf obiger Aufnahme vom Februar 1952 zu sehen ist.
Quelle: Süderländische Geschichtsquellen und Forschungen, Bd. 1, 1954,
S. 85, dort Urkunde aus dem Jahre 1717: StAD, Kl Mk XIb, Nr. 22, Vol XIV, f. 64-66
Silber- und Kupferbergwerk bei Plettenberg
Anzeige des Steigers Christian Bauer, "dass er sowohl dem alten als neu
angefangenen silber- und kupferbergwerk in Charley (gemeint ist wohl "Kahley")
zu auffbauung deroselben etwas holtz benöthiget", und hierfür von Gmd. und
Vorstehern zu Eiringhausen etwas Fallholz angewiesen erhalten habe, dieses
aber von den Eingesessenen eigenmächtig weggefahren sei. Auch beim Versuch,
ander Bauholz (einen Hauptstamm) zu erhalten, werde er von der Gemeinde
Eiringhausen behindert.
- Der Bergmeister Paul Heinr. Weiß ersucht unter Wiedergabe dieses Berichtes
Vorsteher und Gemeinde zu Eiringhausen am 12. Jan., 9 Uhr morgens "bey den
Charley" zu einem Termin zwecks Klärung der Angelegenheit zu erscheinen.
Plettenberg, 2. Jan. 1717, worin die Anmaßung von Weisungsbefugnissen des
Bergmeisters an die Untertanen getadelt wird.
Quelle: Vom frühen Erzbergbau im Märkischen Sauerland, Heinrich Streich, 1979, S.89
Leitstern: Lage am Fuße des Sillberges, unmittelbar an der Landstraße
Plettenberg-Werdohl am Sportplatz Kahley. Es wurde zuerst ein Stollen
vorgetrieben, dem später ein Parallelstollen folgte. Die Mutung war unter dem
8. September 1858 eingelegt, die Analyse des Minerals ergab 34,80 % Kupfer.
Lager bis 6 Fuß mächtig. Verleihung 16. Januar 1861, stillgelegt etwa 1885.
Im letzten Krieg der westliche noch erhalten gebliebene Stollen als Luftschutzbunker
ausgebaut.
Quelle: Stadtarchiv Plettenberg, C I / 1451 Schriftverkehr wegen
Wiedereröffnung des Erzabbaus in Plettenberg; Laufzeit: 1934 - 1938, S. 132 ff.,
Abschrift DIN A 4 maschinengeschrieben, vom 16.09.1861
Nr. 20 - Die in der Gemeinde Eiringhausen
und Ohle im Kreise Altena
gelegene
Die Kupfererzzeche Leitstern liegt in den Gemeinden Eiringhausen und Ohle im Kreis Altena.
Dieselbe gründet ihre Berechtsame auf die vom 8./11. September 1858 eingelegte
Muthung, welche eine durch Stollenbetrieb erschürfte in der gelöschten Muthung Leitstern
vom 15/16 Febr. 1853 bereits besprochene, flözartige Kupfererzlagerstätte befasst. Der
Fundpunkt derselben liegt unter dem Grundstücke des Peter Dietrich Kellermann gt.
Spiekermann und zufolge markscheiderischer Ermittlung 191 2/8 Ltr. in N. Ost 6 13/16 von
der südöstlichen Hausecke des Peter Schulte gt. Spiekermann in der Kalei entfernt.
Nach der Augenscheinsverhandlung vom 28. März 1854 ist der Stollen, welcher unmittelbar
am Fusse der Dessierung der von Werdohl nach Plettenberg führenden Chaussee hart am
Lenne-Fluss angesetzt ist, in östlicher Richtung auf dem Streifen der dortigen, mit
30 - 35 Grad nach Norden einfallenden Grauwackeschichten 23 Ltr. aufgefahren, wendet sich
alsdann 3/4 Ltr. ins Liegende und hat eine quarzreiche Grauwackenband von 50 Zoll
Mächtigkeit durchbrochen, welche als die gemuthete Kupfererz-Lagerstätte bezeichnet
wurde.
Von dem Fundpunkte aus, der in 24 Ltr. Entfernung vom Stollenmundloch liegt, war die
Lagerstätte noch 6 1/4 Ltr. im Streichen längs der hangenden Lösungsfläche verfolgt und
besteht dieselbe aus zwei sehr quarzreichen Grauwackenbänken, deren Mächtigkeit von
30 - 40 Zoll wechselt, so dass die Mächtigkeit der ganzen kupfererzführenden Lagerstätte
sich auf 5 bis 6 Fuss herausstellte.
Unmittelbar vor Ort war das Hangende und 1 Ltr. zurück das Liegende durchbrochen.
Beides war von den erzführenden Schichten und bestand, durch ein deutliches Ablösen
getrennt, aus Grauwacke, welche ganz conform mit der Lagerstätte 30 Grad nach Norden
einfällt und h. 5 4/8 Ost streicht. Von dem Fundpunkt bis vor Ort fanden sich sowohl
in der Firste als in der Sohle, und ebenso in der theilweise noch anstehenden hangenden
Bank am rechten Stoße, eingesprengte derbe Kupferkiese, theils in unregelmäßig laufenden
Schnüren, theils in mehr zusammengedrängten Partien von kaum sichtbaren Pünktchen bis
zu 1 und 2 1/2 Zoll Durchmesser, welche nicht selten von Malachit in Blättchen und
im Anfluge begleitet sind.
Wie wohl die Erze von dem Fundpunkte bis vor Ort nur spärlich auftreten, so war doch
hier die untere Hälfte der Ortsscheibe, so weit diese in der hangenden, quarzreicheren
erzführenden Grauwackenschicht stand, auf 30 Zoll Höhe und 15 Zoll Breite größtentheils
mit derbem Kupferkies bedeckt. Das Muttergestein bestand vorwiegend aus Quarz von
zerfressenem und eisenschüssigem Charakter.
Die chemische Analyse der vom Fundpunkte ausgehobenen Probestufe hat einen Gehalt von
34,8 % Kupfer ergeben.
Eingetragen ex decreto vom 16. September 1861
Namen der Gewerker |