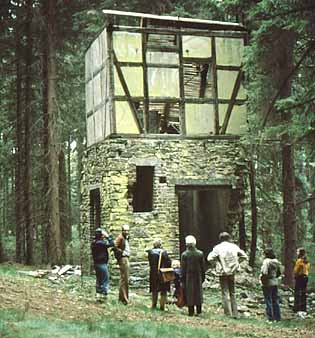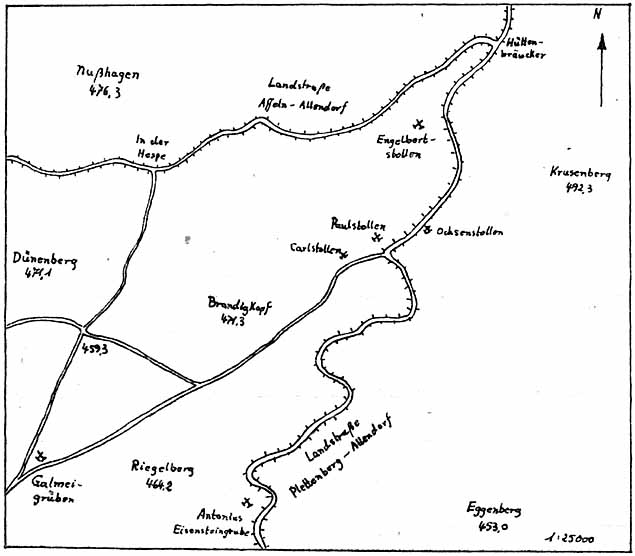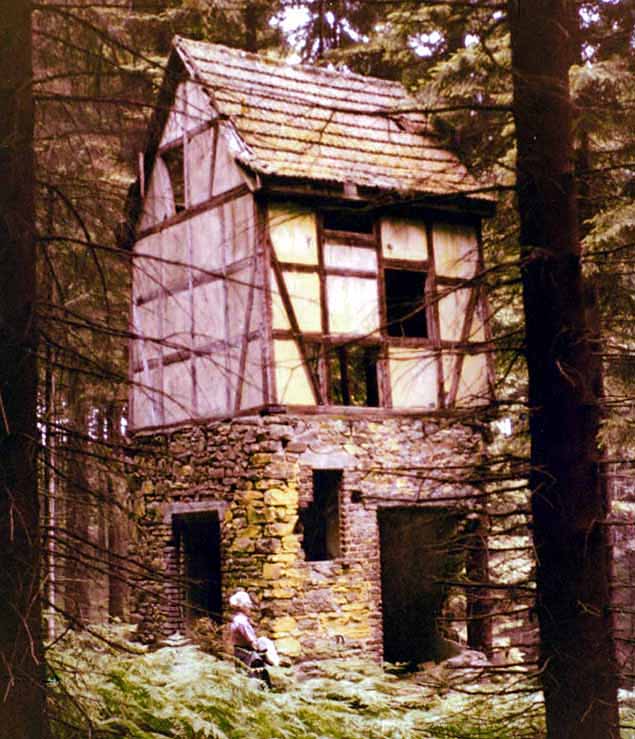|
Quelle: Hinweistafel an der Landstraße nach Allendorf (zum 600-jährigen Jubiläum des Ortes)
Der Erzbergbau an der Hermannszeche (I)
Die erste urkundliche Erwähnung des Eisenerzvorkommens an der
"Hermannszeche" geht auf das Jahr 1688 zurück. Es wird berichtet,
dass "das Eisenstein auf der Plattenbracht vor 80 Jahren nicht
ohne Zusätze hätte verarbeitet werden können". Dies lässt darauf
schließen, dass um 1600 hier bereits im Tagebau nach Eisenstein
gegraben wurde.
Die Erschließung der Lager durch Stollen erfolgte erst später. Aus
einem Befahrungsbericht vom 1. August 1827 wissen wir, dass zuerst
der im Volksmund "Ochsenstollen" genannte Vortrieb 400 Meter ins
Gebirge ging. Die Fördermenge in diesem Stollen betrug zunächst
3.600 Tonnen im ersten Jahr und erhöhte sich auf 6.655 Tonnen im
Jahr 1837.
Der zweite Stollen, der 1836 angelegt wurde, war der "Carlstollen".
Das gut erhaltene Mundloch des "Carlstollen" liegt nur wenige
Schritte von hier im Siepen. Von 1837 bis 1839 wurde hier eine
Rekordmenge von 10.549 Tonnen Erz verzeichnet. Im Stollen wurden
26 Querschläge angelegt, deren Ausbeutung erst im Anschluss an
den intensiven Vortrieb des Stollens erfolgte.
Etwa 200 Meter talabwärts wurde 1853 schließlich der "Paulstollen"
in Angriff genommen. Dieser Stollen lag tiefer als der "Carlstollen"
und war sehr ergiebig. Auf einer Stollenlänge von 1.170 Meter
wurden 17 Querschläge angelegt.
Quelle: ST vom 28.05.1980
Grubenfeld Hermannszeche gibt Rätsel auf
Plettenberg/Allendorf. (HH) Nicht nur in den Wäldern um Plettenberg
finden sich heute noch Spuren reger Bergbautätigkeit, auch in der
Nachbargemeinde Allendorf wurde mindestens seit dem 16. Jahrhundert die
Erde nach Bodenschätzen abgesucht. Zu den Überresten einer der wohl jüngsten
Grubenfelder auf Allendorfer Gebiet, der Hermannszeche, unternahmen die
Grubenfreunde vom Heimatkreis Plettenberg am vergangenen Samstag eine
Exkursion. Als wirklich sachkundigen Führer hatten die Initiatoren der
Grubenwanderung, die Familie Bald, einen Mann gewonnen, der als Bergmann
in den Jahren 1914 bis 1916 und als Maschinen- und Nachtwächter in den
Jahren 1918 bis 1925 in den Diensten der Zechengesellschaft gestanden hatte:
Josef Erner aus Allendorf.
Das Hauptfeld des Allendorfer Erzabbaus erreicht man über die Landstraße
Plettenberg - Allendorf. Einige hundert Meter unterhalb der Allendorfer Höhe
(Schlot) liegt hinter Büschen verborgen ein Bruchsteinfundament, dass ein
im Jahre 1909 errichtetes Zechenhaus getragen hat. Dieses aus Wellblechteilen
erstellte Gebäude beherbergte das "Zechenbureau", einen Mannschaftsraum und
einen Umkleideraum; vor wenigen Jahren wurde es abgerissen. Kaum fünfzig
Schritte darüber wird der leicht verschüttete Eingang des Paul-Stollen
sichtbar. Dieser Stollen wurde 1825 erschlossen und förderte zunächst bis
1847 manganhaltigen Brauneisenstein mit bis zu 50 Prozent Erzanteil; später
wurde der Betrieb erneut aufgenommen und 1925 endgültig eingestellt. Der
Stollen war rund 1.170 Meter lang und endete knapp hundert Meter vor einem
Stollen, der aus Richtung Plettenberg-Blemke vorangetrieben worden war.
Heute lassen zahlreiche Pingenlöcher im Verlauf des Stollenvortriebs vermuten,
dass der Erzgang im Laufe der Jahre an mehreren Stellen eingestützt ist.
Die Mitglieder der Exkursion ließen sich von Josef Erner an Hand alter
Zeichnungen die zahlreichen Nebenstollen erläutern. Vor Ort konnte dann die
Übereinstimmung der Karte mit der Wirklichkeit festgestellt werden. Josef
Erner führte die Gruppe auch an jene Stelle, an der das Maschinen- und Pumpenhaus
stand. Hier musste Josef Erner zwischen 1918 und 1925 die Maschinen beaufsichtigen
und sich um die Pumpenanlage bemühen. Die Bergleute stiegen über Holzleitern
hier bis in eine Tiefe von 57 Metern, um dort dann "vor Ort" zu gehen.
Eine Überraschung für alle Teilnehmer war dann die Besichtigung eines eingefallenen
Gewölbeganges. Zunächst hatte man vermutet, dass es sich um einen alten
Stolleneingang handelte. Die Bauweise (seitlich sauber aufgeschichtete Bruchsteine,
die in einem Gewölbedach endeten) ließen jedoch Zweifel aufkommen. Da das
Gewölbedach zudem nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche lag, fand sich
keine Erklärung für diese Bauweise. An einer Stelle war der Gang bis zu einer
Länge von 50 Metern auszuleuchten, konnte wegen hoher Wasserführung aber nicht
begangen werden. Der "Forscherdrang" der Grubenfreunde ist jedoch geweckt: mit
einem Schlauchboot will man wiederkommen und den Stollen erkunden.
Das Ende des Bergbaus im heimischen Raum hängt übrigens eng zusammen mit der
Entwicklung im Ruhrgebiet. Durch die niedrigen Gestehungskosten für den beim
Einschmelzen von erzhaltigem Gestein verwertbaen Koks konnten die heimischen
Köhler mit der bis dahin verfeuerten Holzkohle nicht mithalten. Der bessere
Ausbau der Straßen machte den Erztransport ins Ruhrgebiet billiger, der Bau
der Ruhr-Sieg-Strecke schaffte die Verbindung zwischen den reichen Erzvorkommen
im Siegerland und der Kohle im Ruhrgebiet, bedeutete aber das endgültige "Aus"
für den heimischen Bergbau. Vielleicht lassen steigende Rohstoffpreise den
Abbau von Erz auch im Sauerland für kommende Generationen wieder sinnvoll
erscheinen.
Quelle: Die Hermannszeche und die Nachbarfelder im Distrikt
Bracht und Wildewiese, von Fritz Bertram
Grube Hermannszeche bei Allendorf
Wir können die Betrachtung über den historischen Bergbau im Kreise
Altena nicht abschließen, ohne die Grube Hermannszeche bei Allendorf
eingehend zu behandeln (die Quellenangaben werde ich hier in diesem
Abschnitt im Gegensatz zu den vorhergehenden Kapiteln fortlaufend
beziffern und am Ende vollständig zusammenfassend angeben). Dieses
Grubenfeld liegt zwar außerhalb des Untersuchungsgebietes, es gehört
mit den bedeutenden Grubenfeldern Rothloh, Rosengarten, Wettmecke,
Hektor, Lied, Steinknapp, Alsenberg und Felix zu dem großen Eisenerzdistrikt
Bracht - Wildewiese. Auf diese eben genannten Felder werde ich zum
Schluss noch ganz kurz zu sprechen kommen. Wir können aber an der Grube
Hermannszeche nicht vorübergehen, da dieses Grubenfeld in seinen
Stollenausläufern bis in das Untersuchungsgebiet hineinragt und auch
dessen wirtschaftliche Auswirkungen fast ausschließlich nach Plettenberg
hinüberstrahlten.
War es doch so, dass das Erz mit Pferdewagen über die Allendorfer
Höhe nach der Eisenbahnstation Plettenberg gefahren wurde und von
hier den Weg zu den Hochöfen antrat. Schließlich sei noch erwähnt, dass
man um 1936 herum noch den Plan in Erwägung zog, durch die verlassenen
Stollen der Zinkerzgruben in der Blemke bei Plettenberg zur
Hermannszeche vorzustoßen, um von hier das Lager anzufahren, wodurch
ein ganz gewaltiger Transportweg erspart wurde. Und dann wollen wir
auch noch festhalten, dass in derselben Zeit die Bemühungen dahin gingen,
dass die Eisenbahn von Neheim-Hüsten, die bisher bis Sundern ging, über
Allendorf weitergebaut werden sollte. Sie wäre dann in einem großen
Tunnel unter der Hermannszeche nach Plettenberg verlaufen. Man hätte
dabei erreicht, dass das Lager von unten angeschnitten worden wäre, dass
die Nord-Süd Verbindung von der Lenne zur Ruhr hergestellt worden wäre
und schließlich der Abtransport der Erze denkbar einfach hätte vorgenommen
werden können. Aber der Plan scheiterte an der damaligen Reichsbahnverwaltung.
Diese Punkte, die teilweise später noch eingehend behandelt werden, sind
hier angeführt worden, um eine Berechtigung nachzuweisen, dass die Grube
Hermannszeche ein Teil der Arbeit über den alten Bergbau im Kreis Altena sein
muss.
"Die Grube Hermannszeche an der Plettenbracht bei Allendorf bildet seit
dem Jahre 1851 einen integrierenden Teil des Eisenerzdisktriktes Bracht;
in früheren Jahren hat daselbst ein bedeutender Betrieb stattgefunden.
Das im Lenneschiefer aufsetzende Eisenerz ist durch einen tiefen Stollen
gelöst, welcher unter den alten Bauen des westlichen Feldes 40 Meter
Seigerteufe einbringt und bei 200 Meter das Eisenerzlager erreicht.
Letzteres ist auf 700 Meter streichend verfolgt und größtenteils oberhalb
der tiefen Stollensohle abgebaut. Zur Untersuchung der weiter östlich
vorliegenden Pingenzüge sowie zur tieferen Lösung der Hermannszecher
Lagerstätten sind zwei tieferen Stollen angesetzt, von denen der eine
200 Meter, der andere 100 Meter lang ist, ohne dass bis dahin ein
Aufschluss erzielt wurde."
In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Eisenerz zur Amecker Hütte
abgefahren und unterhielt diese fast vollständig. Als die Hütte aber
eingestellt wurde, schaffte man das Erz nach Plettenberg zur
Eisenbahnstrecke Siegen-Hagen (Quelle: Beschreibung der Bergreviere
Arnsberg, Olpe und Brilon, erschienen bei Adolph Markus in Bonn 1890).
Die geologischen Erläuterungen schreiben:...
Quelle: Westfalenpost - Altenaer Kreiszeitung vom Dezember 1951 - von Fritz Bertram
In Plettenberg fast vergessen
Hermannszeche könnte auch heute noch mit ihren
1913 noch 1504 Tonnen Eisenerz
Zur Untersuchung der weiter östlich liegenden Erzadern sowie zur Lösung
der Erze der Hermannszeche wurden zwei tieferen Stollen angesetzt, von
denen der eine eine Länge von 180 Meter, der andere eine solche von
320 Metern erreichte, ohne bis dahin auf Erz gestoßen zu sein. Man verließ
dann diese Stollen und beschränkte sich wie vorher nur noch auf den
Paulstollen.
Im Jahre 1913, der besten Blütezeit der Grube, wurden 1504 Tonnen Eisenerz
mit Pferd und Wagen die über zehn Kilometer lange Strecke nach Plettenberg
zum Bahnhof gefahren. In der Zeit der Inflation ging der Grubenbetrieb
dann ein und heute ist das Feld eingefallen, verwachsen und verwildert.
Wenn man nun aber bedenkt, dass dieses Feld eine Ausdehnung im Osten bis zum
Krusenberg, im Westen bis über den Brandigkopf hinaus und im Nordwesten bis
zur Galmeigrube in der Blemke hat, so ist es nicht verwunderlich, dass man
noch 1935/36 intensive Bohrungen vornahm, um durch die Rentabilität der
Grube den Eisenbahnbau von Allendorf nach Plettenberg zu fördern.
Dieses Eisenerzgebiet verspricht auch in heutiger Zeit noch eine sehr gute
Rentabilität, zumal die Analyse von 34,4, % Eisen, 3,2 % Mangan, 21,50 %
Silizium und nur 0,084 % Phosphor ein gutes Verhüttungsprodukt liefert.
Hoffen wir, dass die Gewerkschaft Christiansglück II in Düsseldorf bald
wieder Interesse und Mut findet, dieses seit dem späten Mittelalter
berühmte Feld wieder in Betrieb zu nehmen. Fritz Bertram jr.
|