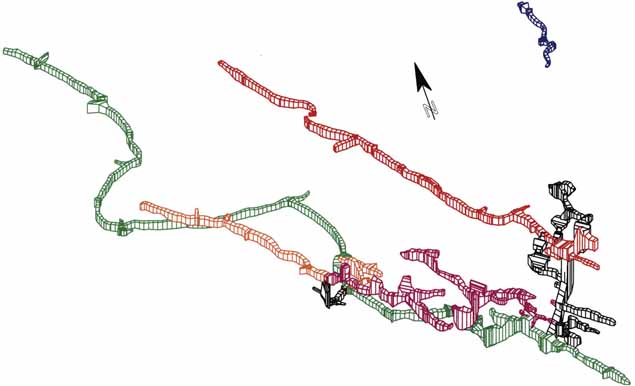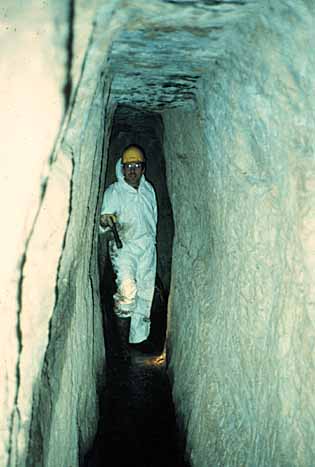"Volles Haus und krumme Gänge" (23.02.2009)
"Stollenverlauf ist krumm und schief" (20.02.2009)
Bleierzgrube Emanuel

Dieser 21 Meter hohe Schacht in der Grube Emanuel verbindet die
zweite Ebene mit der unteren, dritten Ebene.
Quelle: Das Bommecketal in Plettenberg (Sauerland), Naturkundliche
Monografie eines Naturschutzgebietes, Lüdenscheid 2003, 397 Seiten, ISSN 0558 - 7247,
ISBN 3-00-012819-0; darin:
Steffens, G.: Der Bergbau im Bommecketal in Plettenberg (Sauerland), S. 43-57
Der Bergbau im Bommecketal
in Plettenberg (Sauerland)
1. Einleitung
2. Quellen und Karten
3. Der frühneuzeitliche Bergbau am Beispiel der Grube Emanuel
... Auf drei Sohlenniveaus wird eine Blei- und Kupfererzlagerstätte
aufgeschlossen, die heute noch auf einer Länge von über 400 Meter und
einer Tiefe von 30 Meter befahren werden kann. Die Tatsache, dass die
Lagerstätte in späteren Bergbauperioden (1850 - 1885) offensichtlich
nicht mehr interessant war, versetzt uns in die Lage, ein Grubengebäude
zu untersuchen, welches nur in sehr geringem Maße von "neuerem" Bergbau
überprägt worden ist....
. . . Die ersten bergbaulichen Aktivitäten im Bereich der Grube Emanuel
befinden sich oberhalb der drei Stollenmundlöcher (s. Abb. 3 u. 4).
Auf ca. 400 m über NN an einer Stelle, wo der sogenannte Wormelsweg,
ein tiefer Hohlweg, den Erzgang kreuzt, finden sich kleine Mulden
und Trichter, die von den ersten bergbaulichen Aktivitäten herrühren.
Ein Vergleich mit Gruben, die im Erscheinungsbild ähnlich sind, aber
anhand von Fundmaterial und schriftlichen Quellen datiert werden können,
lässt hier die Vermutung zu, dass dieser ersten Arbeiten aus der Zeit
ab etwa 1450 stammen.
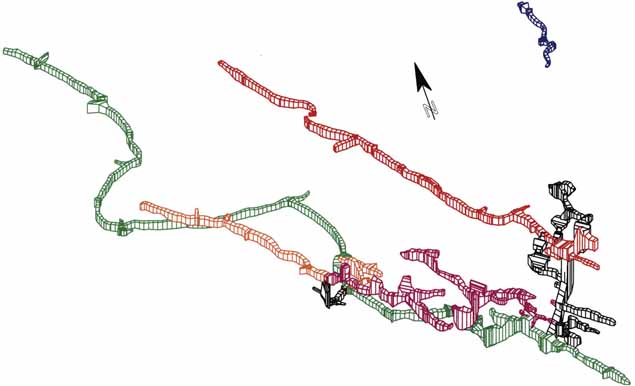
3-D-Ansicht der Bleierzgrube Emanuel, wie sie sich nach der CAD-Vermessung von
Gero Steffens (Diplomarbeit 1994, Fachhochschule Bergbau der DTM-Gesellschaft
für Lehre und Bildung) aus Richtung Süden, 45 Grad von oben, darstellt.
(Plan: Gero Steffens)
Die drei Niveaus der Grube Emanuel
Das 1. Niveau (in Abb. 3 und 5 blau dargestellt)
Man folgte dem Erzgang, der mit 80 - 85 Grad nach Südwesten einfällt,
von der Tagesoberfläche (in Abb. 3 mit Pingen- und Schurffeld bezeichnet)
in die Tiefe, wobei das zulaufende Wasser vermutlich schnell zu einem
Problem wurde. Aus diesem Grund wurde ca. 8 Meter tiefer ein Stollen
aufgefahren, der in Richtung der Pingen führt. Dieser Stollen (das "1.
Niveau") ist mit der Stollenhöhe von 110 Zentimeter sehr engräumig und
endet nach 28 Meter an einem Versturz, der von einem Tagesschacht direkt
neben dem Waldweg herrührt. Dieser nicht im Erzgang aufgefahrene Stollen
wurde von zwei Seiten aus angelegt. Diese Technik des "Gegenortbetriebs"
hat unter anderem den Vorteil, dass der Bau des Stollens nur die Hälfte
der Zeit beansprucht, da ja an zwei Stellen zur gleichen zeit gearbeitet
werden kann...
Das 2. Niveau (in Abb. 3 und 5 rot dargestellt)
...Die Auffahrung dieses Stollens erfolgte von außen her. Heute "endet"
der Stollen an einem Versturz, der von einer Verbindung zur Tagesoberfläche
herrührt. Dieses ehemalige "Lichtloch" wird sowohl der Frischluftzufuhr
als auch der Vermessung für die weitere Stollenauffahrung gedient haben.
Heute ist dieser Bereich verstürzt, und man gelangt auf den "hinteren" Teil
des 2. Sohlenniveaus nur vom 3. Sohlenniveau aus, nachdem man im Blindschacht
21 Meter nach oben gestiegen ist.
Das 3. Niveau (in Abb. 3 und 5 grün dargestellt)
Der Abbau schritt nun immer tiefer, und man musste das 3. Niveau - das
"Erbstollenniveau" - anlegen. Rund 30 Meter unter dem 2. Niveau entwässert
der Erbstollen die tiefsten Teile der Grube und versorgt sie auch heute
noch mit ausreichend Frischluft (Wettern).
Aus bewetterungstechnischen Gründen ist es nicht möglich, einen Stollen
oder Schacht beliebig weit bzw. tief ins Gebirge vorzutreiben. Der
Hauer vor Ort benötigt für sich und sein Geleucht Sauerstoff, der
verbraucht und in Kohlendioxid umgewandelt wird. Auf den ersten 50
bis 100 Meter findet ein Austausch mit Frischluft mittels Diffusionsbewetterung
statt. Das bedeutet, dass sich das schwere Kohlendioxid am Boden sammelt
und über die Stollensohle "abfließt", während der leichtere Sauerstoff
unter der Firste in geringem Maße einströmen kann.
Beim Vortrieb des Erbstollens der Grube Emanuel, der eine Länge von
über knapp 200 Meter aufweist, reichte die Diffusionsbewetterung nicht
aus. Um nun den Hauer an der Ortsbrust dennoch mit "frischen Wettern"
zu versorgen, wurde ein sogenannter Wetterscheider im Stollen eingebaut...
S. 56:
Auch in der Grube Emanuel ist allem Anschein nach noch einmal versucht
worden, den Bergbau neu zu beleben. An vielen Stellen finden sich
Bohrlöcher mit einem seit dieser Epoche gebräuchlichen, geringen
Durchmesser von ca. 2 bis 3 Zentimeter. Das bei der Schießarbeit
angefallene Material wurde meist gar nicht erst fort transportiert,
sondern bedeckt an vielen Stellen die Sohle. . .

|
|

|
Quelle: Über den Bergbau im Kreis Altena nebst angrenzenden Gebieten
von FRITZ BERTRAM (jun.), Plettenberg 1952-54, S. 118-119
Das Bleierz findet sich in unserer Heimat meistens als Bleiglanz in
Form metallisch glänzender Würfelchen oder Schnüren im Nebengestein.
Im 17. Jahrhundert wurde die Grube "Emanuel" am Folgstein betrieben
(Quelle: Emanuel und Neue Glück: Beiträge zur Geschichte Dortmunds
Bd. 17 und Bericht des Jacobs am Ende, Staatsarchiv Münster).
Heute (1952) sind noch gewaltige Halden und Löcher erkennbar. Das
Gebiet des heute als Hestenberg benannten Geländes (Folgstein, Kohlbuschberg,
am Bleiberg) wurde vollständig nach Bleierzen durchsucht, geringe Fündigkeit.

Wir wollen noch schnell auf ein Eisenerzfeld "Vergeltung" hinweisen, was
südwestlich von Grimmlinghausen lag, und wenden uns dann dem Bleierzfeld
"Emmanuel" zu. Über dieses Unternehmen können wir nur noch geringe
Unterlagen finden. Es konnte festgestellt werden, dass die Grube Anfang
des 17. Jahrhunderts in Betrieb gewesen war. Im Dreißigjährigen Krieg
wurde die Grube Emmanuel aufgegeben (Quelle: Beiträge Dtmd, Bd. 17, abgedr.
bei Frommann, Plettenberg S 83). Und doch muss hier ein ganz erheblicher
Betrieb stattgefunden haben. Unweit des trigonometrischen Punktes 487,?
auf der Folgsteinhöhe finden wir noch eine Unmenge von Bingen und teils
so erheblichen Vertiefungen, dass man beinahe auf einen direkten Tagebau
schließen könnte. In den unten stehenden Bildern sehen wir im Bild Nr. 54
eine etwa 3 Meter hohe Erdstufe, das Bild 22 versucht, alte Bingen wiederzugeben,
und im Bild 21 erkennen wir eine der gewaltigen Halden, die sich weit den
Abhang herunterziehen. Die Aufnahmen wurden im April 1952 angefertigt. Bleierz
auf diesen Halden zu finden, war eine Spielerei.
Wenn man dieses Gelände in seiner Gesamtheit betrachtet, so kommt man zu
der Annahme, dass man hier in zahlreichen kleinen Haspelschächten in die
Tiefe vorgedrungen ist, um das Erz zu fördern. Diese Schächte müssen zwar
teilweise eine erhebliche Teufe gehabt haben, sonst könnten nicht die
großen, schon kurz vorher erwähnten Bingen (Bild 22) vorhanden sein, die
heute noch, also nach sehr langer Zeit, eine Tiefe von 5 bis 7 Meter
haben, weiter nach unten zwar eingefallen und zugeschüttet sind. Doch
nicht nur im Tagebau bzw. Abbau mit Haspelschächten wurde auf diesem Feld
nach Bleierz gegraben. Im benachbarten Bommecktal finden wir einen alten
Stollen, den man gemäß Erzählungen als einen Stollen der Grube "Alter Mann"
ansehen muss. Wenn man aber nun die Lage des Stollens betrachtet, muss man
zunächst feststellen, dass das Mundloch außerhalb des Feldes "Alter Mann"
liegt. Dann aber führt auch der Stollen in einer Richtung ins Gebirge,
die nach Osten gerichtet ist und keineswegs zum Feld "Alter Mann" nach
Süden. Der Stollen konnte noch weit über 300 Meter befahren werden und
immer ging es östlich voran. Es tauchten hier Fragen auf, die aber durch
die schon früher erwähnte alte Muthungsübersichtskarte eindeutig geklärt
wurden. Der Stollen war eingetragen und als Stollen der Grube Emmanuel
bezeichnet. Eine Abbildung vom April 1952 findet man als Aufnahme Nr. 17
hier auf dieser Seite.

|
|

|
Quelle: Dr. rer. nat. Rainer Werthmann, Kassel, den 08.10.1997
Untersuchungsbericht: Erzproben aus der Grube Emanuel
1. Fundort: Die Proben wurden auf der untersten Abbausohle an zwei verschiedenen
Stellen eines Gangaufschlusses entnommen.
2. Fundumgebung: Der Gang ist ca. 10 cm stark. Die Gangfüllung ist sehr bröselig,
jedoch ohne erkennbare Drusenräume. Die Entnahme eines unzerfallenen
Gangstückes gelingt nicht. Der Ganginhalt besteht aus einer rostbraunen
Masse mit eingelagerten Nebengesteinsbrocken und grauen Kristallen bzw.
Kristallaggregaten. Rasen winziger Quarzkristalle durchziehen die Gangmasse.
3. Beschreibung der Proben: Probe 1: Kompakte rostbraune Masse
mit erdigem Bruch. Teilweise sind Andeutungen rhomboederartiger Kristalle
erkennbar. Aus diesem Befund ist bereits zu vermuten, dass es sich um
Limonit (Brauneisenstein) pseudomorph nach Siderit (Spateisenstein) bzw.
Ankerit handelt.
....
5.2 Technische Schlussfolgerung: Es ist zu erwarten, dass der
beschriebene, durch den Zerfall des Siderit zu Limonit verursachte,
bröckelige Zustand des Gangmaterials in einem großen Bereich des
vorhandenen Bergwerks anhält. Ob in höheren Stockwerken durch die weitergehende
Oxidation des Bleiglanzes eine Wiederverfestigung der Masse stattfindet,
ist fraglich, muss aber geprüft werden. Ein Abbau des limonithaltigen
Bleierzes ist mit einfachen Werkzeugen ohne Probleme durchzuführen. Öfters
wird statt Schlegel und Eisen eine Hacke oder Kratze ausgereicht haben.
Der Vortrieb bei der Gewinnung muss relativ groß gewesen sein.
An der untersuchten Stelle war das Erz bezogen auf Blei sehr hochprozentig.
Weitere Untersuchungen müssen klären, wie die Verteilung der Gehalte im
gesamten zugänglichen Grubengebäude aussieht.
Der Silbergehalt des Bleiglanzes ist, selbst bezogen auf heutige
Silberanreicherungs- und -gewinnungsverfahren sehr niedrig. Eine Extraktion
des Silbers mit Hilfe von Zink lohnt sich heute ab ca. 50 g/t. Mit dem bis
ins letzte Jahrhundert hinein einzig üblichen Treibverfahren ist das im
Bommecker Blei enthaltene Silber nicht gewinnbar. Die Triebkraft des Abbaus
auf der beprobten Ebene wird daher einzig der Gewinnung des Bleis, nicht des
- in zu geringer Menge enthaltenen - Silbers gewesen sein.
Als geeignete Ausbereitungsmethode bietet sich - neben der hier
erfolgreichen und aufgrund des Vorhandenseins billiger Arbeitskräfte
bestimmt praktizierten Handklaubung - eine Wäsche des Erzes an, da
der weiche Limonit im Wasser häufig schlammartig zerfällt.
Der Beginn der Bergbauaktivitäten im Feld Emanuel ist nicht urkundlich
belegt. Die wahrscheinlich im ganzen Grubengebäude hohen Metallgehalte,
das bereits durch Atmosphärilien teilweise oxidierte und dadurch
entfestigte Erz und das auf höheren Niveaus zu erwartende reine
Weißbleierz (Cerussit) mit seiner leichten Verhüttbarkeit legen jedoch
nahe, dass hier bereits in sehr früher Zeit Bergbau betrieben wurde.
6. Zukünftige Arbeiten: Im Rahmen der in Vorbereitung befindlichen
Monographie über das Naturschutzgebiet Bommecke ist geplant, auch die
Mineralogie und Bergbaugeschichte der Grube Emanuel mit einzubeziehen.
Ein vorläufiges Untersuchungsprogramm könnte dabei folgendermaßen
aussehen:....

Fototour "Emanuel" 1981
|
|
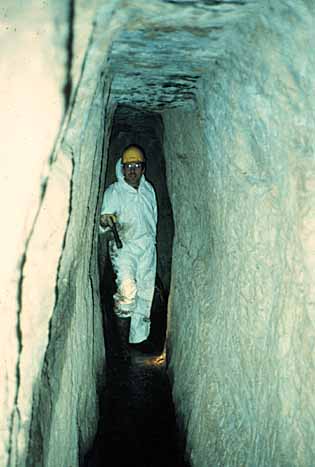
Emanuel-Erbstollen 1992
|
|