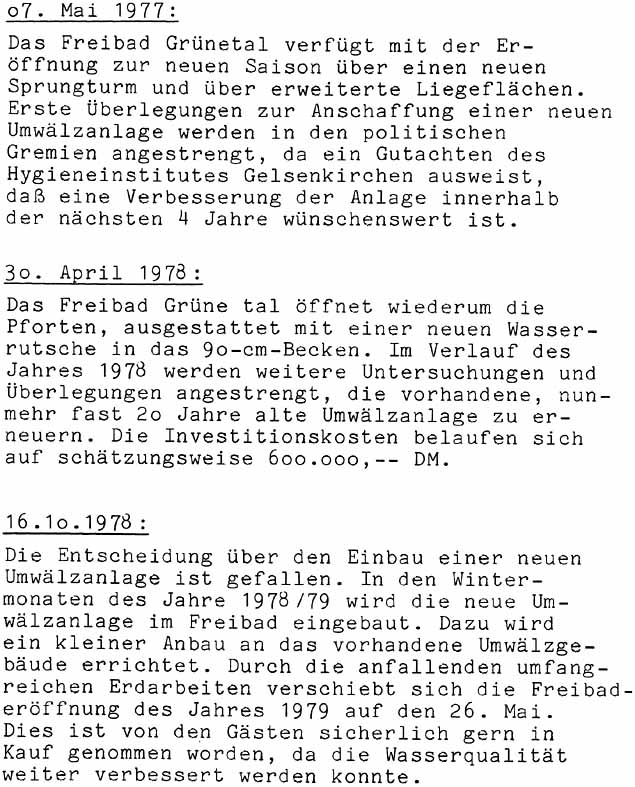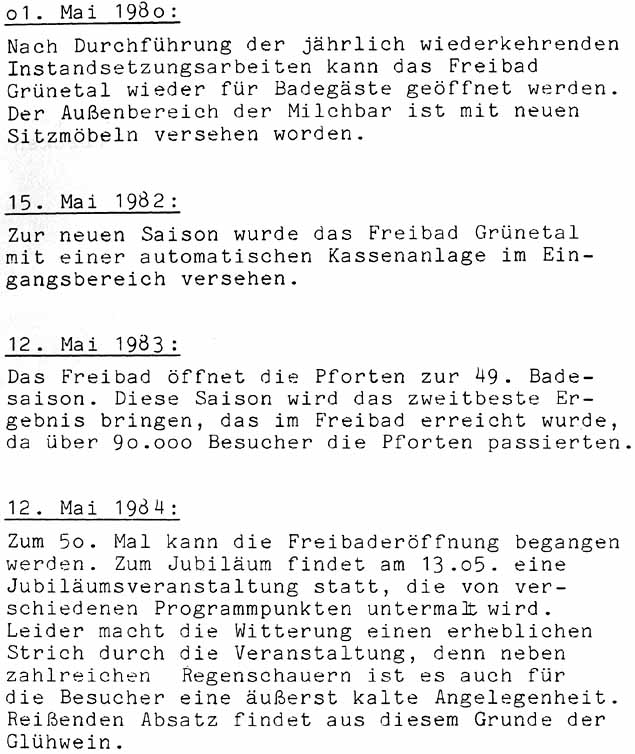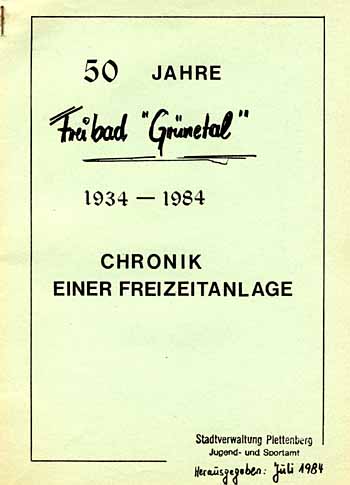 |
50 Jahre Freibad Grünetal
Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen geschichtlichen
Abriss über die Entwicklung des Freibades Grünetal in der Zeit
von 1934 bis 1984 wiedergeben. Dabei werden nur die wichtigsten
Ereignisse zusammengefasst und jeweils nach Jahren geordnet.
01. Juli 1934 |
|
20. Mai 1935
16. Mai 1936
19. Juli 1939
21. Juni 1947
13. Mai 1950
10. Juni 1950
09. Mai 1951
24. Mai 1952
09. Juli 1952
20. Mai 1953
08. Mai 1954
1957
20. Mai 1958
1959
12. Mai 1960
1961
1964
16. Mai 1967
25. April 1968
27. April 1973
19. Mai 1973
09. Mai 1974
1976
Zum Abschluss dieses kleinen Rückblickes auf die Entwicklung
unseres Freibades im Grünetal muss noch erwähnt werden, dass
die Beckenanordnung seit 1934 unverändert blieb. Lediglich
kleinere Änderungen wie der Schwimmkanal oder die Verlegung
der Startblöcke und Eingangstreppe im Schwimmerbecken wurde
vorgenommen.
Dem Süderländer Tageblatt sei an dieser Stelle herzlich für
die Mithilfe beim Erstellen dieser Broschüre gedankt. Sämtliche
Angaben sind dem Archiv des Süderländer Tageblattes entnommen.
Zwei Architekten rangen um den Bau des Freibades
Die Architekten Langenbach und Heidrichs wetteiferten darum,
das Freibad im Grünetal bauen zu dürfen. Nachfolgend zunächst
der "Erläuterungsbericht" des Architekten Langenbach vom
21. Januar 1933 (12 DIN A 4-Seiten, maschinengeschrieben):
Erläuterungsbericht über die Errichtung eines Schwimm-
Das ganze Projekt ist den hiesigen Verhältnissen angepasst und ist
folgendes vorgesehen:
1.) Zufahrt. Diese wird durch Regulierung und Befestigung (15 cm
hohe Packlage mit Kleinschlag und Sandabdeckung) instandgesetzt bzw.
für Fahrzeuge hergerichtet.
2.) Wendeplatz, Parkplatz u. Fahrräderstand. Diese Flächen
werden ebenfalls mit einer 15 cm hohen Packlage mit Kleinschlag
und Sandabdeckung befestigt.
3.) Badehaus. Dieses hat eine Grundfläche von 130 qm, ist 20 m
lang und 7,60 m tief. Folgende Räume sind vorgesehen:
4.) Abortgebäude. Dieses hat eine Größe von 4,50 x 1,20 m und
enthält 2 Wasserspülklosetts für Damen, 1 Wasserspülklosett für Herren,
außerdem ein Pissoir. Das Gebäude soll in Holz hergestellt werden. Die
Grube wird als Klärgrube ausgebildet.
5.) Becken. Ausführung nach der Bauzeichnung Blatt 4. Vorgesehen
sind:
Durch eine Anzahl von Öffnungen in Größe von etwa 0,60 - 0,15 m, die
in der Trennwand des Nichtschwimmer- und der Planschbecken vorgesehen
sind, wird ein absolut dauernder Zufluß von vorgewärmten Wasser für
das Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken erzielt.
Um die Kosten möglichst niedrig zu halten, ist in dem Schwimmerbecken
an der tiefsten Stelle eine Sprunggrube vorgesehen. Die Grube hat eine
Fläche von 9,00 x 8,00 m und ist 3,50 bis 3,60 m tief. Nach den Seiten
zu verjüngt sich die Tiefe auf 2,50 m (s. Schnitt N-O und C-D Blatt 4).
Durch diese Maßnahme werden gespart: 47 cbm Ausschachtung (in einer
Tiefe von 3,50 m) a' 3,- RM = 141,- RM, 47 cbm Fundamentbeton a' 28,00 RM
= 1.316,- RM also rd. 1.500 RM.
Damit nicht der Verdacht entsteht, dass diese Maßnahme ein Nachteil ist,
sei erwähnt, dass von Seiten der Sportbehörde das Projekt für gut befunden
ist. Auch sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass alle Längen-, Breiten-
und Tiefenmaße den Bestimmungen der Sportbehörde (Schwimmverband) entsprechen.
Unter den Startsockeln werden die sogenannten Startstangen und an den
beiden Längsseiten die Handläufe angebracht. An den beiden Längsseiten
ist außerdem eine Schmutz- oder Spuckrinne vorgesehen. Der erforderliche
Fußstand-Ruhesockel für Schwimmer wird an allen Seiten (außer der Stirnseite
des Nichtschwimmerbeckens) in einer Tiefe von 1,20 m unter Wasserspiegel
angebracht.
In vorliegendem Falle wird das zufließende Wasser nicht, wie an vielen
anderen Stellen, durch die Spuckrinne, sondern durch einen besonders
konstruierten Überlauf, der nur das kalte Wasser aus der Sohle
aufnimmt, abgeführt. Im andern Falle, was wohl einfacher ist, wird das
warme Wasser von der Oberfläche abgeführt. Dies ist von großer
Bedeutung. Die Kosten in Höhe von 300,- RM können daher nicht
eingespart werden. (s. Schnittzeichnung E-F, Blatt 4)
6.) Fußreinigungsbecken. Dieses Becken bekommt eine Größe von
2,00 x 2,00 m und hat einen dauernden Wasserstand von 0,20 m. Über
dem Becken ist eine einfache Brause vorgesehen. Das Becken kommt vor
das Badehaus zu liegen (s. Blatt 5, Seitenansicht).
7.) Um die Becken herum führt ein 80 cm breiter Plattenbelag
zum Fußreinigungsbecken und von hier zu den Zellen. Der Vorplatz vor
den Zellen soll ebenfalls mit Platten belegt werden. Durch diese Maßnahme
wird erreicht, dass jeder, der aus dem Wasser steigt, mit sauberen
Füßen unter Benutzung des Fußreinigungsbeckens die Ankleideräume
erreichen kann.
8.) Liegewiesen. Durch die Ausschachtungsarbeiten werden ca.
3.000 cbm Massen gewonnen (s. Profil 7, Blatt 3). Diese Massen
werden um die Becken herum einplaniert. Erreicht wird hierdurch
eine horizontale Fläche von rd. 75,00 x 75,00 m. An der Längsseite
des Schwimmerbeckens nach Nord-Westen verbleibt eine Tiefe von rd.
25,00 m. Innerhalb dieser Fläche (75 x 75 m) sind untergebracht:
Der übrige Teil lässt sich z. Zt. nicht in die gleiche Höhenlage
bringen. Um dies zu erreichen, müssten schon von anderer Stelle
immerhin noch 2.500 cbm Erdmassen zum Auffüllen angefahren werden,
was einen Kostenpunkt von rd. 2.500 x 3,00 = 7.500 RM verursachen
würde. Diese Kosten sind zur Zeit nicht aufzubringen. Dieser Teil,
der rd. 1,00 m tiefer liegt, ist für die Ruhe-Wiese in Größe von
80,00 x 25,00 m, also für Leute, die mehr Gewicht auf Sonnenbäder
und Ruhe legen, vorgesehen. Eine flache Böschung, in der 4 Stück
einfache Treppen von Holzstämmen eingebaut werden, trennt die
vorgenannte Ruhewiese von den übrigen Spielplätzen. Ob überhaupt
jemals eine Höherlegung der Ruhewiese in Frage kommt, ist sehr
fraglich. Sollte die Ansicht vorherrschen, diese Fläche doch im
Laufe der Zeit aufzufüllen, so muss dann bei dem Wegebau am Fuße
des Kropp's entlang, projektierte Straße "e", um hier die Massen
zu gewinnen, entsprechende Rücksicht hierauf genommen werden.
Sämtliche Wiesen und Plätze pp. um die Becken herum haben alle
eine ausreichende Größe. Die flache Böschung, die die Ruhewiese
von den übrigen abgrenzt und in einfacher Form gärtnerisch
ausgestaltet werden soll, wird ohne Zweifel das ganze beleben.
9.) Aufstellung von Bänken. Es sind eine Reihe von Bänken
vorgesehen. Um auch hier etwas einzusparen, sollen zunächst 3 Bänke
gegenüber dem Planschbecken und 3 Bänke auf dem Kleinkinderspielplatz
für die Aufsichtspersonen - dies werden meist ältere Leute sein -
der Kinder aufgestellt werden. Nur hierdurch lässt sich bei Letzteren
das Interesse wach halten. Andrerseits kann nicht verlangt werden,
dass die Aufsichtspersonen - baden werden diese sowieso nicht - sich
einige Stunden hinstellen. Die übrigen Bänke können dann von Zeit zu
Zeit aufgestellt werden.
10.) Wasserleitung. Vorgesehen ist eine gußeiserne Wasserleitung
von 50 mm Durchmesser. Von dieser zweigt dann eine verzinkte Eisenrohrleitung
von 1 " (Zoll) ab. Letztere Leitung hat die Aufgabe, die Brause,
Trinkwasserstelle und die Spülklosetts zu versorgen. Die 50 mm Leitung
kann zum Füllen der Becken mit verwandt werden (hierüber wird später
noch berichtete), hat aber hauptsächlich den Zweck, mit Hilfe der
beiden Hydranten bei Wintertag die unter lfd. Nr. 8 genannten
Flächen (außer den Wegen) unter Wasser zusetzen, damit Eislaufbahnen
hergerichtet werden können. Es würden auf diese Weise 3.600 qm Wiesenflächen,
dazu kommen noch die Flächen der Becken mit rd. 1.700 qm, also 5.300 qm
Eisflächen geschaffen werden. Bezügl. der Verwendung der Becken für
Eisbahnen sei betont, dass die Dosierung-Verjüngung der Mauerstärke
nach oben nach der Innenseite vorgesehen ist. Damit ist dem Eis jegliche
Zerstörungsquelle genommen, es hat Platz, sich nach oben zu schieben.
Auf diese Weise würde die Anstalt auch in den Wintermonaten nutzbar gemacht
werden können, wodurch sich die Einnahmen sicherlich um ein Beträchtliches
erhöhen werden, zumal es hier in der Stadt an geeigneten Eisbahnen fehlt.
11.) Einfriedung. Die ganze Anstalt soll mit einem über Kreuz
genagelten Stakettenzaun mit Anpflanzung einer Weißdornhecke umgeben
werden. Der einzige Zugang führt bei dem Kassenraum durch ein Tor.
(Zeichnung Blatt 5)
12.) Beflößung der unterhalb liegenden Wiesen von Adolf Menschel.
(Die übrigen Wiesen behalten alle ihre alte Beflößung). Die Beflößung der
Wiesen Menschel wird durch die Anlage unterbunden. Am Fuße der jetzigen
Böschung der Auffahrt zum Grundstück von Battenfeld liegt eine 40 m lange,
vor Jahren von der Stadt beim Ausbau des Landemerter Weges verlegte 40 cm
Zementrohrleitung. Durch die vorzunehmende Regulierung, Abtragen der
Böschung, wird diese Zementrohrleitung freigelegt. Dieselbe wird am Fuß
der neuen Böschung im Gefälle nach der Menschel'schen Wiese wieder verlegt.
Am Ende dieser neu verlegten Rohrleitung beginnt ein Graben, der unter dem
Grundstück von Linde herführt und auf der Menschel'schen Wiese endet. Die
Flößgräben, soweit sich diese auf der Meinhardt'schen Wiese befinden, werden
zusammengefasst und mit der Zementrohrleitung verbunden. Eine ausreichende
bzw. bessere Beflößung ist gesichert.
13.) Zuleitung. Das zum Füllen der Becken benötigte bzw. das dauernde
Frischwasser soll aus der Grüne genommen werden. Bei den Vorbesprechungen
herrschte einmütige Ansicht darüber, dass die Entnahme oberhalb der Einmündung
der Klärgrube der Siedlung stattfinden solle. Das Wasser der Grüne oberhalb
der Kläranlage ist durch die Untersuchung des Herrn Dr. Sprinkmeyer, Lüdenscheid,
für Badezwecke als geeignet befunden worden. Um auch hier die Kosten so gering
wie möglich zu gestalten, sieht das Projekt folgendes vor:
Infolge der günstigen Gefällverhältnisse der Grüne kann die Entnahme des
Wassers weit unterhalb der Kläranlage erfolgen. Das Gefälle zwischen Einmündung
der Kläranlage bis zur Badeanstalt beträgt rd. 6,00 Meter. Vorgesehen ist
nun, die Abwässer der Kläranlage durch eine abgedichtete Tonrohrleitung von
200 mm Durchmesser (s. Lageplan Blatt 1) durch die Wiese der Witwe Geck bis
in das alte Grünebachbett zu verlegen. Sollte diese Maßnahme durchgeführt
werden können, dann genügt es, wenn die Wasserentnahme bei der Grenze der
Grundstücke Janicki/Schmidt wie im Lageplan dargestellt, erfolgt.
Die Zuleitung, in der beim Einlauf ein kleiner Filterschacht eingeschaltet
ist, hat bis zum Becken eine Länge von 140 m. Die Abflußleitung der Kläranlage
hat eine Länge von 71,40 m, zusammen also 211,40 Meter. Im andern Falle, bei
Entnahme des Wassers oberhalb der Kläranlage, würde die Zuleitung 320 m lang
werden. Es sind mithin rd. 110 lfdm. Rohre eingespart, was einen Betrag von:
Die projektierte Zuflussleitung (200 mm Durchmesser aus Tonrohren mit gedichteten
Muffen) ermöglicht es, die Becken mit 1.595 cbm Inhalt innerhalb 15 - 20 Stunden
zu füllen, ohne Berücksichtigung des Wassers der Linde'schen Quelle. Im günstigsten
Falle könnten hier zum Füllen etwa 40 - 50 cbm/24 Stunden gewonnen werden. Diese
Menge ist zum Füllen nicht ausschlaggebend, weil diese innerhalb 1 - 2 Stunden aus
der Grüne geliefert wird.
14.) Soll das überfließende Wasser der Quelle Linde benutzt werden oder
nicht? Bei der am 4. November 1932 seitens des Magistrats und der Bau- und
Wegekommission stattgefundenen Besichtigung herrschte die Ansicht vor, das von dem
Linde'schen Wasserbehälter überfließende Wasser dort, wo dies zutage tritt, also
am Landemerter Weg, abzufangen und mittels einer Rohrleitung der Anstalt zuzuführen.
Die unter lfd. Nummer 10 näher erläuterte Wasserleitung ist unter vorstehenden
Gesichtspunkten projektiert und die Kosten hierfür sind ermittelt worden auf:
Das am Landemerter Weg zu Tage tretende Wasser kommt aus dem etwa 1,00/1,00/1,00
m großen Sammelbehälter von Linde. Ein Graben, der mit Steinen ausgepackt ist,
und ca. 30 cm unter der Grasnarbe liegt, dient als Überlauf. Zwar ist das Wasser
bei der von Herrn Dr. Sprinkmeyer vorgenommenen Untersuchung als gut befunden
worden, nur wusste man bei der Untersuchung nicht, dass das überfließende Wasser
durch einen Graben befördert wird. Unter diesen Gesichtspunkten ist die
Benutzung des fraglichen Wassers für Trinkzwecke verboten. Man denke nur
daran, dass Linde, wie er erklärte, jedes Jahr seine Wiese unterhalb des Sammelbehälters
mit Jauche düngt, außerdem auch einige Male das überfließende Wasser direkt unterhalb
seines Sammelbehälters zum Beflößen abkehrt. Während dieser Zeit kommt aus dem
Rohr am Landemerter Weg kein Wasser, und die bestkonstruierte Fangeinrichtung kann
uns nichts nützen.
Linde ist jedoch nicht abgeneigt, der Stadt eine Wasserentnahme auf seinem Grundstück
(wo seine Quelle liegt) zu gestatten, lehnte aber den Vorschlag, ein Rohr durch den
jetzigen Überlaufgraben bis in seinen Behälter über seinen Einlauf zu verlegen, ab.
Dies wäre sonst für die Stadt, um einwandfreies Trinkwasser zu bekommen, ab billigsten.
Linde machte folgenden Vorschlag:
Gewiß ließe sich auf diese Weise das erforderliche Wasser für die Anstalt erzielen,
aber außer Linde haben noch Selle und Bieker ein Anrecht auf die vorhandenen Quellen.
Sicherlich werden alle drei im gegebenen Augenblick noch mit besonderen Anträgen
auf Entschädigung kommen. Aber abgesehen hiervon kommen Kosten für eine derartige
Anlage in Frage, die sich für die Zuleitung, Bassin pp. schnell auf 600 - 800 RM
belaufen, ohne die Kosten für evtl. Entschädigungen.
Linde scheint an diesem Projekt ein besonderes Interesse zu haben, denn er ließ
durchblicken, dass seine Zuleitung inkrustiert sei und bald erneuert werden müsste.
Soll nun doch das Wasser auf dem Grundstück von Linde gewonnen werden, dann ist mit
der 50 mm Leitung, wie sie im Projekt vorgesehen ist, nichts anzufangen, vielmehr
müssten dann vorgenannte Arbeiten, die rd. 600 - 800 RM Kosten verursachen, noch
zu dem errechneten Betrag hinzugerechnet werden. Hiernach würden sich die
Gesamtkosten stellen
Stellt man diese Kosten der Gewinnung gegenüber, so muß jeder einsehen, dass sie
in gar keinem Verhältnis miteinander stehen. Dazu kommt, was sehr wichtig ist,
daß das Wasser, welches mittels einer Rohrleitung in die Planschbecken (Vorwärmer)
geführt werden muß, hart und sehr kalt sein wird, was sich ungünstig auf das
vorgewärmte Wasser auswirken wird.
Eine einfachere Art der Wasserversorgung ist folgende. Hierbei kann wesentlich
gespart werden. Angenommen, die Anstalt soll für den Winterbetrieb, wie unter
lfd. Nr. 10 beschrieben, hergerichtet werden, dann muss eine 50 mm Leitung mit
Hydranten vorhanden sein. Diese Leitung könnte an die städtische Wasserleitung,
direkt an das Hauptrohr des Landemerterweges angeschlossen werden. Auf diese
Weise wird die Leitung kürzer. Hiernach ermäßigen sich die Kosten
Damit nun in der wasserarmen Zeit kein Wasser vergeudet werden kann, wird diese
Leitung, die ja nur zum Herrichten der Eisbahnen, also im Winter, wo genügend
Wasservorhanden ist, dient, außer Betrieb gesetzt.
15.) Abflußleitungen. Die Entleerungsleitung der Becken besteht
aus 200 mm Tonrohren und ist 170,90 m lang. Dieselbe erthält ein Gefälle von
1 : 85,46 m, gleich einem Höhenunterschied zwischen Ein- und Auslauf von rd.
2,00 m. Die Abflußleitung führt mithin die durch die Zuflußleitung zugeführten
Mengen schneller ab, was als günstig zu bezeichnen ist. Die Einmündung dieser
Leitung erfolgt direkt unterhalb des Wehres der Wiese von Gustav Müller. Eine
Beeinträchtigung der Wasserzufuhr für die Wasserkraftanlage der Papierfabrik
Gregory kann demnach nicht eintreten.
16. Ausführung der Arbeiten. Kostenanschlag "A" sieht die Ausführung
durch den Freiwilligen Arbeitsdienst vor, Kostenanschlag "B" durch Unternehmer.
Die Pos. 3 und 4 des Kostenanschlags "A" behandeln die Einrichtung der Becken.
In vorliegendem Falle ist vorgesehen, sämtliche Fundamente und sämtliches
aufgehendes Mauerwerk der Umfassungwände in Stampfbeton (s. Detail
Schnitt A-B, Bl. 4) herzustellen. An Massen werden rund 320 cbm benötigt. Der
Beton besteht aus 1/3 Monierkies und 2/3 selbstgefertigtem Steinschlag, 3 cm
Kantenlänge, aus dem städt. Steinbruch an der Königstraße, unter Zusatz des
nötigen, hochwertigen Zements. Diese Zusammensetzung gibt bei richtiger
Mischung und gutem Stampfen unbedingt einwandfrei festen Beton.
Sämtliche Flächen vorgenannter Mauern, mögen diese ausgeführt sein in Stampf-
oder Eisenbeton, erhalten einen wasserdichten Zementverputz. Die Sohle
sämtlicher Becken werden als Eisenbetonplatte mit doppelter Armierung aus
Monierkies und Portlandzement ausgeführt. Für diese Arbeiten - herstellen der
Mauern und Sohlen - werden unbedingt zwei Betonarbeiter (Einschaler) benötigt,
wogegen das Mischen, Einbringen und Stampfen durch die F.A.D.-Leute ausgeführt
werden können. Selbstverständlich müssen diese Arbeiten besonders gut beaufsichtigt
werden. Dies ist aber auch bei Ausführung durch einen Unternehmer erforderlich.
Alles Übrige geht aus dem Kostenanschlag hervor.
Quelle: Ein Schreiben des Bauobersekretär Langenbach, Plettenberg, den
17. März 1933 - An den kommissarischen Bürgermeister Hermens
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
In dieser Angelegenheit werde ich in den nächsten Tagen eine groß ausgearbeitete
Gegenüberstellung der nackten Tatsachen der beiden Projekte (Heidrichs und
meines) nebst einem Begleitbericht dem Magistrat einreichen. Ich möchte Sie,
Herr Bürgermeister, nun höflich wie dringend bitten, dem Architekten Heidrichs
das von mir ausgearbeitete Projekt, welches gewisse Idden von mir enthält, die
ich nicht so ohne weiteres dem Herrn Heidrichs ausliefern möchte, nicht eher
vorzulegen, bis die von mir noch auszuarbeitenden Unterlagen dem Magistrat
vorgelegen haben. Ich betone heute schon, dass ich gegen eine Begutachtung
meines Projektes durch einen einwandfreien, unparteiischen Sachverständigen
nichts einzuwenden habe.
Mit Schreiben vom 20. März 1933 an "die Herren Magistratsmitglieder" zu
Plettenberg heißt es: In den Anlagen überreiche ich ergebenst Abschrift
eines unterm heutigen Tage an den Magistrat gerichteten Schreibens nebst
einer Gegenüberstellung bezgl. Errichtung eines Schwimm- und Strandbades
in Plettenberg mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme. Ergebenst Unterschrift
(Lgb.) Bauobersekretär.
Plettenberg, den 20. März 1933
M. E. kann Herr Architekt Heidrich, da er in diesem Falle mein Konkurrent ist,
doch nicht sein Gutachten so abgeben, als wenn dieses Gutachten durch einen
unparteiischen Sachverständigen erstattet wird. An und für sich begrüße ich
es, dass der Magistrat bei einer derartig wichtigen Sache Vorsicht walten lässt.
Ich würde mich freuen, wenn auch mein Projekt von einwandfreier Seite begutachtet
würde. Allerdings muss ich hierbei schon heute erwähnen, dass dieser Gutachter
sich vor Augen führen muss, dass es sich bei uns um eine Badeanstalt für eine
Stadt von etwa 7.500 Einwohnern handelt. Ich will hierbei zum Ausdruck bringen,
dass die zu errichtende Badeanstalt sich den örtlichen Verhältnissen anpassen
und trotzdem alles aufweisen muss, was man billigerweise von einer Badeanstalt
verlangen kann. Dies ist bei der Zugrundelegung meiner Ideen vollauf berücksichtigt
worden.
Wenn ich zu dem Heidrich'schen Projekt sprechen soll, dann möchte ich sagen,
ohne diesem irgendwie Abbruch tun zu wollen, dass das Projekt für unsere
Verhältnisse viel zu großzügig angelegt worden ist, bzw. sich für eine Stadt von
eta 15.000 Einwohner eignet. Weitere Einzelheiten gerade über diesen Punkt
ergeben sich aus der beiliegenden Aufstellung. Bei dieser Gelegenheit glaube
ich, mich den Ausführungen des Herrn Stadtturnrates Frankenberg in Dortmund,
der auf eine diesseitige Anfrage vor Jahren folgendes geantwortet hat, anschließen
zu können:
"Durch Ihr Schreiben vom 21.10.1929 erfahre ich, dass Sie die Anlage eines
Freibades in Plettenberg beabsichtigen. Sie wollen die Bearbeitung eines
Vorprojektes einem Spezialfachmann in die Hand geben. M. E. wird es genügen,
wenn ein Bauunternehmer in Ihrer Gegend sich eingehend über die Pläne orientiert.
Vor allen Dingen erscheint es mir notwendig, dass man auf Grund der gegebenen
Verhältnisse in Plettenberg sich über den allgemeinen Plan der Badeanstalt klar
wird (Größe der Becken, Zuleitung des Wassers, Ausführung der Hochbauten, Verbindung
mit Licht- und Sonnenbad etc.). Falls ich Ihnen einen Spezialfachmann nenne, fürchte
ich, dass Ihnen zu große Unkosten erwachsen.
Herr Stadtturnrat Frankenberg hat mich in liebenswürdiger und dankenswerter Weise
in Bezug auf die Einhaltung der sporttechnischen Einzelheiten sehr unterstützt, so
dass mein Projekt in jeder Beziehung den vorgeschriebenen Abmessungen pp. des
Deutschen Schwimmverbandes entspricht, und das ist sehr wichtig. Wäre es nicht
möglich, einmal um Kosten zu sparen, dann aber auch um ein einwandfreies, unparteiisches
Gutachten zu erhalten, sich mit Herrn Frankenberg, der in Westdeutschland als ein
Pionier auf dem Gebiete des Sportwesens gilt, sich in Verbindung zu setzen?
Wäre es im übrigen nicht angebracht, einmal mit mir persönlich alle Einzelheiten
dieser Materie, soweit noch Unklarheiten bestehen sollten, zu besprechen? Es liegt
doch in der Natur der Sache, dass der Sachbearbeiter in der Lage ist, über sämtliche
Einzelheiten bis ins Kleinste Aufschluss zu geben.
Wenn ich einen Vergleich zwischen den beiden Projekten in der Kostenfrage ziehe,
so mag folgendes festgestellt sein: Heidrich benötigt für die reinen Betonarbeiten,
Herstellung der Becken, nach seinem Kostenanschlag aus dem Jahre 1930 rd.
34.200 RM. Bringen wir nun heute eine Preisermäßigung von etwa 15 % in Abzug, so
ergeben sich noch rd. 29.000 RM. Die Betonarbeiten meines Projektes belaufen sich
bei Ausführung durch einen Unternehmer auf 20.000 RM. Ich verweise aber auch in
dieser Beziehung auf anliegende Gegenüberstellung.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ich mit voller Hingabe und einer gewissen
Leidenschaft meine Ideen, die ich im Laufe mehrerer Jahre durch Besuch vieler
derartiger Bäder gesammelt habe, in meinem Projekt vereinigt habe. Ich stehe auch
auf dem Standpunkt, dass, wenn hier etwas geschaffen werden soll, etwas Ganzes
geschaffen werden muss, damit nicht hinterher Fehler, die man hätte vermeiden
können, auch hier in Plettenberg auftreten.
Schenken Sie mir Ihr volles Vertrauen und ich bin überzeugt davon, dass in dieser
Hinsicht etwas geschaffen wird, was weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus
sich sehen lassen kann. Auswärtige, besonders diejenigen, die an Sonntagen Plettenberg
besuchen, müssen in ihre Heimat einen guten Eindruck mitnehmen, denn nur so können
wir die Besucherzahl der Badeanstalt in die Höhe treiben.
Damit sich die Herren Magistratsmitglieder in diese recht umfangreiche Materie in
Ruhe vertiefen können, habe ich es für richtig gehalten, diese Abschrift vorstehenden
Schreibens und der anliegenden Gegenüberstellung zu übermitteln.
Quelle: handschriftliche Gegenüberstellung in deutscher Schrift (zeitgemäße Blaupausen)
Betr. die Errichtung eines Schwimm- und Strandbades in Plettenberg
Projekt "Heidrichs"
Projekt "Langenbach" |