|
Angesichts heutiger Infrarot-, Mikrowellen und Lichtwellenleiter-Techniken
scheint es kaum glaublich, daß wir in Plettenberg vor 100
Jahren noch mit Petroleum-Lampen das Dunkel der Nacht zu erhellen
suchten. Am 2. März 1898 fand eine Besichtigung des Lenne-Elektrizitäts-
und Industriewerk im Baumhof in Siesel statt. Dabei wurde den
erstaunten Mitgliedern des Magistrates demonstriert, wie mit Hilfe
der Wasserkraft über Turbinen und Transformatoren elektrische
Energie erzeugt und dadurch Straßenleuchten zum Erglühen
gebracht und Elektromotoren als Antriebsmotoren genutzt werden
konnten.
An der Schwelle zum zweiten Jahrtausend kann man die technische
Entwicklungsgeschwindigkeit kaum mehr nachvollziehen: vor 100
Jahren gab es in Plettenberg weder Strom noch Telefon, kein Automobil,
kein Flugzeug, kein Radio, erst Recht kein Fernsehen - und von
der Weltraumfahrt phantasierte lediglich ein gewisser Jules Verne.
Dennoch befand man sich 1895 mitten in einer technischen Umbruchphase:
die Plettenberger Straßenbahn (Kleinbahn) hatte gerade ihre
Jungfernfahrt gemacht, die Oestertalsperrengenossenschaft war
gegründet und ein Wasserspeicher im Ebbecketal konzipiert,
die vorbereitenden Arbeiten zum Aufbau eines Telefonnetzes liefen.
Und mitten in diese Aufbruchphase hinein meldete sich aus dem
benachbarten Werdohl eine Firma "Gebr. Brüninghaus &
Co" mit der Absicht, in Siesel ein Werk "zur Lieferung
von Strom zu motorischen und Beleuchtungszwecken" zu errichten.
Keine Frage, diesem interessanten Angebot wollte sich der Plettenberger
Magistrat nicht verschließen.
Am 14. September 1895 traf beim Bürgermeister Posthausen
ein Brief aus Frankfurt ein. Absender war die Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft
vorm. W. Lohmeyer & Co, Höchsterstraße 45. Unter
Hinweis auf die "Lenne-Elektrizitäts- und Industriewerke
Werdohl" (Brüninghaus & Co) bot man ein Komplettpaket
an: die Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischer Energie.
Ähnlich wie andere später bei der privaten Versorgung
mit Erdgas, Kernenergie, Kabelfernsehen, Mobilfunk, der privaten
Müllabfuhr oder der Satelliten-Fernseh-Premiere wußten
die Frankfurter Anbieter damals gewichtige Argumente vorzubringen:
1.) Die Gemeinde Plettenberg besitzt keine eigene Gasanstalt (also
auch keine Gasbeleuchtung und kein Gasometer);
Die Plettenberger Magistratsmitglieder wurden zweifellos von diesen
Argumenten überrollt, sofern sie denn überhaupt gewillt
waren, der neuen elektrischen Energie Widerstand entgegenzusetzen.
Die Frankfurter Aktiengesellschaft hatte aber auch ein perfektes
Angebot auf Plettenberg zugeschnitten. Alle evtl. aufkeimenden Fragen
waren schon in einem Anhang zum ersten Schreiben geklärt:
1.) Die Anlage wird von der Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft
Frankfurt in Gemeinschaft mit der Firma Gebr. Brüninghaus
& Co, Werdohl, ausgeführt.
Wie gesagt, der Plettenberger Magistrat wollte sich der neuen
elektrischen Energie nicht verschließen. Gerade sieben Monate
lag das Angebot aus Frankfurt auf dem Tisch, da machte sich die
Stadt sachkundig und fragte am 10. April 1896 in gleichlautenden
Briefen beim Oberbürgermeister der Stadt Cöln und beim
Magistrat in Berlin nach "wie die dortigen Verträge
mit privaten Elektrizitätsgesellschaften aussehen?"
Man erbat sich eine Abschrift der Verträge.
Der Kölner Oberbürgermeister antwortete bereits am 14.
April 1896 kurz und knapp: "Köln hat keinen Vertrag
mit Privat, uns versorgen die städtischen Elektrizitätswerke!"
Brauchbarer fällt dagegen das Schreiben vom 19. April 1896
aus, das "der Magistrat hiesiger Königlicher Haupt-
und Residenzstadt" aus Berlin schickt. Dem Schreiben liegt
eine Abschrift des am 25. August 1888 geschlossenen Vertrages
zwischen der Stadtgemeinde Berlin und der Aktiengesellschaft Berliner
Elektrizitätswerke bei. Nach einigen wenigen Anpassungen
der Berliner Verhältnisse an die Plettenberger Strukturen
dient dieser Vertrag als Verhandlungsgrundlage für die Versorgung
der Stadt Plettenberg mit Strom.
Am 1. September 1896 legten die Lenne-Elektrizitätswerke
der Stadt ihre "Vorläufigen Bedingungen und Tarife für
die Lieferung von elektrischen Strömen" vor. Von der
"Stromerzeugerstelle am Baumhof und Siesel bei Plettenberg"
werde man Stromleitungen "bis zur Grundstücksgrenze
des jeweiligen Kunden unentgeltlich" verlegen. Die jeweiligen
Installationskosten für eine Glühlampe wurden auf 11-17
Mark, für eine Bogenlampe auf 125-160 Mark beziffert. Die
Preisberechnung erfolge nach "1000 Volt-Amperestunden"
also "ca. 1 Kilowattstunde". Eine Kilowattstunde Strom
für die Beleuchtung sollten 60 Pfennig, für die Verwendung
zur Kraftübertragung und Elektrolyse 20 Pfennig kosten.
Was aber ist eine Kilowattstunde in Licht ausgedrückt? Dazu
die Elektrizitätswerke: Eine Kilowattstunde das ist 20 Lampen
a' 16 Normalkerzen eine Stunde lang brennen lassen!" Man
darf annehmen, daß unsere Altvorderen den Umrechnungskurs
"1 Liter Petroleum entspricht wieviel 320 Normalkerzen?"
nicht auf die Reihe bekommen haben.
Wer einen Anschluß haben wollte, mußte sich jedenfalls
auf zunächst drei Jahre zur Stromabnahme verpflichten. Je
nach Abnahmemenge gab es damals bis zu 60 Prozent Rabatt!
Informationsbedarf in Sachen Strom bestand natürlich auch
beim Magistrat mit Bürgermeister Posthausen an der Spitze.
Beigeordneter Meuser, W. Seißenschmidt, Postmeister a. D.
Weiß, W. Allhoff, A. v. Banchet, Apotheker Scheele, W. Gummich
und andere wurden am 16. Oktober 1896 vom Bau-Bureau-Leiter der
Lenne-Elektrizitätswerke, Dr. R. Haas, in das Hotel Schwarzenberg
eingeladen zu einem Vortrag "Die Bedeutung der Elektrotechnik
im Haushalt".
Genau zehn Tage später lag ein Baugesuch von Dr. Haas auf
dem Tisch des Bürgermeisters. Es ging um den Bau für
ein "Gebäude zur Aufnahme der elektrischen Umsetzer-
und Schaltapparate. Das Äußere des Hauses erhält
ein dem Charakter der umliegenden Landschaft entsprechendes gefälliges
Aussehen", versprach der Antragsteller. Handschriftlich ist
auf diesem Antrag vermerkt: "Am 9.11.1896 Baugenehmigung
erteilt für ein Transformatorenhaus unter dem Hestenberg".
Eine alte Aufnahme von diesem Transformatorenhaus belegt, daß
sich die Lenne-Elektrizitätswerke tatsächlich um ein
gefälliges Aussehen ihrer Trafo-Station bemüht hatten.
Inzwischen hatten in Siesel die Arbeiten für den Bau des
Wasserkraftwerkes und die Verlegung der Strom-Fernleitung von
Siesel zur Stadtmitte begonnen. Doch schon damals waren einige
Plettenberger Bürger auf besondere Weise gegen die dafür
erforderlichen "Eingriffe in Natur und Landschaft",
wie es heute heißt. Bürgermeister Posthausen bekommt
im Februar 1897 ein Schreiben von Dr. Haas, der über Behinderungen
beim Freischneiden von Bäumen klagt. Seine Mitarbeiter seien
am Wall dabei gewesen, Astwerk zur Verlegung der Kupferleitungen
freizuschneiden. "Ein Fabrikant Kühne verbat sich in
energischer Weise jedes Berühren der Bäume" klagte
Dr. Haas: "Das verstehen wir nicht, der Damm ist doch städtisches
Eigentum?!"
Anfang September gibt es erneut Ärger mit einem Anlieger
an der Brachtstraße. Ein "Hausbesitzer Namens Tusch"
verscheucht die Arbeiter, die für das Stromkabel eine Schneise
in die Kastanienbäume auf dem Gehweg schneiden wollen. Dr.
Haas platzt bald der Kragen: "Bei den fortwährenden
Schwierigkeiten, welche uns seitens der Einwohner der Stadt entgegen
gesetzt werden, bitten wir um die geneigte Beihülfe der Polizeibehörde,
da sonst eine einheitliche Straßenbeleuchtung nicht durchführbar
ist!" schreibt er an den Polizeichef Bürgermeister Posthausen.
Den ganzen Sommer 1897 über werden Stromkabel verlegt, Trafo-Häuschen
errichtet und Straßenleuchten installiert. Am 18. Juni 1897
spricht Dr. Haas von einem voraussichtlichen Start der Stromversorgung
"Anfang September 1897".
Bürgermeister Posthausen seinerseits hatte der Ober-Post-Direktion
in Dortmund zwei Tage zuvor versichert "zur Inbetriebnahme
der elektrischen Hochspannungsanlagen wird nicht eher die Genehmigung
erteilt, bis durch Organe der Oberpost-Direktion durch Versuche
festgestellt worden ist, daß die Schutzvorrichtungen den
Reichs-Telegraphen- und Fernsprechleitungen vollständige
Sicherheit gewährt wird".
Wenig später ging man dann auf Nummer Sicher: Die Stadt verpflichtet
sich per Vertrag vom 16. Juli 1897, die Telegraphenlinie vom Postamt
bis zum Kersmeckerweg und vom Postamt bis zum Kirchlöh (Gasthof
Schwarzenberg) unterirdisch - 1 Meter tief, 75 Zentimeter von
der Straßenrinne entfernt - zu verlegen.
Die Stadt schließt dann am 1. September 1897 einen Vertrag
mit den Lenne-Elektrizitätswerken, der ihr die Errichtung
und den Betrieb von 66 Glühlampen und 2 Bogenlampen garantiert.
Bei einer Leistungsaufnahme von 10500 Kilowatt würden Stromkosten
von 6300 Mark anfallen, die vom E-Werk aber großzügig
auf 2000 Mark reduziert werden. "Also über 60 Prozent
Rabatt!" lobt sich das E-Werk, das sonst maximal 33 1/3 Prozent
Rabatt gewährt. Außerdem "stellt die Lenne-Elektrizitätsgesellschaft
mit einem Kostenaufwand von 2400 Mark die Beleuchtungseinrichtungen
her".
Nachdem nun im Straßenbild die elektrische Beleuchtung für
jedermann sichtbar wird, gibt es erste Wünsche nach zusätzlicher
"Erleuchtung". Die Böddinghauser Bürger Wilhelm
Niggemann, Peter Kaiser, Ludwig Bienstein, Gustav Theofel und
Peter Meister beantragen am 29. Januar 1898, eine elektrische
Lampe "für die Kreuzung Böddinghauser und Schwarzen
Weg". Am 20. Februar drängen Anwohner der Kirchstraße
darauf, die "am Nebenhause des Fuhrmanns Heinr. Siepmann
angebrachte Glühlampe zu entfernen und an geeigneter Stelle
in der Kirchstraße, in der Mitte des Hauses des Rendanten
Schöttler und des von Banchet'schen Hauses", anzubringen.
Jetzt sind es nur noch wenige Tage, dann wird erstmals die Straßenbeleuchtung
in Plettenberg erglühen. Der Landrat des Kreises Altena bestimmt
am 26. Februar 1898, daß "die gesamte Anlage von Direktor
Köpke von den städtischen Elektrizitätswerken Dortmund
als Sachverständiger geprüft und den Vorschriften des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker vom 23.11.1895 entsprechen
muß".
Am 2. März 1898 fließt erstmals offiziell Strom
aus dem Lennekraftwerk Siesel in die Plettenberger Straßenbeleuchtung.
Direktor Köpke aus Dortmund bescheinigt der Anlage eine hundertprozentige
Funktionsweise und einen hohen Sicherheitsstandard. Die Plettenberger
sind begeistert über das Licht, für das nie mehr Petroleum
nachgefüllt werden muß.
Der Begeisterung für das neue elektrische Licht folgen schon
bald sehr praktische Überlegungen und Wünsche: im Juni
1898 kommt der erste Antrag von den Bürgern Carl Gregory,
W. Schöttler, W. Menschel, Joh. Wisotzky und H. Knepper,
man möge im Lindengraben "noch ein Licht anbringen lassen",
da die Straße "bei schlechtem Wetter des abends nicht
passierbar" sei. Weitere Beleuchtungswünsche folgen.
Es folgt aber auch die erste Stromrechnung an die Stadt! Die wird
prompt nicht anerkannt, woraufhin die Elektrizitätswerke
mit einer Stromsperre drohen. Man sieht sich dann noch vor Gericht
wieder - doch das ist schon wieder eine neue Geschichte. Aus den
68 Straßenleuchten der Startphase sind übrigens im
Jahre 1910 bereits 124 Straßenleuchten geworden. Und heute?
3760!
Im Oktober 1936, so berichtete das Süderländer Tageblatt, wurde
mit dem Haus Radscheller Weg 2 "das letzte Plettenbeger Haus an
die Stromversorgung angeschlossen".
|
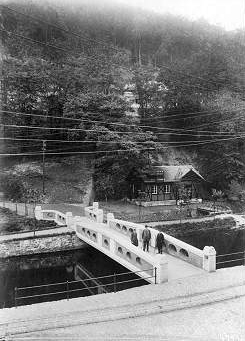 In diesen Tagen ist es nun genau 100 Jahre her, daß den
Plettenbergern "ein Licht aufging" und sie der Dunkelheit
Adieu sagten, denn am 2. März 1898 wurden die Plettenberger
Straßen zum ersten Mal elektrisch beleuchtet.
In diesen Tagen ist es nun genau 100 Jahre her, daß den
Plettenbergern "ein Licht aufging" und sie der Dunkelheit
Adieu sagten, denn am 2. März 1898 wurden die Plettenberger
Straßen zum ersten Mal elektrisch beleuchtet.