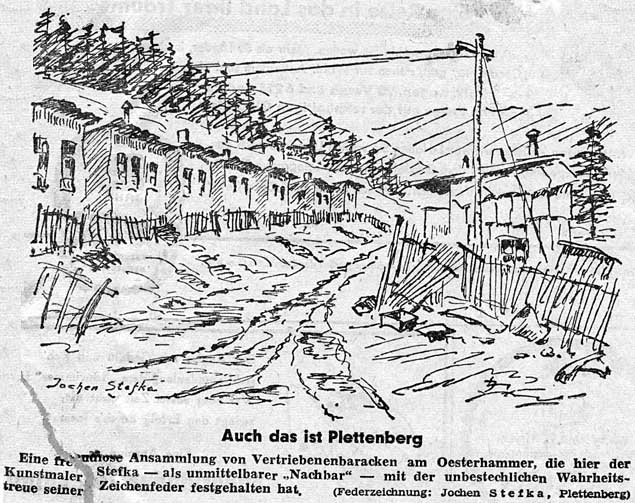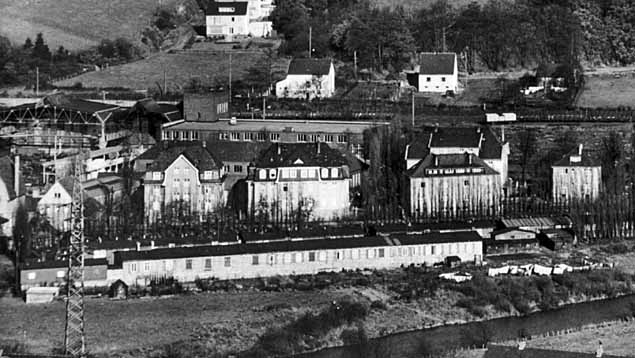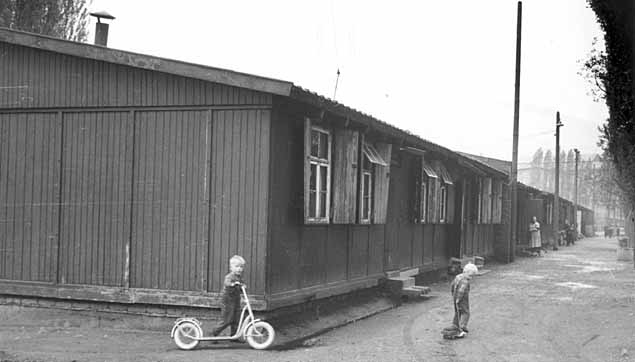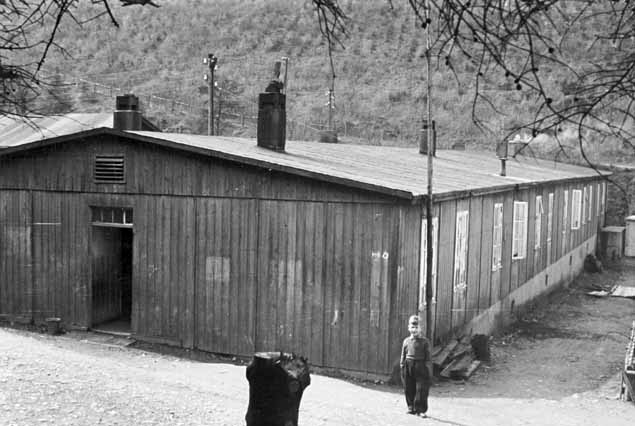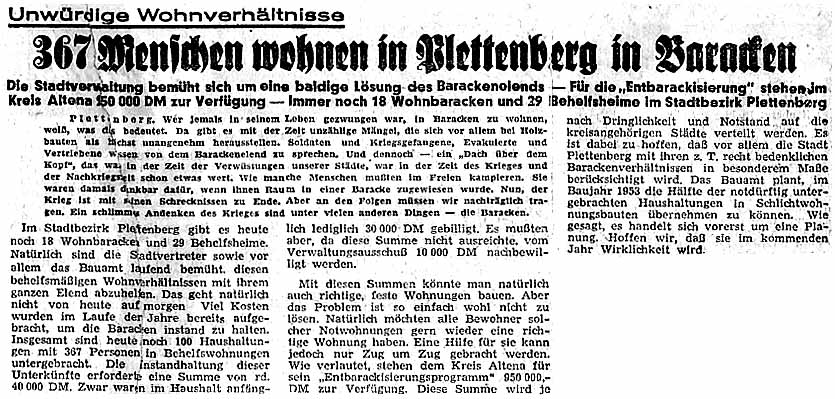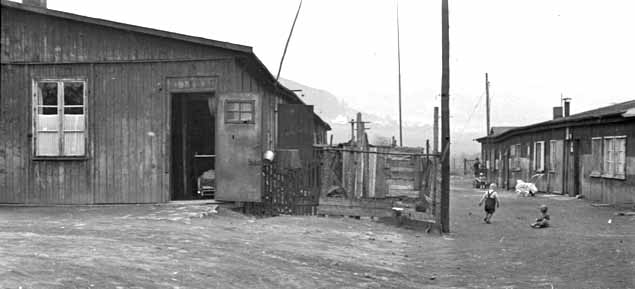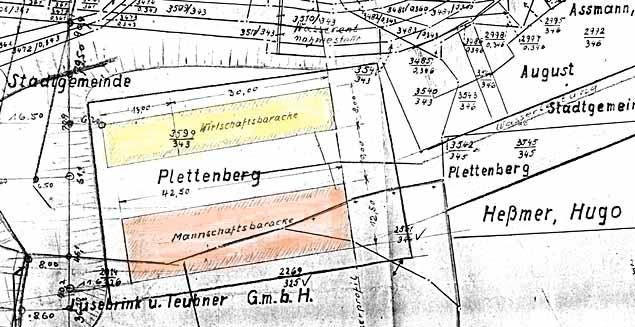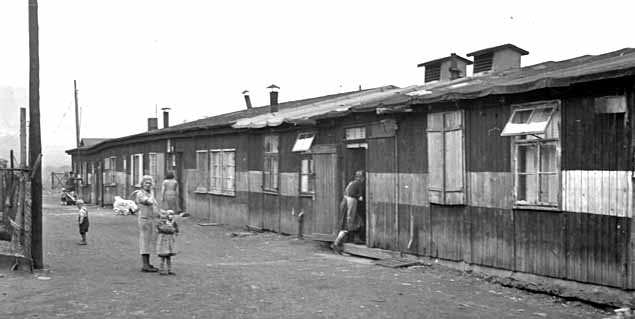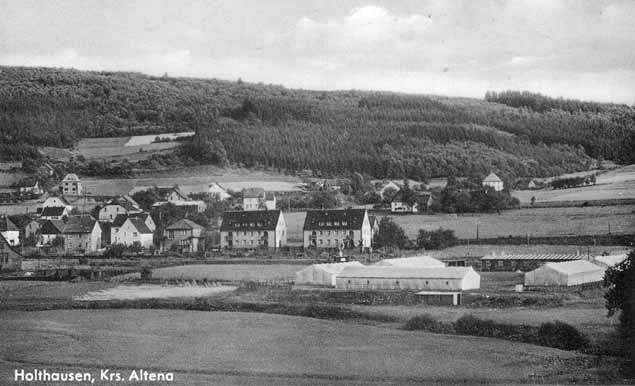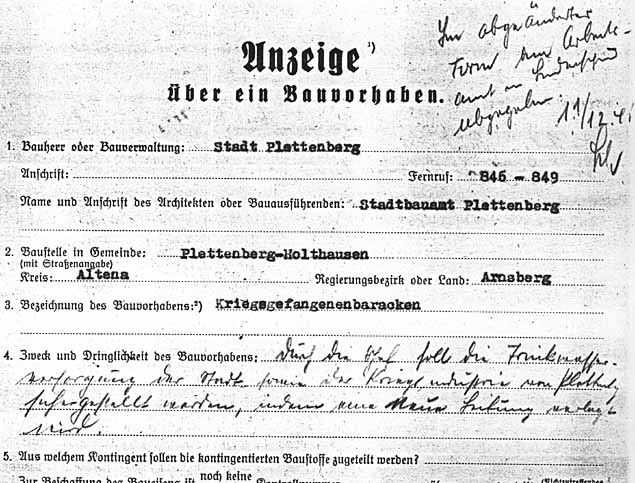|
Vor 50 Jahren: Um 1958 waren die meisten Baracken und Behelfsheime aus dem Stadtbild verschwunden
Nach dem Krieg wurden viele ehemalige Holzbaracken des Reichsarbeitsdienstes (RAD-Baracke), die zu
Kriegszeiten z. T. auch als Unterkünfte für Ostarbeiter genutzt oder eigens dafür aufgestellt worden
waren, mangels ausreichenden Wohnraums für die nach Plettenberg zugezogenen Flüchtlinge und Vertriebenen
für Wohnzwecke genutzt. Immerhin war die Einwohnerzahl durch den Zuzug von rund 5000 Ostvertriebenen,
Zonenflüchtlingen und Evakuierten von 19.800 (01.01.1945) innerhalb weniger Jahre auf 26.360 Einwohner
(September 1955) gestiegen. 1951 gab es in Plettenberg 46 Baracken in denen 205 Familien mit 806 Personen
lebten. Ende April 1956 lebten in Plettenberg noch noch mehr, nämlich 817 Menschen in Baracken und Notunterkünften. Baracken
gab es u. a. im Oestertal neben der Oesterhalle und in Wiesenthal, in der Gansmecke, an der Wiesenstraße,
Am Wall, an der Bahnhofstraße, in Eiringhausen auf dem Graeka-Gelände und im Kahley, am Eschen, auf der
Halle, in Ohle, Holthausen und anderen Orten.
In den ersten Jahren nach Kriegsende musste auch Wohnraum für die Besatzungstruppen bereitgestellt werden.
Dadurch war die Zahl zur Verfügung stehender Wohnungen weiter reduziert. Die Anstrengungen zur Beseitigung
der Wohnungsnot waren groß: Von 1949 bis 1954 wurden in Plettenberg 945 neue Wohnungen gebaut. Die Besatzungstruppen
waren inzwischen abgezogen, die ersten Baracken konnten abgebrochen werden.
Im Dezember 1955 wird eine Baracke am Halsweg abgerissen, weitere Barackenabrisse folgen, da zunehmend
neuer Wohnraum geschaffen wird. Um 1958 sind die meisten Baracken abgerissen oder werden nur
noch zu Lagerzwecken genutzt. 2001 wird eines der letzten im Stadtgebiet stehende Barackengebäude
bei der Fa. Gebr. Großheim (seit Jahrzehnten als Produktions- und Lagerraum genutzt) am Oesterweg
abgebrochen.
März 1951: Mit 10 Köpfen in einem Barackenraum
|
|
|
|
Die Baracken in der Wiesenstraße waren eigens zur Unterbringung von Zwangsarbeitern errichtet
worden. Es handelte sich um genormte Baracken, die jeweils in zwei Bahnwaggons passten. In
Plettenberg wurden in den Jahren 1942-1945 rd. 3.500 sogenannte Ostarbeiter und Kriegsgefangene
in Betrieben eingesetzt.
Sie kamen auf Vermittlung des Arbeitsamtes Lüdenscheid aus dem Kriegsgefangenen-Lager »Stalag VIa«
in Hemer oder 1941/42 direkt aus den Heimatländern per Bahn über Soest nach Plettenberg. Die sog. Ostarbeiter
stammten aus Polen und den Staaten der Sowjetunion; sie waren in Baracken, betrieblichen Unterkünften
und bei privaten Arbeitgebern (Bauernhöfen) untergebracht.
Mit dem Einmarsch der Amerikaner kamen die
Ostarbeiter in Freiheit. Eine organisierte Rückführung in die Heimatländer erfolgte nicht, wobei
insbesondere russische Ostarbeiter ihren Einsatz in Deutschland verschweigen mußten, da Stalin diese
Tätigkeit als "Colaboration" schwer bestrafte. Viele Zwangsarbeiter aus Plettenberg wurden über Olpe nach
Siegen gebracht, von wo aus die Russen einen Transport in die Heimat, oft gleich weiter in Arbeitslager
(Gulag) nach Sibierien organisierten. Die frei gewordenen Zwangsarbeiter-Baracken an der
Wiesenstraße und anderswo dienten anschließend Flüchtlingen und Vertriebenen
als Übergangswohnung.
Doch nicht alle Baracken waren dazu noch benutzbar. Mit Schreiben an den Bürgermeister vom
10.07.1945 schildert der Bauinspektor der Stadt, wie der Zustand "der dem Ostarbeiterlager
gehörenden Baracken an der Falklandstraße" (Unterm Grünen Berg, bei der Fa. Schade) tatsächlich
ist: "Die Baracken sind voll Ungeziefer (Wanzen). Nach Ansicht des Herrn Drawe und des
Unterzeichneten ist es nicht möglich, diese durch Desinfektion ganz zu entfernen. Der bauliche
Zustand ist ein überaus schlechter. . . Der Fußboden sowie kleinere Flächen der Außenwände
sind durchfault. . . Bei Errichtung der Baracken wurde die bestehende Einfriedungsmauer auf
einer Länge von 50 m abgebrochen. Die Errichtung dieser Mauer fällt dem Eigentümer bei
Abbruch der Baracke zur Last. . . Bei Ausbau der Baracken zu Wohnungen würden die aufzubringenden
Kosten niemals auch nur den geringsten Kaufpreis decken. Wenn die Ungezieferbeseitigung
nicht gelingt, haben die Baracken nur Brennholzwert."
Die Baracken an der Wiesenstraße waren nicht so voller Ungeziefer, wie die bei der Firma Schade.
"Es ist damit zu rechnen, dass diese nach Desinfektion frei werden. Die Reparaturen an Dächern,
Fenstern, Türen etc. sind auch erheblich, jedoch ist der bauliche Zustand nicht so schlecht, wie
derjenige der Baracken an der Falklandstraße." Als Vorteil der Baracken an der Wiesenstraße
wurde zudem gesehen, dass "die kleinere Baracke zu einem großen Teil unterkellert ist."
Regelmäßig wurden die "Arbeitslager für Ostarbeiter" vom Arbeitsamt, dem Gewerbeaufsichtsamt
und dem Gesundheitsamt kontrolliert. In einem Bericht vom 19.01.1943 heißt es unter anderem:
Anschrift des Lagers: Ostarbeiterlager Plettenberg-Oberstadt. Nationalität und durchschnittliche
Anzahl der Lagerinsassen: 252 männliche, 31 weibliche Ostarbeiter. Frage: Ist in den Räumen für
genügend Wärmeschutz gesorgt? Antwort: genügend Kohleöfen. Frage: Wie sind die Waschgelegenheiten?
Antwort: 23 Zapfstellen über Zinkblechrinnen, 4 ohne Rinnen, 4 Brausen. Frage: Anzahl und
Beschaffung der Aborte und Pissoiranlagen? Antwort: Abortbaracke über Trockengrube und
Pissoiranlage. Frage: Ist das Lager frei von Ungeziefer? Antwort: Verdacht. Frage: Wann
und in welchen Zeitabständen werden die Insassen entlaust? Antwort: Bisher noch nicht entlaust.
Sofortige Entlausung aufgegeben. Frage: Wer betreut ärztlich die Lagerinsassen? Antwort:
Dr. Altenkämper in Holthausen. Frage: Welchen Eindruck macht das Lager in seiner Gesamtheit?
Antwort: Zur Zeit zu eng belegt. Durchführung des Stubendienstes zwecks Sauberhaltung der
einzelnen Abteilungen. Keine Spinde vorhanden.
Die Schlussfolgerung aus dieser Besichtigung lautete: "Entlausung durchführen, Nachfüllen der
Strohsäcke, Beschaffung von Spinden, Einrichtung ausreichender Krankenstuben, Erstellung
eines Absonderungsraumes, Auflockerung der engen Belegung." Eine Besichtigung vom gleichen Tage
im Ostarbeiterlager der Fa. Ohler Eisenwerk, in dem 138 männliche Ostarbeiter untergebracht
warenb, fiel positiver aus. Die Baracke war an die Zentralheizung angeschlossen, es gab 10 Zapfstellen
und eine Brauseanlage in Betrieb, das Lager war frei von Ungeziefer, die letzte Entlausung (in
der Entlausungsanstalt der Stadt Plettenberg im Kahley) hatte am 28.11.1942 stattgefunden.
Ärztlicher Betreuer war Dr. Wilms, der Gesamteindruck: Mäßig gepflegt, zu stark belegt, Spinde
fehlen. Es wurde empfohlen, durch Aufstellen einer weiteren Baracke für Auflockerung in der
Belegung zu sorgen.
Der Chronist erinnert sich: Unser Haus stand damals an der Wiesenstraße, so dass die meisten
Spiel- und Schulkameraden aus den kinderreichen Familien in den Baracken stammten. Die Sprache
der älteren Bewohner war ungewohnt für uns - wir wussten damals noch nicht, dass es die breite
ostpreussische Mundart war, die wir neben anderen ungewohnten Stimmen hörten. Die Bewohner
müsse aus vielen verschiedenen ostdeutschen Gebieten gekommen sein, was auch an den
Familiennamen abzulesen war.
Die Not unter den Menschen war groß. So wurde alles gesammelt, was sich zu Geld machen ließ
oder sonstwie die Not lindern half. Ständig wanderten ältere Bewohner durch den Elsebach,
um nach Schrott zu suchen, der dann für Pfennige bei Stremel im Steinkamp verkauft wurde.
Zwischen den Schienen der Plettenberger Kleinbahn an der Posenschen Straße lag eine Menge
kleiner Koksstückchen von der Kesselreinigung der Dampflokomotiven. Auch diese wurden gesammelt,
um die Wohnung heizen zu können. Oft wurden auch die dicken Brikett geklaut, mit denen die
Kleinbahn ihre Loks heizte. Sogar die Pferdeäpfel, die der Gaul von Fritz Brücher auf der Straße
fallen ließ, wurden von den Bewohnern der Baracken aufgesammelt - sie dienten als Dünger für
die Mini-Gärten, die man sich an den Baracken angelegt hatte.
Unvergessen ein älteres Ehepaar, das in einem Raum in der oberen Baracke lebte. Er hatte
eine lange Mutze (Pfeife) mit Porzellankopf, aber keinen Tabak. Wir sammelten für ihn diesen Taback
nach den Fußballspielen auf der Elsewiese. Da es noch keine Filterzigaretten gab, konnten
die Zigarettenstummel, die auf den Tribünen und am Hang der Elsewiese lagen, komplett verwertet
werden. Wir sammelten sie in einer blechernen Zigarettendose und bekamen von dem alten
Mann einen Groschen. Den setzten wir dann "bei Lückel an der Bude" in silbern überzogene
Salmiakpastillen um - das Stück für einen halben Pfennig.
Freitags waren die schlimmsten Tage an der Wiesenstraße. Damals wurde der Verdienst noch
wöchentlich in Bar in Lohntüten (der sogenannte Vorschuss oder die Abrechnung) ausgezahlt.
Wenn die Frauen nicht pünktlich am Werkstor standen, um den Männern den Großteil des Inhalts
der Lohntüte wegzunehmen, war am späten Freitagabend der Vorschuss oder die Abrechnung in
Flüssiges umgesetzt. "Bitte rufen Sie die Polizei!" war dann zu später Stunde immer wieder
die Bitte an meinen Vater, da wir den nächstgelegenen Telefonanschluss hatten. Im besoffenen
Kopf gab es oft Streit, nicht zuletzt auch ausgelöst durch die Wohnsituation, die Enge und
die fehlende Perspektive. Wer zu jenen Zeiten sagte, er wohne an der Wiesenstraße, hatte
keine Chance auf unvoreingenommene Behandlung.
Quelle: Protokollbuch der Freiw. Feuerwehr Löschgruppe Ohle
Nicht berücksichtigte Quellen zum Thema "Baracken, Notunterkünfte" im Stadtarchiv
I. Stadt Plettenberg, Registraturschicht C I
II. Amt Plettenberg, Registraturschicht D I |