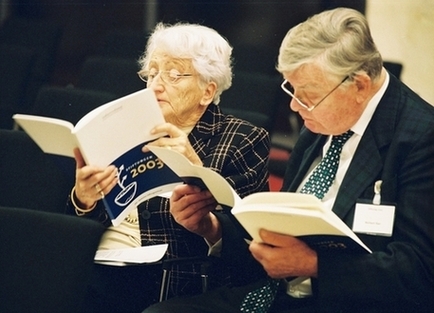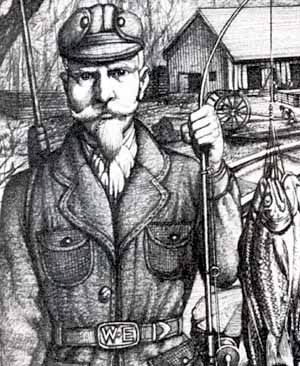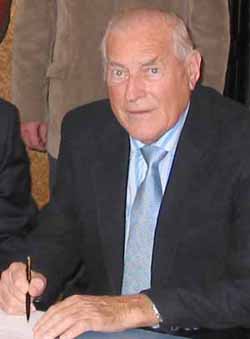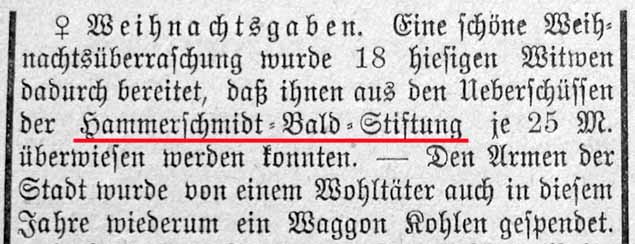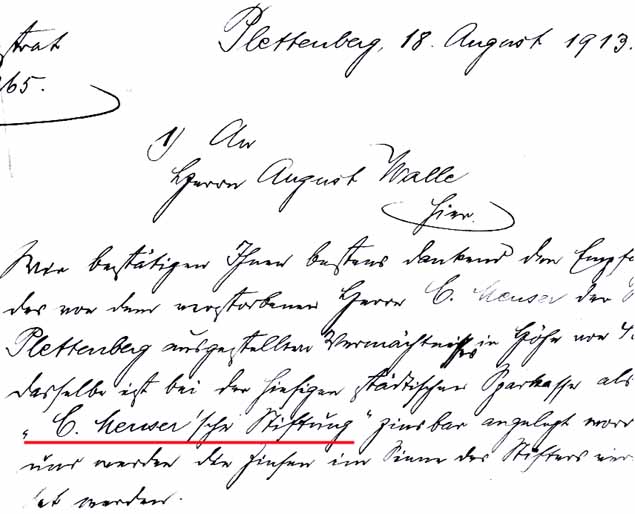|
Plettenberger Stiftungen werden gerne genutzt - aber die Stifter kennt kaum jemand Stiftungsgeld für Springbrunnen, Sportler, Krankenhaus und erwerbsunfähige Mitbürger
Von Horst Hassel
A. und N. Iber-Stiftung
Die Wilhelm Seissenschmidt'sche Stiftung
Zu den bekanntesten Stiftungen heimischer Gönner, die durch erfolgreiches Wirken zu
stattlichen Vermögen gekommen sind, gehört die "Wilhelm Seißenschmidt'sche Stiftung".
Unter diesem Namen war das Krankenhaus an der Wilhelm-Seißenschmidt-Straße (heute,
im Jahre 2010, "Matthias-Claudius-Haus") bis in die 1970er Jahre bekannt. Lange Jahre hatte man in
Plettenberg für den Bau eines Krankenhauses gesammelt (seit 1887 auch durch C. Meuser,
siehe unten), doch es kam nicht genügend Geld
zusammen, um an eine Realisierung denken zu können. Weihnachten 1893 schenkte Wilhelm
Seissenschmidt dann der Evangelischen Kirchengemeinde Plettenberg das Grundstück sowie den erforderlichen
Betrag zu Bau und Einrichtung des Krankenhauses. Am 2. Dezember 1894 wird das Haus eingeweiht.
Als zweitälteste Stiftung ist eine weitere "Seissenschmidtsche Stiftung" in
Plettenberg bekannt. Dabei handelt es sich um ein von dem Ehepaar Wilhelm Seißenschmidt
im Jahre 1899 gestiftetes, mit den bereitgestellten 30.000 Mark errichtetes Gebäude an
der Einmündung Dingeringhauser Weg/Grafweg ("Karlsplatz"). Im Jahre 1900 erfolgte die
Einweihung im Beisein des Stifters und Erbauers, der den Schlüssel für das Gebäude an
Bürgermeister Posthausen überreichte. Weil gemäß Stiftung nur sozial schwache Bürger in
dem Haus untergebracht werden durften, nannte der Volksmund das Gebäude schnell »Armenhaus«.
In der Schenkungsurkunde heißt es unter den Punkten 3 und 4 übrigens: "In dem Haus sollen
nur arbeits- und erwerbsunfähige Personen Aufnahme finden, worüber der Magistrat zu entscheiden
hat, letzterem steht auch allein die Verwaltung zu". Einer Maßgabe der Stiftung von Wilhelm
Seißenschmidt wurde später nicht mehr gefolgt: "Die anzubringende Inschrift 'W. Seißenschmidtsche
Stiftung" ist dauernd zu unterhalten". Irgendwann in den 1960er Jahren verschwand die
Stifter-Aufschrift vom Gebäude, 1981 sollte nach der Planung für die Neugestaltung des
Karlsplatzes das Haus sogar abgerissen werden, die Pläne fanden aber keine Mehrheit im Rat.
Sanitätsrat Dr. Adolf Engelhard-Stiftung
Die William Edenborn-Stiftung
Der am 20. März 1848 in Plettenberg geborene William Edenborn (†14.5.1926 in
Winfield (Louisiana)
hieß ursprünglich Wilhelm Emde. Er war das dritte Kind der Familie des Schneiders und Handelsmannes
Johann Jacob Emde aus Plettenberg. Nach der Volksschule erlernte er das Drahtzieherhandwerk und
wanderte 1866 im Alter von 18 Jahren in die USA aus. Dort nannte er sich William Edenborn. Mit
seiner Geburtsstadt Plettenberg blieb der Erfinder und Unternehmer Edenborn im engen Kontakt. Sein
Reichtum gestattete es ihm, der Plettenberger Bevölkerung mehrfach finanziell zu helfen. 1911
stiftete er den nach ihm benannten "Edenborn-Sportplatz" (damals der erste Fußballplatz für die im
gleichen Jahr gegründete Sportvereinigung Plettenberg 1911, heute Tennisplatz).
Die Vorwerck - Seissenschmidt-Stiftung
Die Hohage-Stiftung
Dr. Bürger, Richter in Hamm und Presbyter der Evangl. Kirchengemeinde Plettenberg (aus
Hülschotten) schuf 1996 erstmals eine Satzung für die "Hohage-Stiftung" in der Evang.
Kirchengemeinde. Die Stiftung steht nach genau festgelegten Regelungen den Pfarrern der
Gemeinde zur Unterstützung hilfsbedürftiger Familien zur Verfügung und soll aktuell einem
Wert im siebenstelligen Euro-Bereich entsprechen.
Die Anneliese Ohm-Stiftung
Die Mendritzki-Stiftung
Es war ein historischer Moment, als am 15.12.2006 in der Kanzlei des Notars Joachim Schade nach
112 Jahren die Evang. Kirchengemeinde ihren Anteil am Krankenhaus an die Mendritzki-Stiftung übergab.
Für die Mendritzki-Stiftung war der Stifter, Unternehmer Reinhold Mendritzki, persönlich zur Vertragsunterzeichnung
erschienen (Foto re.). In der "Mendritzki-Stiftung" werden die Aktivitäten der Initiative Krankenhaus Plettenberg
und das Engagement Reinhold Mendritzkis gebündelt. Die schon im April 2006 gegründete
„Reinhold-Mendritzki-Stiftung“ investierte 1,3 Millionen Euro für die Krankenhaus-Anteile. Die
Stiftung ist seitdem Partner der Stadt Plettenberg. "Gesellschafterinnen" sind mit einem Anteil von
50,15 % die Stadt Plettenberg und mit einem Anteil von 49,85 % die Mendritzki-Stiftung.
Die Friedrich-Wilhelm-Berges-Stiftung
Hanne-Liese Berges (*04.10.1922 †30.06.2009) vermachte 2009 in ihrem Testament eine Summe von ca.
16 Millionen Euro zur Gründung einer Stiftung, die den Namen ihres Vaters Friedrich Wilhelm
Berges-Stiftung trägt. Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung von
älteren Menschen, der Altenhilfe und der Krankenpflege. Als Empfänger sind das Matthias-Claudius-Haus
und die Altenpflegestation des Krankenhauses auserkoren. Die Stiftungserlöse dürfen aber nicht für
Investitionen oder den Unterhalt verwendet werden, sondern nur für Dinge, die den Bewohnern den
Aufenthalt angenehmer machen. Wer aber war Hanne-Liese Berges? Die Stiftung
wurde mit großem Wohlwollen begrüßt, an der Stifterin, die 1978 in der Firma Rasche Nachfolgerin
ihres Vaters als Geschäftsführerin wurde, hat offensichtlich niemand Interesse . . .
Quelle: Stadtarchiv Vermögensssachen Akte C 312, Annahme einer
Stiftung des Fabrikanten Meuser, angefangen 1910; Text: H. Hassel, 19.01.2010
Die "C. Meuser'sche Stiftung"
Von Horst Hassel
Er war erster Ehrenbürger der Stadt, langjähriger Vorsitzender des Verschönerungsvereins
(Vorläufer des SGV), Stadtverordneter, Firmenchef des zeitweilig zweitgrößten Betriebes
im Stadtgebiet, Vorsitzender und Ehrenvorsitzender der Plettenberger Schützengesellschaft,
setzte sich für den Bau eines Krankenhauses ein, unterstützte die Armen und vermachte
in seinem Testament der Stadt Plettenberg 4000 Mark für den Unterhalt der Wege und Bänke
sowie des Springbrunnens im Hestenberg. Die Stadt versprach, das Geld zinsbringend in
der "C. Meuser'schen Stiftung" anzulegen und den Zinsertrag "im Sinne des Stifters"
zu verwenden.
Carl Meuser wurde am 03.03.1832 in Plettenberg geboren. Er war der Sohn des Drechslers und
Bäckers Johann Peter Meuser (1784-1840), der aus Altenstedten bei Königsberg nach Plettenberg
gekommen war. Sohn Carl Meuser hatte ursprünglich das Sattlerhandwerk erlernt. Dann erfand
er einen Beschlag für Liegestühle, die er zunächst in einer Kleinwerkstatt am Kirchplatz
herstellte. 1857 heiratete er Caroline Gregory (sie war 1865 Königin auf dem Schützenthron)
und gründete im selben Jahr einen Industriebetrieb
für Bau- und Möbelbeschläge. Da er keine Wasserrechte besaß, musste er seinen Betrieb mit
Dampfkraft ausstatten. Mittels eines Dynamos konnte er mit Hilfe der Dampfkraft als einer
der ersten im Stadtgebiet sogar Strom erzeugen.
Fabrikant Meuser engagiert sich auch in der Stadtverordneten-Versammlung (1864-1871),
wird dann sogar Mitglied des Magistrats (was einem ehrenamtlich tätigen Beigeordneten
entspricht) und lenkt in dieser Funktion 30 Jahre lang (1871-1901) die Geschicke der
Stadt entscheidend mit. Eines seiner Hobbys ist die Anlegung von Wanderwegen im nahen
Hestenberg. Er lässt Bänke aufstellen und legt den Springbrunnen an. Zu der Zeit ist er
Vorsitzender des Verschönerungsvereins Plettenberg, dem Vorläufer des SGV.
In jener Zeit (1869-1893) ist er auch Vorsitzender der Plettenberger Schützengesellschaft,
wird 1893 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Lange vor der Gründung der Lenne Elektrizitätswerke
lässt er einmal eine Elektroleitung von seiner Fabrik an der Kaiserstraße zum Wieden legen,
damit man dort das Schützenfest erstmalig bei elektrischer Beleuchtung feiern kann. Seit 1887 sammelte Meuser Spenden
für den Bau eines Krankenhauses. Auch zeigte er sich gegenüber seinen Arbeitern und den
Armen der Stadt sehr großzügig, indem er ihnen immer wieder Geldbeträge und Heizmaterial
(Kohlen) zukommen lässt. 1895 ist er auch Mitbegründer der Plettenberger Straßenbahn AG.
Die Stadtväter wissen den unermüdlichen Einsatz von Carl Meuser zu würdigen: anläßlich
seiner Goldenen Hochzeit am 19.03.1907 ernennt man ihn zum ersten Ehrenbürger der Stadt.
In dieser Zeit, genau am 30. November 1907, setzt Carl Meuser gemeinschaftlich mit seiner
Frau Caroline sein Testament auf. Als Carl Meuser am 25.07.1910 stirbt, erfährt die Stadt
Plettenberg, dass sie in seinem Testament bedacht wurde. Mit Schreiben vom 9. August 1910
informiert das Königliche Amtsgericht wie folgt:
Auf der Rückseite dieses Schreibens ist der Magistratsbeschluss vom 4. Oktober 1910
festgehalten. Er bringt Licht in das Verfahren und macht deutlich, warum die Stadt
über den Testamentsinhalt informiert wurde:
Der verstorbene Fabrikant Carl Meuser hat in dem mit seiner Gemahlin unterm
30. November 1907 errichteten Testament dem Erben, Prokurist August Walle hier,
aufgegeben, der Stadtgemeinde Plettenberg ein Kapital von 4000 M. zur Instandhaltung
der Wege und des Springbrunnens im Hestenberg zu zahlen. In der Annahme, dass Herr
August Walle das Erbe antritt, wird das Geschenk des Herrn Meuser gerne und dankend
angenommen.
Am 10. Oktober 1910 fragt Bürgermeister Köhler im Namen der Stadt Plettenberg beim
Königlichen Amtsgericht nach, "ob Prokurist August Walle das Erbe angetreten hat?".
Die Antwort des Königlichen Amtsgerichtes (gez. Tillmann) lautet: "Wir stellen fest,
dass Herr August Walle nicht als Erbe, sondern als Vermächtnisnehmer durch eigenhändiges
Testament des C. Meuser eingesetzt ist. Erbe ist die Witwe Meuser."
Hat das Königliche Amtsgericht recht? Ein Blick in den Wortlaut des Testamentes hilft
weiter. In den insgesamt 8 Paragraphen, die für alle Eventualitäten vorsorgen, wird
zunächst unter der Überschrift "Testament der Eheleute Carl Meuser und Caroline geb.
Gregory" festgestellt, dass die beiden
"hiermit folgendes gemeinschaftliches Testament" errichten:
Und nun kommt der Moment, in dem die Stadt Plettenberg bedacht wird: Die Zahlungsverpflichtung,
die Herrn August Walle hiermit auferlegt wird, sind eine Auszahlung von 15.000 Mark
innerhalb 3 Jahren an das Evangelische Krankenhaus zu Plettenberg. Ferner 4000 Mark
der Stadt Plettenberg zur Erhaltung der Wege, Bänke im Hestenberger sowie Springbrunnen.
Am 31. Januar 1911 heißt es in der Sitzung des Magistrats: "Dem Vernehmen nach hat
Herr Walle jetzt das Vermächtnis angetreten." Daraufhin schreibt Bürgermeister Köhler
noch am gleichen Tag an den Kaufmann Walle wegen der "der Stadt Plettenberg zugedachten
Schenkung" und will wissen, "ob Sie das Vermächtnis auf Grund des Testamentes vom
30.11.1907 übernommen haben?" Die Antwort fällt wohl positiv aus, denn am 7. Februar
1911 lautet der entsprechende Ratsbeschluss: "Nachdem Ratsherr (!) August Walle
mitgeteilt hat, dass er das Vermächtnis des Herrn Karl Meuser aus dem Testament
übernommen hat, wird die Schenkung gerne angenommen." Das wird mit Schreiben vom 17. Februar
1911 durch die Herren Köhler, von Banchet, Walle und Reinländer mitgeteilt. Auch die
Stadtverordnetenversammlung fast am 1. März 1911 den Beschluss, die Schenkung "mit
dem Ausdruck herzlichen Dankes" entgegenzunehmen. Unterschrift: Ernst Koch, Geck,
C. Myläus jr., H. Solms. - Hermens, Schriftführer.
Inzwischen hat Bürgermeister Köhler sich bemüht, die "landesherrliche Genehmigung
zur Annahme der Schenkung" zu bekommen. Die Antwort: Eine solche Genehmigung ist
nicht erforderlich, weil die Schenkung den Betrag von 5000 Mark nicht übersteigt.
Nun scheinen alle formalen Hindernisse aus dem Weg geräumt. Doch in den nächsten
Monaten passiert nichts. Erst am 25. Juli 1913 bekommt die Stadt Plettenberg ein
Schreiben von der Firma C. Meuser, Inhaber August Walle, unterschrieben "in Vertretung
Paul Walle", in dem man versichert, dass der Betrag von 4000 M "bis Anfang August
ausgezahlt wird, da zu diesem Zeitpunkt die Beträge zur Verfügung stehen."
Magistrat und Verwaltung sind ungeduldig. Schon am 2. August fragen sie bei der
Verwaltung nach, "ob Walle gezahlt hat". Hat er noch nicht. Laut Schreiben vom
15. August 1913 muss das Geld dann direkt ins Rathaus gebracht worden sein, denn
in dem Brief mit C-Meuser-Briefkopf heißt es: "Überreiche Ihnen hiermit das
Vermächtnis für die Stadt Plettenberg in Höhe von 4000 Mark."
Und nun wird aus der Schenkung ganz plötzlich eine Stiftung, denn der Beigeordnete
von Banchet verpflichtet die Stadt Plettenberg wie folgt:
Was aus der Stiftung und dem Stiftungskapital geworden ist? Fragen Sie mal nach -
bei der Stadtverwaltung oder bei der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis . . . |