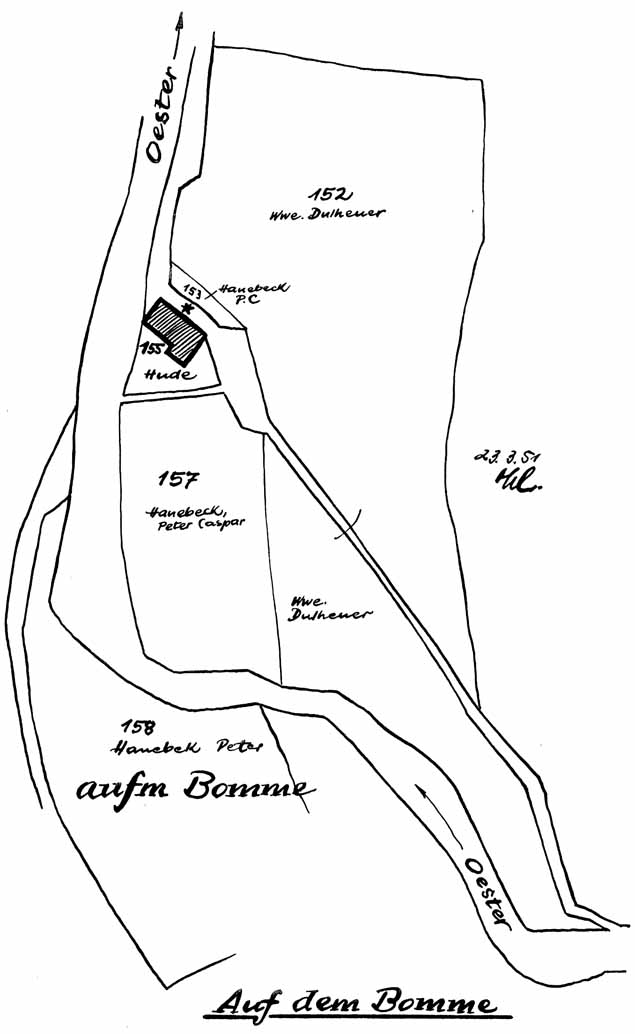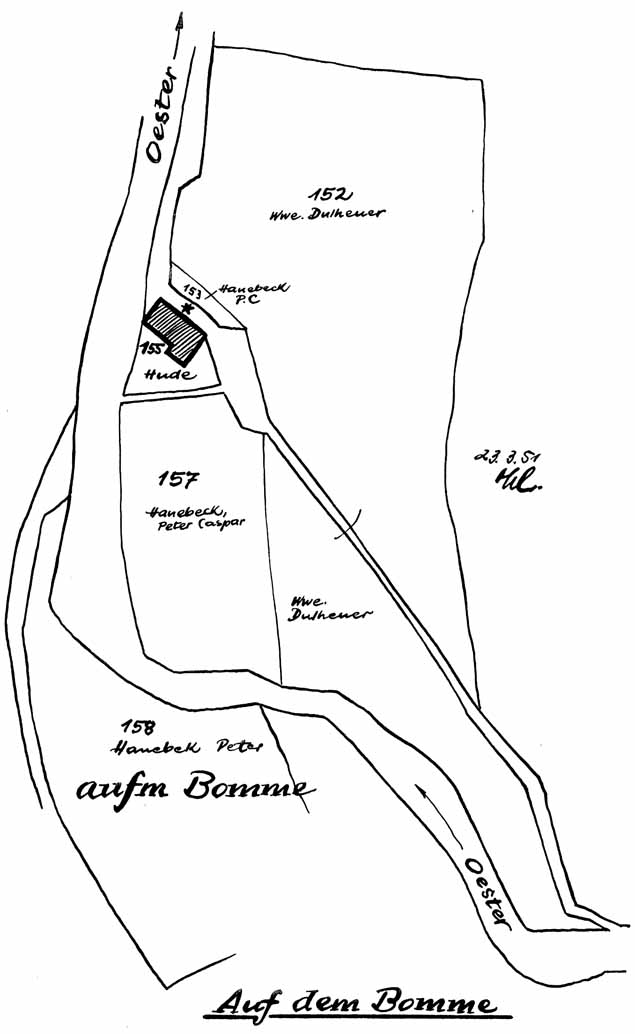
Quelle: Wochenblatt für den Kreis und die Stadt Altena, Nr. 8, 21.02.1835
21 Webstühle in Wolle und 28 Gasthöfe . . .
Statistik von Stadt und Amt Plettenberg pro 1834:
Stadt 1535 Seelen, Amt 2177 Seelen, Summa 3712 Seelen. Darunter 3526 Evangelische,
158 Katholiken und 28 Juden.
Geboren 140, getraut 41, gestorben 110.
521 Wohnhäuser mit 288 Nebengebäuden
51 Fabrikgebäude etc.
6 Schulen mit 6 Lehrern und 724 schulbesuchenden Kindern.
Viehstand: Füllen und Pferde 126 Stück, Rindvieh 1473 Stück.
Gewerbe: 1 treibt Handlung, 2 Laden, 26 Krämer etc., 3 Sattler
mit 1 Gehülfen, 22 Schneider mit 1 Gehülfen, 3 Putzmacherinnen,
27 Zimmerleute mit 7 Gehülfen, 6 Tischler mit 2 Gehülfen, 2
Stellmacher, 2 Böttcher, 12 Drechsler, 3 Korbmacher, 8 Maurer
mit 1 Gehilfen, 34 Schuhmacher mit 4 Gehülfen, 10 Bäcker mit
1 Gehülfen, 4 Fleischer, 5 Gerber mit 5 Gehülfen, 1 Töpfer mit
2 Gehülfen, 3 Glaser, 1 Anstreicher, 13 Schmiede mit 3 Gehülfen,
14 Schlosser mit 2 Gehülfen, 1 Kupferschmied mit 1 Gehülfen,
2 Uhrmacher, 2 Ziegelbrenner, 66 Nadler mit 190 Gehülfen,
7 Mühlen mit 16 Gängen, 3 Oelmühlen, 4 Walkmühlen, 3 Lohmühlen,
2 Sägemühlen, 8 Papiermühlen, 42 Eisenhämmer, 21 Webstühle in
Wolle, 5 Webstühle in Leinen, 5 Strumpfwirker, 2 Tuchbereiter
mit 2 Gehülfen, 28 Gasthöfe und Schenken, 37 Knechte und 76
Mägde.
Weiter wird bemerkt, dass sich hier seit einem Jahr ein
Instrumentenmacher niedergelassen hat, der sich in Wien und
Paris ausbildete. Seine bisherigen Arbeiten, ein Flügel mit
Hammerschlag von oben, mehrere gewöhnliche Forte-Piano und
ein dreichöriges mit französischer Mechanik, beweisen es, dass
Herr C. H. Schulte für billiges Geld sehr schöne und dauerhafte
Instrumente liefert, von vorzüglichem Tone. Er verdient mit
vollem Recht empfohlen zu werden.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1835 - Einführung der Revidierten
Städteordnung im Dezember des Jahres in Plettenberg durch eine
Verordnung des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Freiherr
von Vincke, nachdem sich vorher der Magistrat gegen und der Gemeinderat
für die Einführung ausgesprochen hatte, und es zu keiner Einigung
gekommen war. Die Einführung der Revidierten Städteordnung bedeutete
die erneute verwaltungsmäßige Trennung von Stadt und Amt sowie die
Einführung des städtischen Selbstverwaltungsprinzips. - J. Aubel
ist Bürgermeister von Plettenberg.
JUNI 1836
18. Juni 1836 Nachweisung der Brotpreise bei der Bäckerei zu Plettenberg, unter
Angabe der Güte des Brotes und der Reinlichkeit in den Bäckereien. (Die Preise werden
hier weggelassen.)
| Nr. | Name des Bäckers | Qualität | Reinlichkeit |
|---|
| 01 | Moritz Bettermann | ist gut | sehr gut |
| 02 | Karl Fischer | sehr gut | könnte besser sein |
| 03 | Friedrich König | gut | untadelhaft |
| 04 | Menschel (Jude ohne Vorname) | recht gut | mangelhaft |
| 05 | Wilhelm Schöttler | vorzüglich | musterhaft |
| 06 | Adam Schulte | mittelmäßig | gut |
| 07 | Peter Wilh. Tusch | mittelmäßig | gut |
| 08 | Friedrich Voß | gut | gut |
| 09 | Witwe Worth | mittelmäßig | gut |
| 10 | Heinr. Ostermann, Eiringhausen | gut | gut |
gez. Bürgermeister Abel
Quelle: Bd. 5 der Stadtgeschichte, Chronik der Stadt Plettenberg, S. 288
1839
Umbau des ehemaligen Rathauses für den katholischen Gottesdienst, da die
Bemühungen der Plettenberger Katholiken, die Böhler Kapelle mitzubenutzen,
fehlschlugen. Die neue Kirche wird am 11. August 1839 dem Hl. Laurentius
geweigt. - 4.456 Menschen leben auf dem Gebiet der heutigen Stadt Plettenberg.
Davon wohnen 1.539 Menschen in der damaligen Stadt Plettenberg, 2.369 im
Amt Plettenberg und 494 in der Gemeinde Ohle.
Quelle: Aufzeichnungen des Joh. Diedr. Ossenberg aus den Jahren 1840-1850,
in "Amtliche Bekanntmachungen" vom
06.03.1948, 10.03.1948, 13.03.1948 und 20.03.1948
1840
Wegen der trockenen Witterung in diesem Frühling ist an vielen Orten Feuer
in den Bergen entstanden, wo große Bergstrecken abgebrannt sind, nämlich
am 2. März ist ein großer Walddistrikt bei Plettenberg abgebrannt. Am 22.
November ist der Postillion von Altena bei Teindeln in der Lenne ertrunken.
Der Bau der chaussierten Straße Plettenberg - Eiringhausen wurde in Angriff
genommen und 1841 beendet.
Die Katholische Kirchengemeinde, die das alte Rathaus der Stadt angekauft
und zur Kirche umgebaut hat, erhält ihren ersten Pfarrer, den aus Bremen
kommenden Missionar J. P. Hachez.
Seit der Anstellung eines zweiten Lehrers in der Stadt bot das frühere zweite
Pfarrhaus nicht mehr ausreichend Raum, weshalb die Stadt das Stammhaus der
Familie des Bürgermeisters Homberg am Maiplatz für 2.750 Taler kaufte und
zur Schule umbauen ließ.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1840 - Abhaltung von katholischen Gottesdiensten
in der Kirche St. Laurentius, nachdem der Seminarpriester Heinrich Hachez die
Missionsstelle in Plettenberg angetreten hat. - Die Gemeinde Ohle stellt einen
Totengräber an. - Es gibt 88 Wohngebäude in der Gemeinde Ohle, in denen 544
Menschen leben.
1841
Der Winter war sehr streng und kalt. Die ältesten Leute versicherten, dass
sie noch nie eine strengere Kälte erlebt hätten. Am 14. Dezember war die
Lenne schon an vielen Stellen zugefroren. Am 14. und 15. Februar wurde durch
eine Eisflut das Eis wieder von der Lenne vertrieben. Die Eisgänge und
Wasserfluten haben großen Schaden angerichtet an Mühlenschlachten sowie an
den Walzen- und Hammerschlachten. So sind dem Rentrop zu Fischersverse 18
Schafe im Stall ersoffen. Im Sommer ist der Roggen auf den feldern ausgekeimt,
auch die Kartoffeln sind nicht gut eingekommen. Am 14. September holten
wir den letzten Hafer. Der teuerste Kartoffelpreis war 1 Scheffel zu 1 Taler.
Das siebenpfündige Brot wurde mit 5 Silbergroschen bezahlt. Friede war in
diesem Jahr in unserem Lande.
Gelegentlich einer Kirchenvisitation heißt es: "Die Gemeinde nimmt am
Gottesdienst fleißig teil, das Hl. Abendmahl wird in Ehren gehalten." In
diesem Jahr waren 5 Papiermühlen in Betrieb.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1841 - Leonhard Wiel ist bis 1865 Amtmann der
Landgemeinde Plettenberg. - Im Kirchspiel Plettenberg gibt es fünf Papiermühlen.
1842
Der Winter war gemäßigt, aber in der Nacht vom 16.-17. April hat es so stark
gefroren, dass am Morgen viele Fenster ganz zugefroren waren. Der Roggen
kostete 8-9 Taler das Malter.
In diesem Jahr hat der Chausseeneubau von Werdohl nach Rönkhausen seinen
Anfang genommen. Der Bau ist veranschlagt mit 32.753 Taler.
Ich habe noch nie ein Jahr erlebt, wo die Früchte so schlecht geraten
sind. Dieses Jahr war in unserem Lande Frieden.
Die Straße Plettenberg-Herscheid-Lüdenscheid wird in Angriff genommen und
bis 1845 fertiggestellt. Schon 1832 bestand zwischen Plettenberg und Herscheid
und Lüdenscheid eine Fahrpost. Aber es heißt darüber bei Schumacher in der
Chronik der Stadt- und Landgemeinde Lüdenscheid: "Wer diesen Karren in den
vielen Hohlstraßen durch Berg und Tal benutzte, kam gewöhnlich krank oder
heißhungrig an dem Ziel seiner Reise an."
In diesem Jahr ließ die lutherische Gemeinde Dach und Turm der Boeler Kapelle
gründlich erneuern. In diesem Zustand blieb die Kirche bis zum Umbau 1907.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1842 - Baubeginn der Straße von Lüdenscheid
über Herscheid nach Plettenberg. - Dach und Türme der Böhler Kapelle werden
gründlich erneuert.
1843
Am 6. August haben wir das tausendjährige Fest von Deutschlands Selbständigkeit
gefeiert. Dieses Fest ist durch ganz Deutschland gefeiert worden. Im Winter
und Frühjahr war große Not, denn die wenigen Früchte des Vorjahres waren
bald verzehrt. Die Futternot war an einzelnen Stellen so groß, dass man den
Tieren altes, durchgeräuchertes Stroh zum Futter vorwarf, ja, man hat sogar
die Strohdächer abgedeckt und mit dem Stroh die Tiere gefüttert. Ich habe das
Stroh von einem alten Bienenhaus auf der Häckselbank zum Futter verschnitten.
Mitten im Juli habe ich auf dem Felde Roggen geschnitten und für das Pferd
fertiggemacht.
Die Straße nach Rönkhausen ist mir zwei großen Walzen, welche mit 11 Pferden
bespannt waren, dicht gemacht worden. Friede war auch in diesem Jahr in
unserem Land.
Die Stadt Plettenberg zählte in diesem Jahr 1.669 Einwohner und 252 Häuser,
während die Landgemeinde 2.120 Einwohner aufwies.
Über das Plettenberger Schulwesen aus diesem Jahr urteilt der Plettenberger
Chronist Hölterhoff: ". . . dass die dortige Schule die gewöhnlichen
Anforderungen an eine Elementarschule nicht überrage." 1826 zeigte sich bei
einer Prüfung, dass die Kinder in allen 4 Bauerschaftsschulen der Gemeinde
nicht weit gefördert waren. Schuld daran trugen der unregelmäßige Schulbesuch
und die Sorgen der Lehrer, denen manche Familien das Schulgeld vorenthielten.
Dagegen rechneten die Kinder der Bremker Schule schon 1835 in dicken Tagebüchern
mit Hilfe der Gänsefeder sauber und richtig Aufgaben aus der Regeldetri mit
ganzen Zahlen, der Bruchrechnung und der Regeldetri mit Brüchen bis zu
schwierigen Fällen, und 1840 leisteten die Schüler des Lehrers Rentrop zu
Elsen Vorzügliches im Schönschreiben, in Geschäftsaufsätzen und in der
Anfertigung großartiger Kohlezeichnungen. Er erteilte nebenher auch Unterricht
im Klavier- und Flötespielen und bereitete junge Männer zum Eintritt in das
Seminar vor. Lehrer Rötelmann aus Ohle lehrte schon etwas vaterländische
Geschichte und Erdkunde, unter besonderer Berücksichtigung der Gemeinde Ohle,
und ließ Karten mit Wasserfarbe zeichnen.
Im Jahre 1843 waren in der Gemeinde Herscheid 48 Kleinschmiede in 19 Betrieben
vorhanden, die hauptsächlich Nägel, Schüppen, Pfannen, Ketten und Feilen
herstellten.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1843 - Bürgermeister Hollmann tritt offiziell
von seinem Amt zurück, führt jedoch die Amtsgeschäfte kommissarisch bis 1864
weiter. - Der Plettenberger Magistrat setzt sich aus finanziellen Gründen für
die Vereinigung von Stadt und Amt ein. - Peter Esselen, Stephan Lemmer und P.
Boeley betreiben Tuchfabriken in Plettenberg. D. W. Gregory, Hermann Bernhard
Wolf, Schmalenbach und Seißenschmidt besitzen neben ihrer Tuchfabrik auch eine
eigene Spinnerei. - Verleihung einer Fahne an die Schützengesellschaft durch
die Königin Elisabeth von Preußen, die am 24. Juli 1843 feierlich geweiht wird.
- 4.767 Menschen leben auf dem Gebiet der heutigen Stadt Plettenberg. Davon
wohnen 1.669 Menschen in der damaligen Stadt Plettenberg, 2.557 im Amt
Plettenberg und 541 in der Gemeinde Ohle.
1844
Dies war ein unfruchtbares Jahr. Am 7. September ist in Plettenberg dem Fritz
Hanebeck seine Papiermühle abgebrannt. Im April sind an der neuen
Lennechaussee die Barrierebäume gesetzt worden, einer zu Teindeln und
einer zu Pasel. Vom 1. Juni an fährt der zweispännige Postwagen
täglich zwischen Altena und Plettenberg.
In der Stadt gründete in diesem Jahr D. W. Schulte mit wenigen Arbeitern
die erste Stimmnägelfabrik, ein Erwerbszweig, der in Plettenberg
eine gewisse Bedeutung erlangen sollte, denn im Jahre 1857 waren
darin allein 96 Arbeiter und 1882 schon 150 Arbeiter beschäftigt.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1844 - P. Biermann ist Vorsteher der Gemeindevertretung
in Ohle. - Gründung der Stimmnagelfabrik D. W. Schulte. - Errichtung des
Ziegeleibetriebes Eckes am Grafweg. Die Herstellung von Ziegeln ist
Saisonarbeit, so dass die ARbeiter im Winter auf Nebenerwerb angewiesen
sind.
1845
Der Winter war so kalt, dass vielen Leuten die Kartoffeln im Keller
erfroren sind. In diesem Frühjahr war alles aufgezehrt, dem einen
fehlte dieses, dem andern das. Kartoffeln gab es in Westfalen wenig,
weil an denselben sich in diesem Sommer eine Krankheit zeigte, wodurch
sie sehr gelitten haben.
In diesem Jahr sind viele nach Amerika ausgewandert. Am Ende des Jahres
sprach man auch über den Bau einer Eisenbahn, die von Hagen nach
Siegen führen soll. Auch in diesem Jahr war Friede in unserem Lande.
Aus dem Jahre 1845 stammt ein Reisebericht des Reg.-Assessors Wohlers
über das damalige süderländische Gewerbe. Er zählt in seinem Bericht
über 20 größere Fabriken auf, von denen beispielsweise die Weiß- und
Schwarzblechfabrik von C. D. Piepenstock in Oege bei Hohenlimburg
bereits über 150 Arbeiter beschäftigt, während man in Plettenberg den
Anschluss an die neuen wirtschaftlichen Verhältnisse nur zögernd findet.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1845 - Fertigstellung der Straße von
Lüdenscheid über Herscheid nach Plettenberg. - Gründung einer Papierfabrik
durch Heinrich Wilhelm Kühne zur Erzeugung von Packpapier und Pappendeckeln,
in der 6 Arbeiter beschäftigt sind. - Karl Eduard Paffrath ist bis 1867
reformierter Prediger in Plettenberg.
1846
Mit der Kartoffelernte sah es in diesem Jahre wieder sehr schlecht aus,
die Mühlen konnten nicht mahlen, und die Fabriken standen still, denn
wegen der großen Trockenheit fehlte es an Wasser. Dieses Jahr zeitigte
viele Krankheiten, u. a. Scharlach und Nervenfieber. Fast in allen
Häusern lagen Kranke. Welche Bedeutung die ansteckenden Krankheiten
in diesem Zeiten hatten, mögen ein paar Zahlen zeigen: 1880 gab es in
Plettenberg 188 Todesfälle, darunter 54 an Masern. 1837 starben bei
insgesamt 150 Todesfällen 22 an Stickhusten und Masern. Im Jahre 1834
wurde hier zum ersten Male die Schutzpockenimpfung durchgeführt.
1846 begann H. B. Seißenschmidt mit 10 Arbeitern die Herstellung von
Holzschrauben, und 1859 wurde hier die erste Dampfmaschine in Betrieb
genommen.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1846 - Die Plettenberger Stadtverordneten
entscheiden sich am 23.11.1846 für den Hauptmann a. D. Heinrich von
Schachtmeyer als neuen Bürgermeister, der das Amt bis 1855 innehat. -
Gründung einer Fabrik für Eisenbahnoberbaustoffe und Waggonbeschlagteile
durch Hermann Bernhard Seissenschmidt.
1847
Anfangs Dezember war es noch so warm, dass wir das Vieh austreiben konnten.
Dieses Jahr war auch ein rechtes Not- und Hungerjahr. Überall war wenig
Verdienst, weil während der trockenen Witterung die Fabriken sehr schlecht
getrieben wurden. Dann mussten die Leute viel Geld zu Doktor und Apotheke
tragen. Also dieses Jahr war ein Jahr der Not, des Hungers, des Elends.
Man hörte auch, dass an vielen Stellen Räubereien und Diebereien vorgekommen
sind.
Es wäre noch schlimmer geworden, wenn nicht aus Rußland und Amerika viel
Korn geschickt worden wäre, sonst wären die Preise so hoch gestiegen wie
im Hungerjahr 1817.
Besonders im letzten Herbst sind aus unserer Gegend viele ausgewandert
nach Amerika.
Bei einem Brande im Amte Plettenberg betätigte sich auch die Bürgerschaft
der Stadt. In diesem Jahr gab es in Westfalen 24 Zeitungen, davon waren
9 national, 6 katholisch, 5 liberal und 4 parteilos.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1847 - Hauptmann Ernst Ludwig Schachtmeyer
ist bis 1855 Bürgermeister von Plettenberg. - Einreichung einer Beschwerdeschrift
beim Magistrat durch den evangelischen Pfarrer Karl Schirmer am 6. Februar 1847.
In ihr wird die Vereinigung von Stadt und Amt und die Annahme der Landgemeindeordnung
gefordert. 112 Plettenberger Bürger unterstützen die Beschwerde durch ihre
Unterschrift. Die Mehrheit der Plettenberger Stadtverordneten lehnt den Antrag
Schirmers ab, weil sie der Ansicht sind, dass die revidierte Städteordnung
die für Plettenberg sinnvollste Kommunalverfassung ist. - Umbau der städtischen
Tuchwalkemühle am Düppenhaus in eine Papierfabrik durch G. F. Gregory und D.
W. Boeley. - Gründung der Gesellschaft "Club" zur Pflege von Geselligkeit und
guter Unterhaltung im kleinen, bürgerlichen Kreis.
1848
Folgendes werde ich aus diesem merkwürdigen Jahr berichten: Die Kälte war
stark im Winter, und die Erde so hart gefroren, dass der Totengräber kaum
die vielen Gräber herstellen konnte, die erforderlich waren.
Aber dieses Jahr war ein fruchtbares Jahr. Es war eine Lust zuzusehen,
wenn man über die Felder ging.
Dieses Jahr war ein ereignisvolles Jahr und wird das Revolutionsjahr des
19. Jahrhunderts heißen. Im März entstanden auch in unserer Gegend Unruhen,
in Köln und Elberfeld, Solingen, in Hagen, Iserlohn, Attendorn, Altena
und Balve. In Plettenberg hatten sie gleichfalls eine Rebellion angestiftet,
wo sie dem Justizkommissarius Rauschenbusch an seinem gepachteten Hause
die Fenster einwerfen wollten. Sie haben aber das Zimmer seines Hausbesitzers
getroffen und haben an selbiger Stelle die Fenster entzweigeschlagen und
geworfen, und noch an mehreren Häusern der Stadt sind Fensterscheiben
zertrümmert worden.
Bei diesen verworrenen und unruhigen Zeiten lagen Handel und Wandel und
alle Fabriken still. In Altena hat man die Leute damit beschäftigt, Straßen
anzulegen. Es bildeten sich überall demokratische Vereine.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1848 - Eröffnung einer katholischen Schule
in Plettenberg.
1849
Noch im Monat Juli hat es Reif gegeben. Dieses Jahr war ein Jahr von
mittelmäßiger Fruchtbarkeit. Im Sommer und Herbst hat die Cholera in
den größeren Nachbarstädten gewütet.
Auch in unserer Gegend entstanden im Frühjahr wieder viele Unruhen. In
der Stadt Iserlohn haben sich die Anführer aus vielen Städten versammelt,
vor allem aus Hagen. Auch aus Plettenberg sind zwei Anführer nach Iserlohn
gegangen, wo einer die Plettenberger Stadttrommel mitgenommen hat, welche
er in der Stadt Neuenrade in Branntwein vertrunken hat und ohne Trommel
nach Iserlohn gegangen ist.
Die Vorgänge vom 17. Mai 1849 in Iserlohn sind bekannt. Drei Teilnehmer
aus Hagen, Dr. Grevel, Butz und Post, sind nach den Vereinigten Staaten
geflohen und haben dort eine neue Heimat gefunden. Bei der 25-jährigen
Gedenkfeier des Jahres 1849 am 15.06.1874 hat C. Butz aus Hagen in
Chikago ein Gedicht über die Vorgänge in Iserlohn, an denen er ja selbst
beteiligt war, vorgetragen.
1850
Das Jahr 1850 steht noch stark unter den Nachwirkungen des unruhigen
Vorjahres. Man meinte, es würde im Herbst zu einem blutigen Kampfe mit
den Mächten kommen, . . . und es war bei uns große Unruhe. Es ist aber
zu keinem Kampfe gekommen und am Schluss des Jahres meinte man, die
Streitigkeiten würden wieder beigelegt werden.
So weit die Aufzeichnungen des Joh. Diedrich Ossenberg.
Bd. 5 der Stadtgeschichte 1997: 1850 - Der Plettenberger Gemeinderat wird
erstmals nach dem neuen Dreiklassenwahlrecht gewählt, bei dem das gemeindliche
Steueraufkommen der Wähler die Grundlage des Wahlrechts bildet. - Gründung
der Fabrik der Gebrüder Wagner beim Köbbinghauser Hammer, die Bau- und
Möbelbeschlagteile herstellen.
1851
Einführung der neuen preußischen Gemeindeordnung, der westfälischen Städteordnung,
am 6. Februar 1851 in Plettenberg, die die revidierte Städteordnung von 1831
ablöst. - Vereinigung der lutherischen und der reformierten Gemeinde in Plettenberg.
1852
4.743 Menschen wohnen auf dem Gebiet der heutigen Stadt Plettenberg. Davon leben
1.691 Menschen in der damaligen Stadt Plettenberg, 2.497 im Amt Plettenberg
und 555 in der Gemeinde Ohle.
1853
Oeffentlicher Anzeiger als Beilage zum 43. Stücke des Amtsblattes, Arnsberg, den 22. October 1853.
S. 884: B.I. Nr. 2894. Anlegung einer Lohgerberei zu Plettenberg.
Der Lohgerber Wilhelm Brandhoff zu Plettenberg beabsichtigt, auf seinem Garten
Flur 9. Nro. 382 am Umlauf, eine Gerberei anzulegen.
Diejenigen, welche gegen dieses Vorhaben in polizeilicher Beziehung gegründete
Einwendungen zu machen haben, müssen solche innerhalb vier Wochen bei dem
Bürgermeister daselbst, wo auch die Zeichnung zur Ansicht offen liegt,
anzubringen.
Plettenberg, den 17. October 1853 - Der Bürgermeister.
Bd. 5 Plettenberger Stadtgeschichte, S. 290 - 1853: Bürgermeister von Schachtmeyer
erläßt eine 44 Paragraphen umfassende Straßenordnung für die Stadt Plettenberg. -
Vereinigung der beiden evangelischen Schulen in Plettenberg.
1854
Gründung der Sparkasse in Plettenberg am 24. Juli 1854.
1855
Es sind nur noch zwei Sensenschmieden in Arbeit, deren Stilllegung Anfang
der 1870er Jahre erfolgt. - Stürme und Überflutungen richten in Plettenberg
große Schäden an. - 4.704 Menschen leben auf dem Gebiet der heutigen Stadt
Plettenberg. Davon wohnen 1.695 Menschen in der damaligen Stadt Plettenberg,
2.443 im Amt Plettenberg und 566 in der Gemeinde Ohle.
August 1882
Altenaer Kreisblatt Nr. 62 vom 5. August 1882, 49. Jahrgang
Totenköpfe über Totenköpfe!
Ohle. 31. Juli 1882. Heute begann man mit einer schon länger beabsichtigten
und dringend nötigen Reparatur an der hiesigen Kirche und Sacristei. Besonders im
letzteren Raum mußte man, des schon seit vielen Jahren empfundenen ekelhaften
Modergeruchs wegen, gründliche Erneuerung schaffen, und wollte zunächst einen neuen Fußboden legen. Kaum hatte man eins der uralten Beschußbretter aufgebrochen
- da, was sah man im schaurigen Halbdunkel des darüber befindlichen Gewölbes!
Totenköpfe über Totenköpfe! 25 Stück schon auf den ersten Blick, den einen über dem
andern, neben dem andern.
Quelle: Bd. 5 der Stadtgeschichte, Chronik der Stadt Plettenberg, S. 296
1886
Otto Vorwerck ist bis 1906 Amtmann der Landgemeinde Plettenberg. - Gründung
der Metallwarenfabrik Wilhelm Schade am 1. Oktober 1886, die Hut- und
Mantelhaken herstellt. - Karl Hawerkamp wird Pfarrer in Ohle.
1887
Der Aufbau einer Wasserversorgung für Plettenberg wird am 14. Juni 1887
vom Magistrat beschlossen. Die Bewohner versorgten sich vorher aus
Brunnen, die sich in ihren Häusern befanden, mit Wasser. - Betriebaufnahme
der "Kreis Altenaer Schmalspur-Eisenbahn-Actiengesellschaft" am 1. Oktober 1887.
Die Betriebslänge der drei Bahnstrecken von Altena nach Lüdenscheid, von
Werdohl nach Augustenthal und von Halver nach Schalksmühle beträgt 38 km.
Das Aktienkapital befindet sich in den Händen des Preußischen Staates, der
Landgemeinde Lüdenscheid, der Gemeinde Halver und einzelner Personen. -
Gründung einer Heu- und Düngegabelfabrik durch F. Groote an der Ziegelstraße
und durch Robert und Hermann Plate auf dem Bruch bei Holthausen.
1888
Inbetriebnahme der städtischen Wasserversorgung, an die noch nicht alle
Plettenberger Bürger angeschlossen sind, mit natürlichem Zufluss ohne
Pumpwerk am 1. Juli 1888. 276 Hausbesitzer wollen sich an das zentrale
Leitungsnetz anschließen lassen, während 151 Hausbesitzer den Anschluss
ablehnen. - Auflösung der höheren Mädchenschule wegen zu geringer
Schülerzahlen. - Gründung des Männergesangvereins Bremcke. - Gründung des
Turnvereins Westfalia Holthausen.
1889
Errichtung eines Walzwerkes in Ohle durch die Fabrikanten Kölsche, Dieckerhoff
und Achenbach. - Eduard Ebbinghaus ist bis 1917 evangelischer Pfarrer in
Plettenberg.