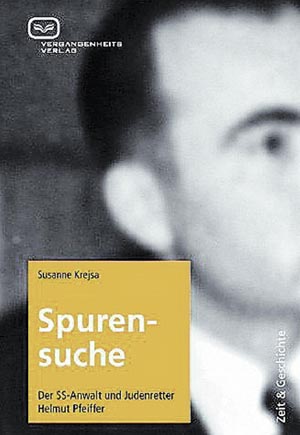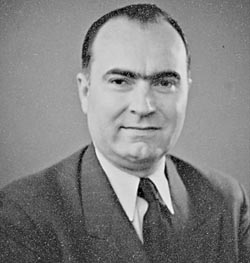|
Quelle: Süderländer Tageblatt vom 09.04.2012
SS-Anwalt Helmut Pfeiffer: In der
Das Buch von Susanne Krejsa begibt sich buchstäblich auf Spurensuche nach
dem "wahren" Helmut Pfeiffer. Helmut Pfeiffer (1907-1945) aus Eiringhausen machte
eine steile Karriere in der NSDAP, fiel aber gegen Ende des Zweiten Weltkrieges
bei den NS-Spitzen in Ungnade. Er soll mehreren verfolgten Juden das Leben gerettet
haben. Quelle: Deutsches Bundesarchiv
Von Jonas Mueller-Töwe
PLETTENBERG. Das Buch über den Eiringhauser SS-Mann Helmut Pfeiffer ist
erschienen: "Spurensuche - Der SS-Anwalt und Judenretter Helmut Pfeiffer" heißt
es. Seit etwa sechs Wochen liegt eines der ersten Exemplare auf meinem Schreibtisch,
es ist gelesen, zahlreiche bunte Klebezettelchen ragen zwischen den Seiten hervor.
Auf manche habe ich Notizen gekritzelt. Eigentlich ist alles bereit für die Rezension.
Trotzdem fällt sie mir nicht ganz leicht.
Erste Recherche über die Heimatzeitung
Über einige Monate beschäftigten uns die Recherchen der Autorin. Mehrere Artikel
erschienen. Gelegentlich ließ sich etwas für das Buch verwerten - auch Dank zahlreicher
Hinweise von Lesern. Nun, da das Ergebnis der Recherchen in Buchform vorliegt, fällt
es schwer ein distanziertes Urteil darüber zu fällen. Vor allem, da Krejsa schon im
Anfangskapitel ein sehr großes Fass aufmacht: "Nicht einmal zu Hause [in] Eiringhausen
weiß man von seinen Heldentaten." Konkret: von seinen Bemühungen um mehrere jüdische
Familien, seinen Bemühungen um internierte dänische Polizisten, seiner gescheiterten
Flucht gemeinsam mit polnischen Juden. Doch war Helmut Pfeiffer, der SS-Mann, wirklich
ein Held? Und was ist das überhaupt?
Krejsa beschreibt den Aufstieg des Mannes sehr detailliert: Nach seinem Jurastudium
in Köln geht er nach Berlin, pflegt Kontakt zum umstrittenen Plettenberger Staatsrechtler
Carl Schmitt. Schon in Köln im Jahr 1927 hat er in NSDAP-Kreisen verkehrt und sich für
die Partei engagiert, unter anderem als Rechtsberater. 1931 tritt er schließlich bei
und wird 1932 Gauabteilungsleiter des Bundes Deutscher Juristen. Gründer und Präsident
ist Hans Frank, der spätere "Schlächter von Polen". In seinem Fahrwasser wird Helmut
Pfeiffer der Aufstieg ins Reichsicherheitshauptamt in Berlin gelingen. Dort wird der
industrielle Massenmord geplant, vorbereitet und umgesetzt. Doch zuvor widmet sich
Pfeiffer gemeinsam mit Frank im Bund Deutscher Juristen und später als Generalsekretär
in der Internationalen Rechtskammer der politischen Umsetzung der Schmittschen Theorie.
Im Fahrwasser von Hans Frank
Schließlich wird Pfeiffer 1938 SS-Mitglied. Ein Empfehlungsschreiben erhält er von Hans
Krüger, dem späteren SS- und Polizeiführer im Generalgouvernement, dem besetzten Polen.
Ein Jahr später, nach dem Überfall auf Polen, folgt Pfeiffer seinem Vorgesetzten dorthin.
Frank wird Generalgouverneur, Pfeiffer wird Leiter der Wirtschaftsabteilung mit Sitz in
Berlin. Das bedeutet: Er ist maßgeblich an der Ausplünderung Polens und der Arisierung
der dortigen jüdischen Betriebe beteiligt. Als enger Vertrauter Franks muss er von Beginn
an über den Massenmord informiert gewesen sein. Auf Distanz lässt ihn das nicht rücken.
Im Gegenteil: Seine Karriere schreitet voran. 1941 wird er Mitarbeiter im
Reichssicherheitshautpamt, der zentralen Stelle des nationalsozialistischen Terrors. Von
dort aus werden europaweit Juden gejagt. Täglich gehen Abschlussberichte ein. Als sein
Ziehvater Frank 1942 ins Abseits gerät und vor der Ablösung steht, dient sich Pfeiffer
Justizminister Thierack an. Er ist Urheber der Aktion "Vernichtung durch Arbeit" und
liefert sich ebenso wie Himmler ein zähes Kompetenzgerangel mit Frank. Doch Frank bleibt
im Amt und Pfeiffer unterstützt ihn wieder.
Allerdings macht er sich auch Feinde innerhalb der Partei und des NS-Staats. So verklagt
er 1942 oder 1943 die Gestapo, weil sie den Besitz eines Nichtariers in Polen konfisziert
hat. Das kann im Dienste Franks geschehen sein, der sich vor allem bei der Plünderung der
Kunstschätze ein Wettrennen mit Hermann Göring lieferte. Anfang 1944 wird Pfeiffers
Wehrdienst-Freistellung gestrichen. Von da an tut er alles, um seine Einziehung zu einer
Bewährungseinheit zu verhindern, da dies einem Todesurteil gleichkommt. In der Einheit
werden Unerwünschte gebündelt; sie gelten als Kanonenfutter.
1945: Fluchtversuch nach Schweden
Allein diesen Werdegang zu verfolgen, macht das Buch von Susanne Krejsa spannend zu lesen.
Schwieriger wird es, wenn die Sprache auf die belegbaren Rettungsaktionen kommt. Da wäre
zum einen das Bemühen um die jüdische Familie Silten: Unbestritten ist, dass Pfeiffer
trotz Verbots versuchte, seine Beziehungen spielen zu lassen, um die Deportation und
Ermordung der Familie Silten zu verhindern. Allerdings erhielt er dafür 75 000 Reichsmark
von seinem Auftraggeber, dem Industriellen Heinrich Dräger. Unklar ist, ob für
Bestechungsgelder oder als Entlohnung. Tatsächlich aber überlebt der Großteil der Familie
aufgrund der juristischen Tricksereien.
Ebenfalls auf Initiative Drägers versucht Pfeiffer selbiges für die Familie Kozower umsonst:
die Familie wird in Theresienstadt ermordet. Auf Initiative eines dänischen Juristenkollegen
setzt sich Pfeiffer dann auch für den jüdischen Textilhändler Levysohn sowie für internierte
dänische Polizisten ein. Im ersten Fall ohne Erfolg, doch die dänischen Polizisten werden
tatsächlich nicht in die deutschen Konzentrationslager deportiert.
Eine sehr dünne Quellenlage
Abschließend ist es jedoch unmöglich zu sagen, ob Pfeiffer schlicht bestechlich war und
sich deshalb bei noch fanatischeren Antisemiten unbeliebt machte. Oder hat er tatsächlich
eine innere Wandlung durchlaufen? Dass er mit dem gut organisierten dänischen Widerstand
paktierte, wie Krejsa an der ein oder anderen Stelle mutmaßt, erscheint unwahrscheinlich.
Ein Historiker, den die Autorin ebenfalls zu Wort kommen lässt, gibt zu bedenken, dass in
diesem Fall eine Flucht nach Schweden so kurz vor Kriegsende nicht notwendig gewesen wäre.
Schon gar nicht für die Juden, die in Dänemark relativ sicher waren. Einen klaren Schluss
lässt das tatsächlich Belegbare einfach nicht zu.
Aber gerade das macht auch die Stärke des bewusst sehr subjektiv gehaltenen Buches aus:
Krejsa nimmt ihre Leser mit auf eine Spurensuche, recherchiert, spekuliert, wird von
Ergebnissen enttäuscht und überrascht, lässt andere Meinungen zu. Das ist spannend und
funktioniert über weite Strecken des Buches sehr gut. Wäre das wissenschaftlich schwammige
und mit Sicherheit zu diskutierende Kapitel über Heldentum zu Beginn nicht: Es wäre ein
noch besseres Buch.
Susanne Krejsa, "Spurensuche - Der SS-Anwalt und Judenretter, Helmut Pfeiffer",
Vergangenheitsverlag, Berlin 2011, 18,90 Euro
|