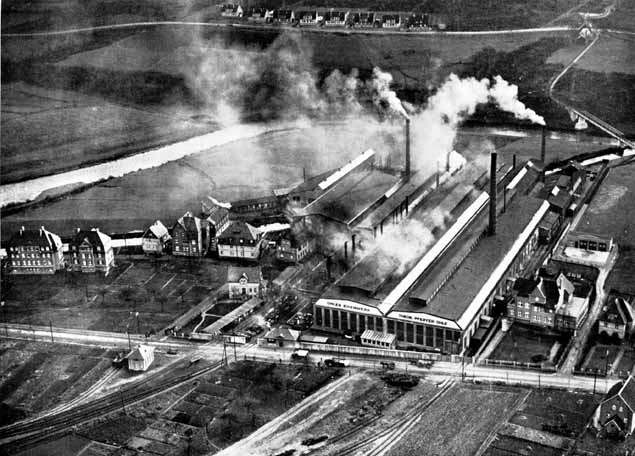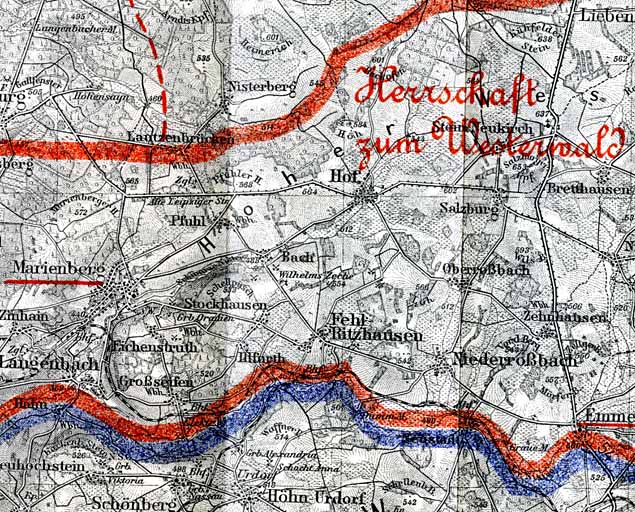|
Quelle: Werkarchiv Ohler Eisenwerk, 5 Seiten DIN A 4, maschinengeschrieben
Der Gründer des Ohler Eisenwerkes Theobald Pfeiffer wurde am 3. Oktober
1859 in Hof im Westerwald geboren. Nach dem Besuch mehrerer Schulen und
erfolgreich abgeschlossener Lehre übernahm er im Jahre 1882 ein Textilgeschäft
in Siegen. Durch seinen persönlichen Fleiß und wirtschaftliche Tüchtigkeit
konnte er dieses kleine Geschäft sehr bald zu einem für damalige Verhältnisse
größeren Unternehmen ausweiten. Das Jahr 1895 bedeutete dann einen entscheidenden
Wendepunkt in seinem Leben. Durch Zufall konnte er ein kleines Walzwerk in
Ohle erwerben, dessen Inhaber in finanzielle Schwierigkeiten geraten war.
So paradox es klingen mag: ihm kam dabei zustatten, dass er aus einer gänzlich
anderen Wirtschafts- und Branchengruppe kommend, die Möglichkeiten klarer übersah.
Trotzdem war es ein kühner Sprung, die Führung eines Werkes der Eisenindustrie
zu übernehmen.
Es muss hier gesagt werden, dass schon Ende der 90er Jahre die Zukunft der
sogenannten reinen Walzwerke sehr umstritten war. Man glaubte allgemein, dass
dass Walzwerke nur noch in unmittelbarer Anlehnung an Stahlwerke bestehen
könnten, so dass für das isolierte kleine Walzwerk die Transport- und
Fabrikationskosten in ungünstigem Sinne entscheidend werden müssten, je mehr
die technische Vervollkommnung voranschreite, die die großen Unternehmungen
mit ihrer stärkeren Kapitalkraft mehr begünstige.
Das Ohler Werk mit seinen drei Walzgerüsten und 100 Mann Belegschaft war sehr
primitiv ausgestattet. Die Rohstoffe, Eisen und Kohlen, wurden mit Pferdefuhrwerk
von dem benachbarten Bahnhof Plettenberg abgeholt. Ebenso wurden die fertigen
Bleche wieder mit der Fuhre nach Plettenberg zurückgefahren. Dabei ließ es sich
nicht vermeiden, dass die Bleche bei Regen- und Schneewetter nass wurden, was zu
unangenehmen, aber berechtigten Beanstandungen seitens der Abnehmer führte.
Auch ließ die Wirtschaftskonjunktur der Jahre 1896 - 1899 die Übernahme des
Betriebes nicht gerade verlockend erscheinen. Erst im Jahre 1900 kam eine
kurze Hochkonjunktur, auf die jedoch bald ein ebenso scharfer Rückschlag erfolgte.
Aber es darf hier nicht vergessen werden, dass Theobald Pfeiffer in seinem
Siegener Textilgeschäft eine wertvolle Stütze für das Unternehmen hatte. Er
benutzte die dort anfallenden Gewinne, um durchgreifende technische Verbesserungen
vorzunehmen, die dem Zielstreben seines neuen Besitzers entsprachen,
Qualitätserzeugnisse mit allen Mitteln moderner Technik herzustellen und sich
damit einen festen Platz bei der Abnehmerschaft zu sichern, die den Wert
gleichmäßiger bester Qualität für die Weiterverarbeitung zu schätzen wusste.
Das Werk verfügte 1896 über eine Walzenstraße mit drei Walzgerüsten, die mittels
einer Wasserturbine angetrieben wurden. Bereits 1897 wurde eine neue Walzenstraße
mit zwei Feinblechgerüsten und einem Blockgerüst aufgestellt, die nunmehr mittels
Dampfmaschine angetrieben wurden. Der Dampf wurde aus Abhitzekesseln gewonnen, die
über den Walzwerköfen angebracht waren. Die neue Walzenstraße machte das Ohler
Werk unabhängig vom Bezug der Platinen, und es konnten hohe Aufpreise eingespart
werden, die aus ihren verschiedenen Abmessungen herrührten.
Durch die neue Einrichtung konnte die Qualität der Platinen wesentlich gebessert
werden. Durch das schweißarme Auswalzen der jetzt als Ausgangspunkt verwendeten
Blöcke wurde lästige Blasenbildung im Blech vermieden und gleichzeitig wurde die
Oberflächenbeschaffenheit der Platinen durch eine besondere Behandlungsart so
verbessert, dass das Endprodukt daraus großen Nutzen zog.
Ein weiterer wichtiger Fortschritt wurde Ende 1896 durch die Genehmigung zum Bau
eines Anschlussgleises erzielt. Dieses war im Frühjahr 1897 fertiggestellt. Das
Rangieren wurde zunächst noch mit einem Pferd besorgt, später mit einer Rangierwinde.
Infolge der größeren Leistungsfähigkeit des Betriebes und der wesentlichen
Qualitätsverbesserungen fasste das Werk unter der neuen Führung schnell Fuß. Der
Versand hatte im Jahre 1896 6.300 Tonnen, 1900 7.300 Tonnen betragen und 1901
wurde eine Erzeugung von 8.100 Tonnen erreicht, worauf dann der starke Konjunkturabstieg
auch das Ohler Werk in seinen Produktionsziffern ungünstig beeinflusste.
An dem schnellen Aufstieg waren weitere Produktionsverbesserungen beteiligt. Die
letzte Phase der Fabrikation war das Glühen der fertig gewalzten Bleche in den
Walzwerksöfen. Da es nicht möglich war, einigermaßen genaue Temperaturregulierungen
der Öfen zu erreichen, und man auch noch keine Unterlagen für die richtige Glühdauer
hatte, so wurde die Schätzung der Glühtemperatur und Glühdauer den Walzarbeitern
überlassen. Infolgedessen konnte es nicht ausbleiben, dass das Endprodukt in den
Härtegraden große Unterschiede aufwies, und in einer einzigen Lieferung viele
Blechqualitäten enthalten waren.
Für die Abnehmer hatt dies, wenn die Ansprüche an die Qualität auch damals noch nicht
so hoch waren, doch unangenehme Verarbeitungsschwierigkeiten zur Folge. Gelang es,
diesen Fehler auszumerzen und den Abnehmern ein gleichmäßiges Produkt von einheitlichen,
nach den Wünschen des Kunden bestimmbaren Härtegraden zu liefern, so war eine wichtige
Etappe auf dem Wege der Ohler Bleche zum Qualitätserzeugnis erreicht.
Im Jahre 1900 wurde ein neueartiger Glühofen erbaut, an dessen Konstruktion Theobald
Pfeiffer in Zusmamenarbeit mit einem Ingenieur maßgeblich beteiligt war. In diesem
Ofen wurden die Bleche 2 m hoch gestapelt und dann 10 Stunden in offenem Feuer
durchglüht. Die Ergebnisse waren so ausgezeichnet, dass alle Bleche auf diese Weise
bearbeitet wurden. Die so behandelten Bleche hatten ein besonders einheitliches Korn
und gute Verarbeitungseigenschaften.
Um die Verluste zu verringern, die durch die Notwendigkeit des Auswalzens schwer
verkäuflicher, starker Bleche entstanden (bei Schichtbeginn mussten die Walzen durch
das Durchlaufenlassen stärkerer Bleche vorgewärmt werden), wurde ein Stanzwerk
erbaut, in dem diese anfallenden Mittelbleche auf Laschen und Unterlegscheiben in
allen möglichen Formen weiter verarbeitet wurden. Dies gab auch die Möglichkeit, die
Abfallbleche auszunutzen. So wurde der notleidende Ohler Betrieb in wenigen Jahren
zu einem technisch und kaufmännisch hervorragend geführten Unternehmen.
Zwar hatte sich das Siegener Geschäft weiter sehr gut entwickelt, doch die überaus
günstige Entwicklung des Ohler Feinblechwalzwerkes nahm die Aufmerksamkeit und die
Arbeitskraft Theobald Pfeiffers so sehr in Anspruch, dass an eine Weiterführung beider
Betriebe durch denselben Inhaber nicht mehr gedacht werden konnte. So wurde dann,
nicht ganz leichten Herzens, das Siegener Textilunternehmen im Dezember 1911 günstig
verkauft. Theobald Pfeiffer behielt seinen Wohnsitz in Siegen bei, da vielfältige
geschäftliche und ehrenamtliche Interessen ihn an diesen Platz fesselten.
Nach dem Konjunkturrückschlag der Jahre 1902 - 1905 stieg die Produktion des Ohler
Werkes, nur von den Kriegsjahren unterbrochen, wieder kontinuierlich an. Unablässig
wurde für die technische Fortentwicklung und Erneuerung des Werkes Sorge getragen.
Im Frühjahr 1903 wurde das die Lenne stauende Wehr von einer großen Flut weggeschwemmt
und durch ein neues schweres Stauwehr ersetzt. Ende des Jahres 1907 brannte durch
Selbstentzündung das ganze Dach des damaligen Lagers für Schmiermaterial und Putzwolle
ab. Es wurde ein solides neues Dach in Eisenkonstruktion in kurzer Zeit ausgeführt.
Dabei wurde über der Walzenstraße eine Krananlage angebracht, die ein rasches Ein-
und Ausbauen der Walzenständer bei den regelmäßigen Überholungen möglich machte.
Im Jahre 1911 wurde die ganze Walzenstraße I abgerissen, um durch schwerere Ständer,
stärkere Walzen und ein schwereres Schwungrad ersetzt zu werden.
Schon 1913 wurde eine neue grundlegende Veränderung für das Ohler Werk geplant.
Wie schon mehrfach häuften sich auch damals wiederum die Bedenken, ob die reinen
Walzwerke den neuzeitlichen Warmwalzbetrieben der gemischten großen Werke
standhalten könnten. Das Vorhandensein einer solchen Einrichtung hätte Ohle die
Möglichkeit gegeben, hochwertige Bleche, Stanz- und Tiefstanzbleche herzustellen.
Auf lange Zeit würde dann die Konkurrenzfähigkeit des Werkes gesichert gewesen
sein.
Der Entschluss wurde gefasst und die Aufträge für die 90 Meter lange Halle, die
Walzenstraße, Öfen, Beize usw. Anfang 19814 erteilt. Die Arbeit ging flott vonstatten.
60 Italiener waren bereits mit den Erdarbeiten beschäftigt, als die Kriegserklärung
des 31. Juli alles lahmlegte. Ein großer Teil der Belegschaft wurde einberufen, die
italienischen Arbeiter reisten ab und alle Arbeitskräfte, die irgendwie militärtauglich
waren, stellten sich freiwillig. Auch die beiden Söhne Theobald Pfeiffers und seine
Schwiegersöhne folgten dem Ruf des Vaterlandes. Ohle lag still und verlassen.
Aber schnell kam man zu der Einsicht, dass, wenn auch mit Einschränkung, gearbeitet
werden musste, um Heer und Heimat mit dem notwendigsten Material zu versorgen. Das
Walzwerk kam mit zwei Walzstraßen wieder in Betrieb. Aber auch die Fortführung des
Neubaues konnte trotz Ungunst der Zeiten durchgesetzt und dieser im September 1915
in Betrieb genommen werden. Die neuen, mustergültigen, Arbeitskräfte sparenden
Einrichtungen wirkten sich sofort auf die Produktionshöhe erheblich aus. Der Versand
stieg von 6.428 t im Jahre 1015 auf 13.164 t im Jahre 1916 und auf 15.245 t im Jahre
1917.
Es waren nämlich zu den bisherigen sogenannten Kaltgerüsten 4 Vor- und 4 Fertig-
Warmgerüste gekommen, die nun von einem Elektromotor mit einem Verbrauch von 600
Kilowatt angetrieben wurden. In konsequenter Durchführung der Neuorganisation
des Werkes wurde auch die Wasserkraft der Lenne besser ausgenutzt. Eine neue 400
PS-Turbine zur Erzeugung elektrischer Energie wurde eingebaut, der Rest des
notwendigen Kraftstroms von dem Elektrizitätswerk Siesel bezogen. Das neue
Blockwalzwerk war in der Lage, 200 t Vorblöcke innerhalb 24 Stunden auszuwalzen.
Diese durchgreifende Modernisierung machte sich schnell bezahlt, und die oben
vermerkten Versandziffern beweisen, dass die jetzt hergestellten Ohler Qualitätsbleche
sich einer ebenso großen Beliebtheit wie die Handelsbleche erfreuten. Die Belegschaft
stieg wieder an, und es erwies sich als notwendig, für die neuen Arbeitskräfte in der
Nähe des Werkes Unterkunft zu schaffen. Ein Teil der Arbeiter musste stundenlange Wege
zurücklegen. Sie kamen mit Stalllaternen und Henkelmann und es erscheint heute kaum
glaubwürdig, welche Strapazen diese Menschen auf sich nahmen. Ferien kannte man nicht.
Dabei war der körperliche Einsatz viel schwerer als heute, wo alles mechanisiert ist.
Im Jahre 1914 und 1915 wurden 40 Wohnungen errichtet, und diese soziale Tätigkeit
wurde in den kommnden Jahrzehnten regelmäßig fortgesetzt. Trotz der Ersparnis an
Arbeitskräften durch Inbetriebnahme der neuen Anlage war es während des Krieges schwer,
Atrbeitskräfte in genügender Masse zu erhalten. So musste man sich von 1916 ab mit
ca. 80 Kriegsgefangenen, Franzosen, Belgier und einigen Indern helfen. Auch der
Materialmangel machte sich zusehends bemerkbar; Rohmaterial war fast nur gegen
Ablieferung von Schrott zu erhalten, und so musste auch den Abnehmern gegenüber
die Lieferung von der Rückgabe von Schrott abhängig gemacht werden. Infolge dieses
Materialmangels senkten sich die Produktionsziffern gegen Ende des Krieges wieder,
um dann von 1919 bis 1929 wieder regelmäßig anzusteigen.
Am 10. Juli 1920 konnte in schlichter Feier das 25-jährige Bestehen der Firma "Ohler
Eisenwerk Theob. Pfeiffer" begangen werden. 9 Jubilare wurden als getreue Mitarbeiter
gefeiert und der Arbeiter-Unterstützungs-Fond auf RM 250.000,00 erhöht. Theobald
Pfeiffer selbst erhielt viele Beweise der Verehrung von seiner Gefolgschaft und der
Ohler Einwohnerschaft.
Quelle: Süderländer Tageblatt vom 03.10.1939
Theobald Pfeiffer 80 Jahre alt
Ohle. 3. Okt. Wie gestern schon kurz mitgeteilt, feiert am heutigen Tage
der Seniorchef des weltberühmten Ohler Eisenwerkes, Herr Fabrikant Theobald
Pfeiffer, seinen 80. Geburtstag. In bester Rüstigkeit kann der Jubilar nun auf
80 Jahre seines arbeits- aber auch erfolgreichen Lebens zurückblicken. Ein
Leben, das nichts anderes kannte als Dienst an der Allgemeinheit.
Im Jahre 1895 erwarb Herr Pfeiffer von der Firma Achenbach, Kölsche & Co. deren
kleines Unternehmen bei Ohle, das diese 1889 gegründet hatten, und baute es im
Laufe der Zeit aus zu einem Werk von Weltruf. Der weit vorausschauende Blick
des Jubilars erkannte alsbald, dass die Ansprüche an die Qualität der Bleche
immer größer wurden, er war daher stets darauf bedacht, sein Werk den Erfordernissen
der Zeit entsprechend zu modernisieren.
Zu dem Feinblechwerk wurde 1914 ein Warmwalzwerk mit modernsten Walzstraßen und
Normalisieröfen errichtet. In der Feinblechbranche stand das Werk bald an erster
Stelle und seine Tiefstanz- und Karosseriebleche haben besten Klang im In- und
Ausland. Die Hauptstromversorgung des gewaltigen Werkes erfolgt durch zwei eigene
Kraftwerke. Zweimal musste die Reichsstraße verlegt werden, um der gewaltigen
Ausdehnung der industriellen Anlagen Platz zu machen.
Während in der Zeit des deutschen Niederganges viele reine Walzwerke eingingen
oder von Konzernen aufgesogen wurden, gelang es Herrn Pfeiffer, sein Werk
selbständig zu erhalten und es wohlbehalten durch alle Klippen dieser schweren
Zeit hindurchzulenken. Vorbildlich war auch stets der soziale Gedanke des nunmehr
Achtzigjährigen. Das Wohl und Wehe seiner Gefolgschaftsmitglieder lag ihm stets
am Herzen und es zeugt von dieser vorbildlichen sozialen Einstellung, wenn heute
mehr als 45 Prozent aller Gefolgschaftsmitglieder in Werkswohnungen wohnen bzw.
durch Unterstützung des Werkes Siedlungsbauten errichten konnten.
Vor zwei Jahren erhielt das Werk das Gau-Diplom als Anerkennung für die Errichtung
eines schönen Gefolgschaftshauses und anderer vorbildlicher sozialer Einrichtungen.
Schon weit vor dem Weltkriege wurde ein Unterstützungsfond für in Not geratene
Arbeiter errichtet, dem im Laufe der Jahre immer wieder neue Zuwendungen gemacht
wurden. In seiner Heimatstadt Siegen stand der Altersjubilar viele Jahre hindurch
im Dienste der Allgemeinheit als Stadtrat, Handelsgerichtsrat, Mitglied der
Handelskammer und des Presbyteriums der evang. Kirche.
Quelle: Beiträge zur Geschichte der Familie Pfeiffer und anderer
Westerwälder Familien; Heft 2; Theobald Pfeiffer - ein arbeits- und
erfolgreiches Leben - zu seinem 80. Geburtstage am 3. Oktober 1939; von
Dr. Kurt Pfeiffer, Aachen, im September 1939
Heimat und Jugend
Am 3. Oktober 1859 wurde dem Landwirt Christian Wilhelm Pfeiffer und seiner
Ehefrau, der Julie Marie geb. Uhr, als drittes Kind ein Knabe geboren. Es
erhielt den Namen Theobald.
Die Pfeiffers und auch die Uhrs waren seit vielen Jahrhunderten auf dem
oberen Westerwald ansässig. Die Stammbäume beider Familien lassen sich in
einzelnen Zweigen bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts verfolgen. Diese
Landwirtsfamilien sind natürlich immer sesshaft gewesen, zumal ihre
Bewegungsfreiheit über die Grenze des kleinen Territoriums hinaus auch
durch die Landesherren erschwert war. Durch einen glücklichen Zufall sind
aber auch die Tauf-, Trau- und Sterberegister des Kirchdorfes Marienberg
alle erhalten geblieben und darüber hinaus vermochten Gerichts- und
Schöffenurkunden von Emmerichenhain und aus dem Staatsarchiv in Wiesbaden
Aufschluss geben.
. . .
. . .
|