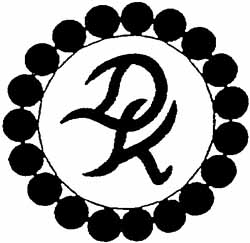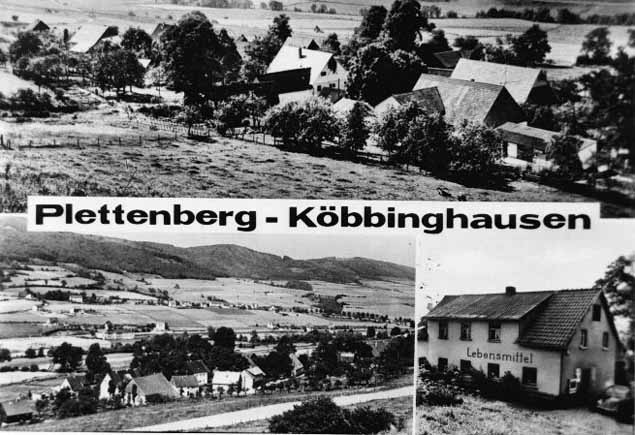|
"Die Krone des Amtes Plettenberg"
Eine kleine Ortschronik des Bergbauerndorfes
VORWORT
Die Dorfgemeinschaft initiierte diese kleine Chronik. Sie ist allen gewesenen,
jetzigen und künftigen Bürgern des Ortsteiles gewidmet und soll stolz machen
auf die jahrhundertealte Geschichte, erinnern an freie Köbbinghauser Bürger,
die in landschaftlich hervorragender Lage mit Blick auf das Elsetal ihre Häuser
errichteten und ihr täglich Brot verdienten.
Einst nannte man Köbbinghausen »Die Krone des Amtes Plettenberg«. In einer Zeit
fallender Grenzen und eines vereinten Europas ist Köbbinghausen heute ein
Edelstein in der Krone des Wappens der Stadt Plettenberg, seine Bürger sind der
Tradition verpflichtet, aber auch weltoffen und Neuem gegenüber aufgeschlossen.
Möge aus dem Wissen über die Geschichte des Ortes das Verständnis für die Gegenwart
und das Vertrauen in die Zukunft wachsen.
Horst Hassel
September 1992
PS: Diese Chronik wurde ergänzt im: Dezember 1993, März 1996
»Theodor oppme Kampe de Kubbinchusen«
Die Geschichte des Ortes Köbbinghausen beginnt vermutlich zur Zeit der Franken, also
zwischen 300 und 700 n. Chr.. Zwar sind aus dieser Zeit keine Urkunden bekannt, doch
allein die Endung des Namens auf »inghausen« läßt durch Vergleich mit anderen
Orten mit dieser Endung auf ein hohes Alter der Ortschaft schließen. Namensgeber
wird eine Familie Kubbinchusen gewesen sein.
Die erste urkundliche Erwähnung der Bauerschaft Köbbinghausen findet sich in
einer Fehde-Schadensliste nach 1481. Der allererste Erwähnung des Namens
»Kubbinchusen« findet sich aber schon deutlich früher: im Jahre 1405. Damals
wurde ein »Theodor oppme Kampe de Kubbinchusen« als Nutznießer eines Hofes zu
Frehlinghausen erwähnt.
Freiheit, heute eines der höchsten Güter, ist den Köbbinghauser
Bürgern nichts Unbekanntes. Die Köbbinghauser Güter heben sich dadurch
von den Gütern anderer Ortschaften ab, daß sie schon im 15. Jahrhundert
»Freigüter« waren, also Besitz der Köbbinghauser Bauern waren.
Im Laufe der Geschichte haben Köbbinghauser Bürger immer wieder eine wichtige
Rolle als Vermittler bei Streitigkeiten zwischen abhängigen Bauern des Amtes und
der Stadt Plettenberg und ihren adligen Herren übernommen. Engagiert waren sie
im Kirchenvorstand, spielten auch bei der Einführung der Reformation eine
fördernde Rolle.
Aus der ausschließlich landwirtschaftlich strukturierten ehemaligen Bergbauernschaft ist inzwischen - den Wandel aufzuhalten war weder möglich noch zeitgemäß - eine Ortschaft mit verschiedensten Strukturen wie Wohnen, Arbeiten, Urlaub verleben, Landwirtschaft, Warenproduktion, Pferdezucht usw. geworden. Eines aber hat sich erhalten: die Kleinteiligkeit, die dörfliche Struktur. Hier wurde keine Neubausiedlungen erschlossen, keine Umgehungsstraße gebaut, keine zerstörende oder verfälschende Dorfsanierung durchgeführt.
Wiederbelebt wurde am 2. Juli 1990 die Dorfgemeinschaft wie sie früher traditionell
als »Notnachbarschaft« bestand. Seither ist der Kontakt zwischen den alteingesessenen und
den neuen Bürgern des Dorfes gewachsen, wurden die teilweise schon zerrissenen
sozialen Bindungen neu geknüpft. Dabei sind die Köbbinghauser Bürger
stolz, daß dies ohne Einfluß von außen, also von innen heraus geschah
und auch weiterhin geschehen soll. Nach der Familie soll die Dorfgemeinschaft das
nächstgrößere Band sein, das die Menschen verbindet. Die Beteiligung
am Wettbewerb »Unser Dorf soll schöner werden« ist hier wie ein buntes Band, das
zu den vielen geknüpften Bändern hinzukommt und den Zusammenhalt fördert.
(vorgetragen vom 1. Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft Köbbinghausen, Volker Bischof,
beim Besuch der Bewertungskommission im September 1992 »Unser Dorf soll schöner werden)
Gibt es eine Familie
Woher hat der Ort Köbbinghausen seinen Namen? Eine Antwort auf
diese Frage wurde bis heute noch nicht gefunden. Versuchen wir dennoch, dem Ursprung der
Siedlung auf die Spur zu kommen. Das gelingt zunächst bei einem Vergleich mit Ortsteilen
gleicher Namensendung.
Auf dem Gebiet der Stadt Plettenberg liegen acht Orte, deren Namen mit »inghausen« enden:
Köbbinghausen, Frehlinghausen, Dingeringhausen, Grimminghausen, Hilfringhausen,
Brüninghausen, Eiringhausen, Böddinghausen. Die Orte mit »inghausen« sind
größtenteils Familien-Gründungen und deshalb Dörfer und Weiler.
Demnach stammen die Bezeichnungen mit »inghausen« am Ende alle von Familiennamen ab.
Besonders leicht nachzuvollziehen ist dies bei Eiringhausen. Hier gab es schon - oder
sagen wir besser noch - eine Familie mit Namen »Eyrynckhusen«. Ein Familienname
»Kubbinckhusen« ist bis heute nicht überliefert. Der Name und die Person des
Gründers der Ortschaft Köbbinghausen liegen also im Dunkeln. Auf jeden Fall
kann auf ein hohes Alter der Ortschaft geschlossen werden.
Dienstmannen eines Ritters
Eine weitere Deutung des Ortsnamens Köbbinghausen können wir nach Dr. Friedrich Wilhelm Grimme (Das Sauerland und seine Bewohner, 1928, Sauerland-Verlag Iserlohn) vornehmen. Grimme schreibt u. a.: "Von Ortsnamen, die mit dem einfachen »hausen« enden, wimmelt das Sauerland wie die Provinz Sachsen von solchen auf »leben«. Aber »inghausen«? Ich verfolge diese Spur ruhrabwärts: wiederum im oberen Ruhrgebiete und zu beiden Seiten eine Menge von »inghausen«, doch unterhalb Meschede mehr und mehr aufhörend oder nur sporadisch auftretend, im Lennetale ganz fehlend. Doch was nun weiter? Daß die Spitze des Wortes vor dem »inghausen« allemal ein altdeutscher Rittername ist. Die Silbe »ing« an einen Namen oder auch an ein anderes Wort gehängt, bezeichnet ein Abhängigkeits, ein Hörigkeits- oder Zugehörigkeitsverhältnis. So ist ein »Bischoping«, »Bisping« der Dienstmann eines Bischofs, ein »Abding« der Untergebene eines Abtes, ein »Weding« ein zum Weihtum - »wede« - Gehörender. Geradeso waren die Dudinge, Tietmaringe, Wiemaringe, Wolmaringe, Wiggeringe, Helmaringe usw. die Hörigen, die Dienstmannen eines Ritters oder altsächsischen Freisassen namens Dudo, Tietmar (Ditmar, Dettmar, Theodemar), Wiemar, Wolmar (Woldemar, Volmar, Volmer), Wigger, Helmar usw.. Und diese Hörigen oder Dienstmannen siedelten sich an, bauten sich ihr Haus (ihr »hausen«) um den Haupthof, die »curtis« ihres Herrn, und ein Düdinghausen, Tietmaringhausen, Wiemeringhausen, Wiggeringhausen, Helmeringhausen etc. war fertig. Folgt man dem »Familienkundlichen Wörterbuch« von Fritz Verdenhalven (2. Auflage, Verlag Degener & Co, Neustadt an der Aisch, 1969), dann könnte Köbbinghausen seinen Namen auch auf den Begriff »Köbler« - Kleinbauer - zurückführen. Da dieser Ausdruck aber überwiegend nur im süddeutschen Raum verwendet wurde, ist diese Deutung wenig wahrscheinlich. Die Ortsnamen mit »ing« bezeichnet P. D. Frommann (Geschichte der Stadt Plettenberg, 1927) als altfränkisch. Aus den vielen fränkischen Flur- und Ortsnamen mit »ing« und »scheid« in unserer Heimat ergebe sich, daß unsere Gegend von Franken besiedelt und bewohnt worden ist. Anders als bei Frommann findet Dr. Horst Wientzek (in »600 Jahre Stadt Plettenberg«, 1994) den Ursprung der Ortsnamen mit der Endung »inghausen« in sächsischen Siedlungen. Hierzu ein kleiner Rückblick in die Geschichte unserer Vorfahren: Bis zum Jahre 8 v. Chr. wohnten zwischen Lippe und Sieg die »Sugambrer«. Im letzten Jahrzehnt vor Christi Geburt ist es dann in unserer Gegend zu einer regelrechten Völkerwanderung gekommen. Im Jahre 12 v. Chr. gelang es Tiberius, rd. 40000 Sugambrer zwischen Rhein und Maas anzusiedeln. In die durch die Auswanderung entvölkerten heimischen Gegenden rückten »Marsen« und »Brukterer« ein. Am Ende des ersten christlichen Jahrhunderts hatten die »Angrivarier« (später Engern genannt) ihr Gebiet bis in das Sauerland ausgedehnt. Eine mit ihnen verwandte Völkerschaft, die »Ampsivarier«, soll sich an Lenne und Volme niedergelassen haben. Alle diese Völkerschaften und noch einige andere faßte man seit der Mitte des 3. Jahrhunderts in dem Stammesnamen »FRANKEN« zusammen. Weil die Römer in der Zeit zwischen 100 und 350 n. Chr. die Rheingrenze durch Kastelle und Heere stark befestigten, wurden die Franken zur Seßhaftigkeit, Urbarmachung und Nutzung des Bodens gezwungen. (aus »Beiträge zur Geschichte Plettenbergs« von P. D. Frommann, 1953, S. 4 u. 6). Die Sachsen kommen
Um 693 drangen dann die Sachsen aus ihrer Heimat nördlich der Elbmündung über
die Lippe und über die Briloner Hochfläche in das westliche Sauerland vor
(M. Sönnecken, Heimatchronik des Kreises Lüdenscheid, 1971, S. 28) und
gewannen die Herrschaft über die (Ost-) Franken. Als befestigtes Heerlager
der Sachsen gilt die »Hünenburg« auf dem 375 m hohen Sundern bei Ohle.
Die zur Verteidigung der Hünenburg erfordliche Heerbann-Pflicht und die
ordnungsgemäße Nutzung der Marken machte eine gewisse Verwaltung und
Verwaltungsbezirke notwendig. Weil auch die Bauernschaft Köbbinghausen im
Jauberge mitberechtigt war, so darf man wohl annehmen, daß außer der Gemeinde
Ohle auch die ehemaligen Bauernschaften Eiringhausen, Böddinghausen, Plettenberg,
Holthausen, Bremcke und Köbbinghausen zu diesem Verwaltungsbezirk gehört
haben (ebenda. Frommann, 1953, S. 7).
Karl der Große übernahm dann im Zuge der Sachsenkriege die Herrschaft über
die Franken und gliederte sie in sein Reich ein. Den inneren Aufbau des Landes
organisierte Karl der Große nach fränkischem Vorbild. Er schuf kleine
Verwaltungsbezirke, die Grafschaften. Die Bauernschaft Köbbinghausen gehörte
zur Grafschaft Mark, deren nördlicher Teil »Hellweg« und deren südlicher
Teil »Süderland« genannt wurde.
Köbbinghausen - eine Siedlung aus den acht Höfen (1486) Hans Koninck, Hans
in dem Kamp, Peter to Mettenhus, Pauwes, Mertyn to Kobbinckhusen, Hans ter
Schuren, Hans Hoistatt und Lecks - scheint die Hauptsiedlung des Elsetales
gewesen zu sein. Bereits 1486 sind diese Güter im »Schatboik in Mark« aufgeführt.
Sie sind außerdem auf Grund ihrer Steuereinschätzung als die ertragreichsten
des ganzen ehemaligen Amtes Plettenberg zu erkennen.
So erklärt sich auch die Tatsache, daß bei den vielen vorgekommenen Streitigkeiten
der Amtseingesessenen mit ihrem Drosten die Köbbinghauser meist die Sprecher
bzw. Beauftragten waren, da sie zum Hause Schwarzenberg und den mit diesem
versippten anderen adligen Häusern nicht in Abhängigkeit standen.
Die Köbbinghauser Güter waren um 1700: Schürlemans (Schürmanns)-Gut, Viegen-Gut,
Hesemans-Gut, Haußstadts-Gut, Im Kampe-Gut, Pauls-Gut, Königs- und Haußstadts-
oder Heckermans-Gut und die sogenannte Servas-Kötterei.
|