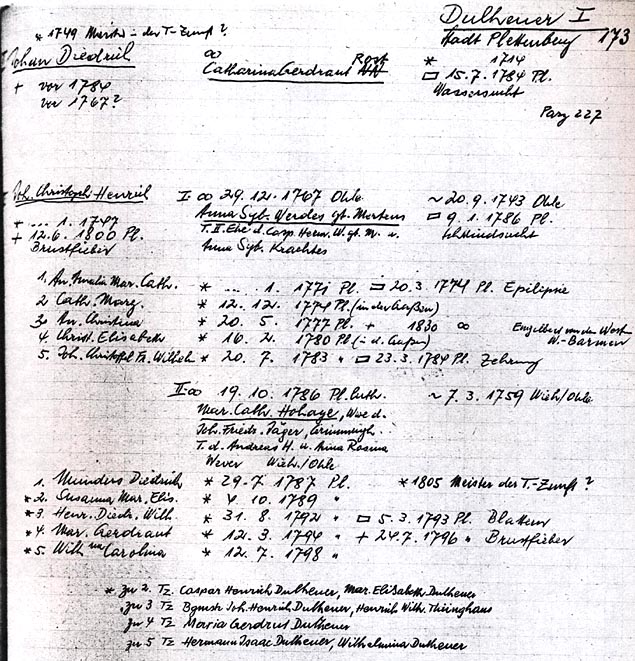|
Das Geschlecht Dulheuer
Quelle: "Wir stammen aus Bauern- und Schmiedegeschlecht", Eberhard Winkhaus, Görlitz 1932, S. 215-229
Plettenberg, in alten Zeiten Heslipho geheißen und eine halbe
Stunde von der Lenne gelegen, nahe der Grenze des Herzogtum
Engern und Westfalen und des Süderlandes, ist der Stammort des
Geschlechtes Dulheuer. Die Grafen von Plettenberg, die dem Orte
den späteren Namen gaben, verkauften ihn mit allen Gerechtsamen
an die Grafen von der Mark, die gegen Ende des 14. Jahrhunderts
[1397] Stadtrechte verliehen.
Hatten vor Zeiten Ackerbau und Viehzucht den Bewohnern Lebensunterhalt
gegeben, so kamen schon vor dem 30-jährigen Kriege Tuchmacher
und Schmiedegewerbe auf, die lohnenden Verdienst abwarfen. Unter
mancherlei widrigen Schicksalen hatte die Stadt sehr zu leiden.
In den Jahren 1599, 1626 und 1636 riß die Pest den größten Teil
der Bürger hinweg. Feindliche Truppen plünderten an den Weihnachtstagen
1632. Französische Truppen ließen in den Jahren 1672 und 1679 die
Einwohner lange Wochen hindurch nicht nur um ihr Eigentum, sondern
auch um ihr Leben bangen. Am 12. April 1725 vernichtete eine
Feuersbrunst den größten Teil der Stadt. Da auch Kirche und Pastorat
abbrannten, so sind uns aus den Jahren vor 1725 nur wenig Nachrichten
über das Geschlecht Dulheuer erhalten.
Während die Familienüberlieferung annahm, dass das Geschlecht aus
dem Bergischen eingewandert und von den preußischen Königen zur
Verpflanzung der bergischen Stahlwarenerzeugung nach Plettenberg
dorthin geholt worden sei, ließ sich mittlerweile eine Akte auffinden,
nach der schon 1621 das Geschlecht Dulheuer in Plettenberg ansässig
war. Eine 1655 geschriebene Urkunde berichtet, dass während des
30-jährigen Krieges [1618-1648] neun Familien der Stadt völlig ausgestorben
seien. Unter den Familien, die vor 1621 und noch 1655 in Plettenberg
wohnten, werden mehrere Familien Dulheuer erwähnt, die mit 56 zehnpflichtigen
Familien abgabepflichtig genannt werden.
Wiederholt wird ein Mundus Rinken, genannt Dulheuer,
in den Akten erwähnt. Ob er eine Tochter Dulheuer geheiratet hatte,
und zu seinem Namen den Namen Dulheuer hinzunahm, oder ob er aus dem
Bergischen eingewandert war, ließ sich bislang nicht klären. Die
Schmiedezunft-Listen von Plettenberg führen ihn als zum Schmiedeamt
berechtigt.
Der Name Dulheuer lässt sich von einer Beschäftigung ableiten. Unter
Dulheuer oder Düllhauer versteht man ein langes, mit einer Dülle
[Tülle] zum Einstecken des Stieles versehenes Messer, den sogenannten
Hauer, der noch heute ein Exportartikel der märkischen Kleineisenindustrie
nach Afrika und Südamerika darstellt. Der Düllhauer kehrt auch im
Wappen des Geschlechtes wieder.
Als Stammvater des Geschlechtes lässt sich Peter Dulheuer nachweisen.
1691 zahlte er 2 Stüber Pacht für ein der Kirche gehörendes Gartenland.
Da der Brand von 1725 alle Akten vernichtete, ist weder seine Gattin
noch das Geburtsdatum seiner Kinder bekannt. Seiner Ehe entsprossen zwei
Söhne:
Sigismund Dulheuer war ebenso wie sein Bruder Schmied. Ihm gehörte
das Haus Nr. 13, das 50 Thaler Wert hatte, während eine nach dem Brande
1725 aufgestellte Taxe Häuservon 25 bis zu 200 Thalern Wert angibt. Von
Sigismund, dessen Frau nicht genannt wird, sind sechs Söhne und eine
Tochter bekannt:
1. Johann Jobst. 1777 wohnte er zusammen mit seinem ältesten Sohn
in dem Hause Nr. 98 zu Plettenberg. In demselben Jahre wird er als
Konsitorial-Presbyter bezeichnet. Seine Gattin Maria Catharina
geb. Brockmann starb 1776 im Alter von 69 Jahren an der Auszehrung.
Ihrem Gatten schenkte sie einen Sohn:
2. Jobst Heinrich wird 1777 gewesener Konsistorial-Presbyter
genannt. 1786 starb er als Witwer. Von seinen Söhnen war Christoph
Friedrich Obervorsteher, während der jüngere Jobst Heinrich
nach Amerika ausgewandert sein soll.
3. Christoph Diedrich war Meister der Tuchmacherzunft, in die
er 1749 aufgenommen worden war. 1777 wohnte seine Witwe im Hause Nr. 110.
Insgesamt werden 193 Häuser aufgeführt. 1793 wurde sie begraben. Ihr
einziger Sohn Hermann Isaak heiratete 1793 Maria Catharina
Böllinghaus aus Plettenberg.
4. Johann Caspar [†13.10.1782] wohnte 1777 im Hause Nr. 97.
Im Alter von 66 Jahren starb er am 13. Oktober 1782. Ein Jahr vorher
war ihm seine Gattin Anna Maria Vollmann im Alter von 59 Jahren
im Tode vorausgegangen. Sein Sohn Johann Henrich heiratete
1792 Anna Johanna Elisabeth Gregori, des Bürgers Johann Gregori
zweite Tochter.
5. Christoph [†13.03.1786] wurde 1738 im 4. Viertel zur Feuerspritze abkommandiert.
In einigen Berichten wird er auch Christoph Eberhard genannt, der 1742
als Ratsherr an die Stelle des Ratsmanns Koch trat. 1757 gehörte er zu
den drei Fuhrknechten, die zusammen mit elf Kollegen aus den Ämtern
Plettenberg, Neuenrade und Herscheid Kriegsfuhren nach Hattingen und
von dort nach Lippstadt zu machen hatten. Jeder erhielt als Reiseentschädigung
9 Reichsthaler. 1777 wohnte er zu Plettenberg im Hause Nr. 21, war
demnach, wie die meisten seiner Brüder, Hausbesitzer. Er war sehr
befreundet mit Johannes Jakob Magnier, einem gewesenen Pastor und
Dekan aus Ligne, der als französischer Emigrant aus der Grafschaft
Artois geflohen und auf seiner Wandering in Plettenberg seßhaft
geworden war. Dort starb er, 78 Jahre alt, im Jahre 1798 im Hause
Nr. 98, das Johann Jobst Dulheuers Sohn Johann Christoph gehörte.
Christoph Eberhard starb am 13. März 1786 als Witwer, 75 Jahre alt,
an Entkräftung. Seine Frau Catharina Elisabeth, mit der er
54 Jahre und 2 Monate verheiratet war, starb am 22. August 1784
im Alter von 72 Jahren. Aus dem Kirchenbuche lässt sich eine Tochter
Susanne Marie feststellen, die 1777 Jobst Henrich Gregori
heiratete. Von ihm stammen vier Töchter ab, die in die Familien
Elhaus, Kämpfer, Klaus und Müller einheirateten. Ein Sohn Mundus
Dulheuer soll in das Bergische ausgewandert sein, wo heute noch
Namensträger leben.
6. Heinrich Bernhard setzte die Geschlechterreihe nachstehend
fort.
Heinrich Bernhard erlernte wie seine Vorfahren das Schmiedehandwerk,
beteiligte sich an Osemundhämmern und wurde Reidemeister. Als solcher
erwarb er sich eine sehr angesehene Stellung. 1736 war er Quartalsmann,
1740 Senator und Ratsherr der Stadt Plettenberg. Ihm war die Lieferung
des gesamten für den Wiederaufbau des Kirchturmes und der Kirche
benötigten Eisens übertragen worden. Während er zuerst nur für die
Kommissionäre Eisen und Stahl angefertigt hatte, begann er schon früh,
durch eigene Reisen nach Hannover, den Rheinlanden und den Niederlanden
den Verkauf nicht nur von Stahl und Eisen, sondern auch von verschiedenen
Werkzeugen aufzunehmen, wodurch er sich schnell ein ansehnliches
Vermögen erwarb. Er soll am 22. Juli 1758 gestorben sein, wird aber
in einer Urkunde von 1741 schon als "verstorbener Ratsherr" gemeldet.
1728 hatte er Anna Catharina Lambertsmann geheiratet, †21.
April 1791 im Alter von 81 Jahren an Altersschwäche. Aus seiner Ehe
stammen zwei Söhne:
1. Johann Christoph, 1729-1785, wird nachstehend aufgeführt.
Johann Christoph, *20. Oktober 1729 †15. März 1782, übernahm die Hämmer
seines Vaters. Er scheint sich als Reidemeister nicht mit der
Fortführung der väterlichen Geschäfte begnügt, sondern an verschiedenen
Hammerwerken beteiligt zu haben. Als Iserlohner Kaufleute in der
Plettenberger Gegend auf Blei schürften, beteiligte er sich an
dem Konsortium, das in den Berg an der Wormel Stollen und Schächte
treiben ließ. 1756 übernahm er dieses Bergwerk auf eigene Rechnung,
wurde am 15. Mai 1758 damit belehnt und ließ dann vier Maaßen und
eine Fundgrube ausbeuten. Der Schacht war 9 1/2 Lachter tief und
dann 8 Lachter gegen Nordwest ausgebaut, wo vor Ort 3 Zoll mächtige
Bleiadern hervorbrachen, umgeben von 1 1/2 Fuß Poch-Erz. Man musste
den Schacht später noch 3 Lachter tief bis auf den Stollen abbauen,
doch ließ dann die Ergiebigkeit nach, so dass das Bergwerk nach
einigen Jahren stillgelegt werden musste.
Am 12. Oktober 1755 heiratete er Clara Anna Catharina Wolff,
*4. Oktober 1730 zu Plettenberg als Tochter von Johann Christian
Wolff, 1689-1785, und Catharina Elisabeth Pauli, 1697-1769. In der
bis 1500 zurückverfolgbaren Familie Pauli hatte Daniel Pauli, Doctor
juris zu Lübeck, ein Familienstipendium von 5000 Rthlrn. festgelegt,
aus dessen Zinsen junge Familienmitglieder Studienzuschüsse erhalten
sollten, ohne dass irgendwelche Beschränkungen über Dauer und Art
des Studiums auferlegt waren. Von der Familie Pauli kam über die
Familie Wolff die Nutznießung dieser Stiftung auch an die Familie
Dulheuer. Johann Christoph starb am 15. März 1782. Seine Witwe
verschied am 15. April 1790 am Schlage. Von den beiden Kindern
dieser Ehe wird
1, Johann Heinrich Dietrich nachstehend aufgeführt.
Johann Heinrich Dietrich, *1. Juli 1756 Plettenberg, verließ,
wohl durch den Einfluss seiner Mutter, den Beruf seiner Vorfahren.
Er kam auf das Gymnasium zu Soest, wo er als einer der ersten das
von dem Minister Wöllner unter Friedrich Wilhelm II. eingeführte
Abiturienten-Examen bestand.
(wird fortgesetzt) |