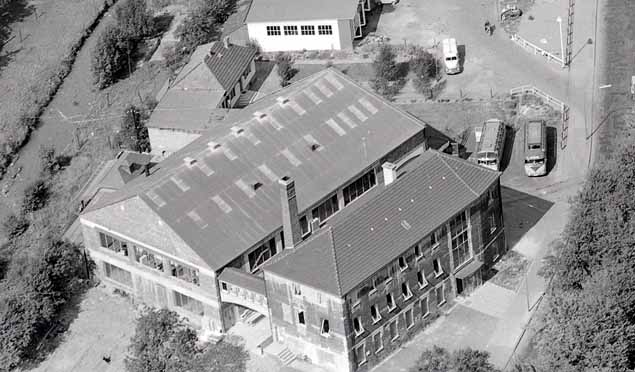|
Quelle: Süderländer Tageblatt, 1990
D. W. Schulte - ein Familienunternehmen
Zur Zeit, da unsere alte Stadt durch verheerenden Brand unterging - am 12. April 1725 -,
lebte Johann Georg Schulte als Bauer auf dem Bärenberg, jenseits von Bracht
und Schwarzenberg, wie schon Generationen vor ihm. Sein Sohn Joh. Heinrich
Eberhard Schulte hielt noch an der väterlichen Scholle fest, während drunten
am Zusammenfluß von Else, Oester und Grüne die Stadt der Sensen- und Nagelschmiede,
namentlich aber der Tuchmacher neu erstand.
Erst der Enkel Jobst Heinrich Schulte wurde Bürger der von Wall, Graben und
Ringmauer befreiten Stadt. In der Grünestraße, vor dem damals noch erhaltenen
Tore nahe dem Wieden, wirkte er als Drechsler und Spinnradmacher. Seine Frau,
Elisabeth Hanebeck, schenkte ihm von 1792 bis 1802 drei Töchter und drei
Söhne, darunter Diederich Wilhelm Schulte, geb. Plettenberg 1797, gestorben
Plettenberg 1869.
Diederich Wilhelms Jugend fällt in die Jahrzehnte napoleonischer Umwälzungen
und späterer Neuordnung Europas, aber auch grosser Entdeckungen und Entwicklungen.
Zunächst davon wenig berührt, folgt er dem väterlichen Drechslergewerbe, auf
die heimische Tuchmacherei eingestellt. Diese allerdings - handbetrieben -
geht nach Einführung maschineller Webstühle vor allem in England mehr und mehr
ihrem Ende entgegen.
Vorausschauend findet Diedrich Wilhelm den Entschluss zur Umstellung von Holz
auf Eisen, vom handwerklichen zum Fabrik-Betrieb. Mit schon 43 Jahren wird er
1840 zum Gründer der heutigen Firma seines Namens, der er seine Schaffenskraft
noch 29 Jahre widmen kann. Drahtverarbeitung stellt er sich zur Aufgabe.
Aller Anfang ist schwer. Die Erzeugung von Nägeln kann auf Dauer nicht befriedigen.
Grundlegende Neuerungen im Klavierbau, für den sich Bruder Caspar Heinrich
Schulte entschließt, werden auch für Diederich Wilhelm entscheidend. So
entsteht die Fabrikation von Klavierstiften - Stimmnägeln - , die nun über
ein halbes Jahrhundert den Ruf der Firma begründen.
Im Aufbau erfreut sich Diederich Wilhelm der starken Mithilfe seines 1823
geborenen, fortschrittlichen, zielbewußten Sohnes Heinrich Wilhelm. Eine
größere Fabrik wird 1864 an der unteren Grünestraße errichtet, eine der
ersten am Ort mit Dampfantrieb. Sie ist des Firmengründers letzte schöpferische
Tat.
Im Jahre 1869 tritt Heinrich Wilhelm Schulte das väterliche Erbe an - 46 Jahre
alt. Weitere Absatzförderung scheint ihm erste Aufgabe, nachdem der Krieg von
1870/71 der Firma kaum Störungen gebracht hat. Am allgemeinen wirtschaftlichen
Aufschwung der späten 70er Jahre nimmt D. W. Schulte vollen Anteil. Unter
ständigen Verbesserungen finden die Stimmnägel Marke "Adler" der Grünestraße
Eingang bei fast allen deutschen Klavierfabriken. Große, ständige Aufträge
kommen aus Amerika. Unter den deutschen Stimmnägel-Fabrikanten, die sich um
Plettenberg herum zusammenfinden, rückt D. W. Schulte mit an erste Stelle.
Heinrich Wilhelm hat das biblische Alter bereits überschritten, als ihn neue
Anregungen zur Errichtung eines Hammerwerkes für landwirtschaftliche Geräte
bestimmen. Es wird 1895 an der oberen Grünestraße gebaut. Beide Söhne, Otto
und Max, jetzt erwachsen, finden so ihren besonderen Wirkungskreis in der
väterlichen Firma.
Die Stimmnägelfabrik erhält elektrischen Antrieb, neuerdings an die
Überlandzentrale "Mark" angeschlossen. Das Hammerwerk wird bald zur
Gesenkschmiede. Um die Jahrhundertwende erreicht die Firma einen ihrer
Höhepunkte.
Heinrich Wilhelm sieht erst 1903, mit 80 Jahren, sein Lebenswerk abgeschlossen
und gesichert. Das schöne Haus in klassizistischem Stil am Wieden, 1878
errichtet, wird sein Ruhesitz für die letzten vier sorgenfreien Jahre. Was
die Söhne nun leiteten, wird 1903 ihr Eigentum. Das erfolgreiche Hammerwerk
fällt nach Ottos frühem Tode in andere Hand. Die Tradition der Firma bleibt
bei der Stimmnägelfabrik, dem jüngeren Bruder. Max Schulte ist erst 28 Jahre,
als er 1903 die Firma übernimmt. Vor ihm liegen - ungeahnt - 46 wechselvolle,
schwere Jahre.
Klaviere sind in aller Welt gefragt, nicht zuletzt deutsche. Die Stimmnägel
aus der Grünestraße nehmen unbeirrt ihren Weg. Die Londoner Vertretung wird
bedeutend. Auf technischem Gebiet wird die bisherige Handarbeit weitgehend
durch Automaten ersetzt, die der eigene Betriebs konstruiert und baut. Zur
Sicherstellung einwandfreien Vormaterials baut Max im Oestertal (hinter dem
Hirtenböhl), nun erschlossen von der Plettenberger Kleinbahn, im Jahre 1907
eine eigene Drahtzieherei.
In der Bukovina (Rumänien), dem Lande bester Resonanzhölzer, werden Waldbesitz
und eine Sägemühle erworben. Im Plettenberger Stammwerk entsteht eine
zusätzliche Herstellung von Druckstäben und anderem Klavierbedarf. Alles ist in
glücklichem Werden, als 1909 an einem schönen Pfingsstag die Stimmnägelfabrik
in ihren Hauptteilen niederbrennt. Es gelingt aber, die Fabrikation Anfang
1910 in vergrößertem Bau mit elektrischem Antrieb wieder aufzunehmen. Das
Bukovina-Unternehmen wird liquidiert, weil geeignete Kräfte des Landes fehlen.
Neue Aussichten aber bietet Max die Übernahme der Europavertretung für Galalith,
einen Tastenbelag aus Kunststoff als Ersatz für Elfenbein. Getragen von einer
treuen, heimischen Arbeiterschaft und tüchtigen Angestellten treibt alles
nach oben. Dann kommt 1914 der I. Weltkrieg, der zunächst alles Erreichte
lahmlegt. Max, in der Tatkraft seiner 39 Jahre, stellt nach Berliner Anregung
auf Heeresbedarf um.
In der früher so oft freudeerfüllten Schützenhalle im Wieden lebt noch einmal
das frühe Gewerbe des Firmengründers auf: Die Truppe, noch auf das gute Pferd
angewiesen, braucht Deichseln und anderes Holzwerk. Halle und Einrichtung
gehen 1917 in Flammen unter.
Die Drahtzieherei in der Oester in Verbindung mit Drahthandel wird auf Jahre
hinaus zum Rückhalt der Firma, als die Fronten erstarren. Zunehmender Mangel
an Blei führt schließlich zur Kaltherstellung von Geschosskugeln aus Eisendraht
auf Spezialpressen - eine grundsätzlich neue Fabrikationsmethode. In vielem
geschädigt, geht die Firma doch gekräftigt aus dem I. Weltkrieg hervor. Die
Rückschaltung auf Friedensbetrieb stellt dennoch Max Schulte vor schwere
Entschlüsse. Die erst vor kurzem ausgebaute Stimmnägelfabrik bietet keine
rechten Aussichten mehr. In ihren Räumen werden Restbestände an Holz und
Galalith, jener neuartigen Kunstmasse in Platten und Stäben, aufgearbeitet
zu bunten Perlen - primitivem Schmuck jener armen Zeit.
Die Drahtzieherei geht schleppend weiter, ausgebaut auf Feinzug und Galvanisierung
in zwei Nebenbetrieben. In aller Stille aber reifen größere Pläne auf lange
Sicht. In der Erzeugung von Kunstmasse und Kaltverarbeitung von Draht sieht
Max Schulte eine neue Zukunft der Firma. Hierfür aber scheint Plettenberg zu
eng und zu entlegen. Im Raume zwischen Düsseldorf und Neuss, nahe dem Wegekreuz
Handweiser, werden 120 Morgen Land erworben unter Zupachtung des Gutshofes
Zoppenbroich. Schon 1921 läuft die Kunsthornfabrik Zoppenbroich an, nachdem
die Internationale Galalith-Gesellschaft nicht mehr liefert. Es gelingt bald,
ein Galalith ähnliches Produkt herauszubringen, in Platten und Stäben,
vielfach getönt und gemasert, täuschend ähnlich auch dem teuren Schildpatt,
Elfenbein und Bernstein. Ein Teil der Herstellung wird im eigenen Betrieb zu
Kämmen, Knöpfen und Perlen verarbeitet.
Bei günstiger Entwicklung, auch des Verkaufs, bleibt Zoppenbroich doch für
die Firma nebensächlich - ein Versuch im Uranfang der Kunststoff-Industrie
überhaupt. Das chemische Verfahren der Großindustrie erweist sich bald als
überlegen - Zoppenbroich wird geschlossen.
Für die Kaltverarbeitung von Eisen hat Max inzwischen auch führende Persönlichkeiten
der Eisenhütten-Industrie interessieren können. Am Handweiser entsteht 1921/22
eine großzügige Werksanlage. Mit der Erzeugung von Nieten kann auf den
Plettenberger Kugelpressen bald begonnen werden. Holland ist frachtgünstigster
Hauptabnehmer. Die Herstellung auch von Schrauben und Muttern aber verzögert
sich über Fragen der Maschinenkonstruktion und Werkstoffe. Die Verwaltung
arbeitet nach neuesten amerikanischen Methoden.
Bei dieser Lage treibt die Inflation 1923 von Stunde zu Stunde ihrem Höhepunkt
zu. Wer nur eine alte Mark wertbeständig schuldete, musste eine Billion Mark
in Papier zahlen. Markguthaben wurden über Nacht wertlos. Im wirtschaftlichen
Zusammenbruch der Zeit geht schließlich der in 83 Jahren erarbeitete Familienbesitz
an einen Konzern verloren. Der Firma D. W. Schulte bleibt nur ein Labor in
Plettenberg - und Max Schulte, jetzt 48jährig, aber mit ungebrochenem Unternehmergeist
- trotz allem. Wieder steht man vor einem Neuanfang.
Noch 1923 wird die weitere Geldentwertung durch Schaffung der Rentenmark
abgefangen. Mit der neuen Reichsmark-Währung vom August 1924 ist endlich die
Grundlage zur Neuordnung der Wirtschaft gegeben. Aber erst 1929 stehen
ausreichende Mittel zur Verfügung, um die Firma in den Produktionsprozess
wieder einzuschalten. Die alten Gebiete wieder aufzugreifen, scheint nach
der Unterbrechung wenig aussichtsvoll. Im besonderen sind andere Werke, die
den Gedanken der Kaltherstellung von Nieten, Schrauben und Muttern übernahmen,
jetzt praktisch weit voraus.
Stark interessiert dagegen nun die neuzeitliche Entwicklung im Bau von Industrie-Öfen
mit erhöhter Wirtschaftlichkeit. Es geht unter anderem darum, für deren keramische
Auskleidung die besten Qualitäten zu finden und das Mauerwerk mit vielen Fugen
durch kompakte, monolithische Stampfungen zu ersetzen. Es geht letzten Endes
um feuerfeste Stampfmasse!
Das Gebiet ist Max Schulte nicht ganz neu. Bereits 1920 befaßte man sich mit
einer Granitmasse "Lavalith", zu deren praktischer Erprobung es nicht mehr
kam. Andere Stampfmassen fanden in der Industrie auch schon weitgehende
Verbreitung zu Nebenzwecken. Es fehlte noch die Spitzenqualität.
Die Versuche begannen im verbliebenen Labor, das sich zum Kleinbetrieb
entfaltet. Wilhelm Schulte, jetzt erwachsen, greift ein, Fachkräfte können
gewonnen werden. Verschiedene Grund- und Zuschlagsstoffe werden erprobt. Es
ist schwer, die verschiedenen Anforderungen eines Ofenbetriebes in einer
Masse gleichzeitig zu berücksichtigen.
1935 kann aber die Stampfmasse "Dewesit" - an den Gründer der Firma vor 95
Jahren erinnernd - dem Markt übergeben werden. Unter großer Konkurrenz findet
sie viel Beachtung als Flickmasse, dann für Brenner. Schon beginnt man, ganze
Ofenräume in Dewesit zu stampfen bzw. auszukleiden. Viele große, kritische
Werke werden zu überzeugten Dewesit-Verbrauchern.
Auch im II. Weltkrieg steigen die Umsätze, auch Österreich und Ungarn sind
beteiligt. Der Krieg zeigt erst recht die Abhängigkeit durchgehender
Produktion von der Güte der Öfen. Der Betrieb bleibt von Zerstörungen verschont, steht auch nicht
auf der Demontageliste, obwohl für die ehemaligen Feindmächte interessant,
wie man weiß. Aber es fehlt der zerschlagenen Industrie nun an Bedarf. Zudem
droht eine vernichtende Währungsreform.
Der 20. Juni 1948 stellt die Reichsmark (RM) sehr verlustreich auf Deutsche
Mark (DM) um. Es wird dennoch zum neuen Start, auch für D. W. Schulte und
"Dewesit". Nochmals ist Max Schulte die große Triebkraft zu neuer Blüte
seiner Firma unter jetzt völlig veränderten Verhältnissen der einschlägigen
Industrie. Es gilt, Rohstoffe zu finden, neue Mitarbeiter einzustellen, sich
den letzten wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen, neues Vertrauen zu
gewinnen und vieles mehr. Wilhelm, sein Sohn, kehrt aus dem Krieg zurück zu
erneuter Hilfe. Mitten im Ablauf der Dinge aber ist dem Leben und vielseitigen
Wirken des Vaters ein Ende gesetzt. Max Schulte stirbt in Plettenberg am
19. Oktober 1949 im 75. Lebensjahr, ohne sich Ruhe gegönnt zu haben.
So gehen also 1949 Eigentum und Leitung der Firma auf Wilhelm Schulte über,
der 41jährig ist. Kurz darauf bringt die Erholung der Industrie die
Umsatzsteigerung, die des Vaters letzte Sorge war.
Dennoch sollte das Arbeitsgebiet der Firma beschränkt bleiben auf Walzwerke
sowie Preßwerke und Schmieden; in deren Öfen wiederum auf die Bereiche mit
höchsten Temperaturen - desto größere Erfahrung wird man den Kunden bieten
können. Das Labor erhält eine erstklassige, wissenschaftliche Ausstattung
zur Untersuchung und Erprobung von Rohstoffen und Massen.
Ein Stamm tüchtiger Monteure wird herangebildet, der die Bezieherwerke
jeglicher Zustellungssorgen enthebt. Für Trocknung und Sinterung von
Stampfungen werden neue Methoden gefunden, die jede Gefahr für fertige
Stampfungen ausschließen. Für besondere mechanische oder chemische Beanspruchung
werden Spezialmassen gefunden, die einen noch längeren Stand von Wänden und
Herden gewährleisten. Für Flächenstampfungen kommt ein neues Verfahren zur
Anwendung, das die Arbeitszeit verkürzt und das Gefüge verbessert.
"Dewesit"-Schienensteine sind stark gefragt bei höchster Abriebfestigkeit und
entsprechender Ofenführung. Man ergründet zunehmend Wechselbeziehungen zwischen
Konstruktion und feuerfesten Stampfungen unter Hochtemperaturen. Ein technisches
Büro wird gebildet, alle Erfahrungen und Erkenntnisse zu Vorschlägen und
Offerten verarbeitet. Durch unbegrenzten Kundendienst werden ausgeführte
Stampfungen laufend überwacht.
In Zusammenarbeit mit Ofenbaugesellschaften und der Industrie gewinnt DEWESIT
mehr und mehr Bedeutung für deren große Neuanlagen, aber auch kleinste Objekte.
Die Inlandskurve des DEWESIT-Umsatzes steigt seit 1949 unentwegt. Dazu kommen
Holland, die Schweiz, Italien und Österreich als beachtliche Abnehmer. Auch
in Übersee ist DEWESIT bewährt.
Die Enge des bisherigen Betriebes führt 1958 zum Umzug in einen geräumigen
Fabrik-Neubau der Firma, verkehrsgünstig gelegen am Nordausgang der Stadt
(Bahnhofstraße). Modernste Einrichtungen und hohe Vorräte an Rohstoffen
ermöglichen die Abfertigung jeglicher Aufträge in kürzester Zeit. Für die
Güte aber zeichnet die über 120 Jahre alte Firma, gestützt von einem treuen,
zuverlässigen Stab ihrer Plettenberger Mitarbeiter.
Vieles hat D. W. Schulte im Laufe der Zeit überwinden müssen und erreicht.
Mit Vertrauen und Entschlossenheit sieht die Firma auch der Zukunft entgegen.
Quelle: Aus Texten zu einer Firmenchronik zum 150jährigen Bestehen
der Firma D. W. Schulte im Jahre 1990; nachgezeichnet durch Horst Hassel.
Quelle: Plettenberg - Industriestadt im märkischen Sauerland, 1972, Verlag P. A. Santz, S. 222 u.223, 5 Fotos
D. W. Schulte Plettenberg - DEWESIT
Von alter Bergbauernfamilie abstammend, ließen sich die Vorfahren des Firmengründers schon frühzeitig
am Ende des 18. Jahrhunderts als selbständige Handwerker und Bürger in Plettenberg nieder.
Dietrich-Wilhelm Schulte, gelernter Drechsler und Spinnradmacher, nahm, angeregt durch seinen Vetter,
einen Instrumentenbauer zu Köln, im Jahre 1840 die industrielle Fertigung von Stimmnägeln und
Schrauben auf. Das Unternehmen gedieh. Fortschrittlich wurden im Laufe der Jahre unter den Nachfolgern
weitere Fertigungszweige angegliedert; Freiform- und Gesenkschmiede - das heutige Hammerwerk Schulte
- Drahtziehereien, Nieten- und Schraubenwerke und zusätzlich eine der ersten Kunststoff-Fabrikationen
auf organischer und mineralischer Basis. Die Krisen der 20er Jahre und die Interessengemeinschaft mit
einem Großunternehmen endeten unglücklich und führten zum Zusammenbruch des weitverzweigten
Unternehmens.
Max Schulte, der Vater des jetzigen Inhabers, begann den Wiederaufbau interessanter Weise nicht im
Bereich der bisherigen, hauptsächlichen Erzeugung, sondern in chemisch-mineralogischer Richtung,
und das mit einigem Erfolg.
Dieses Unternehmen, das nach dem Tode von Max Schulte im Jahre 1948, nunmehr in 4. Generation,
von seinem Sohn Wilhelm Schulte geführt wird, gab Anregungen, die zur Entwicklung einer, man kann
sagen neuartigen, modernen feuerfesten Industrie führten. Es wurden hier Methoden, neuartige Verfahren
und Baustoffe konzipiert, auf die der moderne Industrieofenbau heute nicht mehr verzichten könnten.
Im Kreise dieser speziellen Industrie und den Stahl erzeugenden und verarbeitenden Abnehmern hat
der Markenname "DEWESIT" einen führenden Ruf.
Für Forschung und Konstruktion, ein gerade für diese Branche unabdingbarer Zweig der Fertigung,
stehen modernste Einrichtungen zur Verfügung; für technische und kaufmännische Planung und
Abwicklung eine EDV-Anlage.
Das Unternehmen kann nach wie vor, trotz der manchmal prekären Lage der hauptsächlich abnehmenden
Stahlindustrie, mit Hoffnung und Vertrauen in die Zukunft blicken.
|