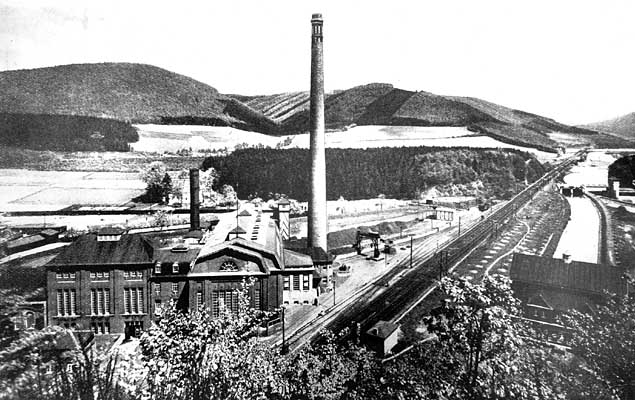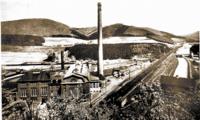|
Quelle: ST vom Mai 1949
Das Elektrizitätswerk Siesel im Abbruch
Plettenberg-Siesel. Weit sichtbar ragt der fast 90 Meter hohe Schornstein
des Elektr.-Kraftwerkes Siesel ins Land, dort in der Lenneschleife unterm
Schwarzenberg an einer der so besonders romantischen Stellen des Lennetales.
Aber er raucht nicht mehr - und wird auch nicht mehr rauchen; es wird
abgebrochen auf dem Siesel.
Das begann schon 1933, als das Peroxydwerk trotz heftiger Gegenbemühungen
aus betriebwirtschaftlichen Gründen aufgegeben und nach Hönningen a/Rhein
verlegt wurde. Das Werk wurde abgebrochen. Damals verlor Elektro-Mark einen
seiner größten Konsumenten, der stündlich bei 3000 kw verbraucht hatte.
(Zum Vergleich: das Plettenberger Stadtgebiet benötigt stündlich etwa
5000 kw) Damals wurden die Abbruchziegel von den Kleinsiedlern abgeholt
und verbaut, und so ist es heute wieder. Diesmal aber ist der Abbruch eine
unmittelbare Folge von Kriegszerstörung.
Es war am Morgen des 19. März 1945, kurz vor Kriegsende. Bis dahin war es
gut gegangen, wie überhaupt die großen Werke des Komm.-Elektr.-Werkes "Mark"
durch Bombenangriffe nicht in Mitleidenschaft gezogn worden waren. An jenem
Schicksalsmorgen kreisten wieder einmal feindliche Flieger. Das WerK Siesel
wäre vielleicht auch diesesmal ungeschoren geblieben, aber da war ein Zug
auf der Strecke, der den Tunnel in Richtung Eiringhausen bereits passiert
hatte, dann aber zurücksetzte in den Sieseler Tunnel, um dort sicher zu sein.
Dieser Umstand, dass ein von Fliegern sicherlich bereits ausgemachter
Eisenbahnzug plötzlich verschwunden war, machte die Flieger wohl besonders
aufmerksam. Nun hatte der Güterzug in dem nur 95 Meter langen Sieseler Tunnel
keine volle Deckung gefunden. Es langte nicht ganz. Am Kraftwerk Siesel, das
bekanntlich unmittelbar am Tunnelausgang nach Süden liegt, sah der "Schwanz"
des Zuges heraus und am anderen Ende gegen Leinschede zu die Lok.
Die feindlichen Flieger griffen an und nahmen sich die Zugenden beiderseits
zum Ziel. Sie schossen die Lokomotive leck und strichen die Schlußwagen mit
Bordwaffen ab. Dann, einmal im Zuge, warfen sie 12 Bomben, vielleicht waren
Zug und Tunnel gemeint, jedenfalls bekam das Kraftwerk dabei einige Treffer
ab, und die gegenüberliegende Gastwirtschaft und das Haus Schröder wurden
beschädigt. Zwei Bomben gingen im Umspannwerk nieder, wo allerdings nur
Kabelschaden entstand, aber immerhin die Stromführung unterbrochen wurde.
Zwei Bomben trafen das Dampfkraftwerk, die eine war ein Ausbläser, die andere
aber versetzte die Fundamente der Dampfturbinen und brach die Säulen der
Halle, wodurch die Anlage betriebsunfähig wurde. Menschen kamen wie durch
ein Wunder nicht zu Schaden. Aber der materielle Schaden war groß.
Dennoch ist überlegt worden, ob die Anlage nicht erhalten werden könne. Die
Wasserkraftmaschinen selbst waren nicht beschädigt. Durch einen Bombentrichter
war jedoch die Kühlwasserleitung derart angeschlagen, dass Lennewasser ins
Wassermaschinenhaus eindrang, so dass die Anlage ersoff. Die notwendigen
Arbeiten mussten in jenen Tagen aus erklärlichen Gründen unterbleiben -
wenngleich der Betriebsleiter, Herr Kolter, mit seinen Leuten nach Kräften
versuchte, zu retten, was zu retten war.
In Folge der eingetretenen Schäden bestand bei einer Wiederinbetriebnahme
Gefahr für die Sicherheit des Betriebes. So kam man zu dem Beschluss, den
Betrieb am Siesel auf das Umspannwerk und den erhalten gebliebenen Teil der
Wasserkraftanlage - die neuer Anlage - einzuschränken, zumal die die
Wasserkraft liefernde Lenne nur in den Wintermonaten von Oktober bis
allenfalls Januar ausreichend Wasser für die bisherige Gesamtanlage
liefern konnte.
Im ganzen gesehen war das Sieseler Lennewerk, in dem einmal die ersten
modernen Dampfturbinen der Elektromark überhaupt aufgestellt wurden,
technisch nicht so fortentwickelt und modernisiert worden, dass daraus
für die Weiterführung schwerwiegende Gründe hätten geltend gemacht werden
können. Die Zerstörung der Ufermauern unterhalb des Werkes ist im übrigen
keine Kriegsfolge, sie ist vielmehr durch verschiedene schwere Hochwasser
herbeigeführt worden. Die Betonmauer wird dort jetzt wieder instandgesetzt
und dabei das Lennetal geräumt.
Der Abbau unseres Lennewerkes begann also. Die noch intakten Einrichtungen
wurden ausgebaut. Die Kessel wanderten zu Seifenfabriken und Zechen nach
Bayern. Die völlig zerstörten Gebäudeteile wurden abgeräumt und das
Material verkauft. Erhalten geblieben sind das Fundament des Dampfmaschinenhauses
bis zur Fensterhöhe, das Kesselhaus, Pumpenhaus und das Bürogebäude.
Außerdem der Schornstein, der nun endgültig "ohne Arbeit" ist. Umwerfen
kann man ihn nicht, wegen der naheliegenden Umspannstation und der Reichsbahn.
Ein Abbau von oben aber ist zu kostspielig. So wird er halt stehen bleiben
als Wahrzeichen einer vergangenen Zeit. Was aber wird mit den an sich noch
verwendbaren Gebäuden, mit der hohen, so schmucken Halle? Man hat von
Verhandlungen gehört mit Industriewerken. Aber die Verwendbarkeit ist
schwierig und vielleicht spielen Steuerlast und etwaige Belastung aus dem
Lastenausgleich ihre Rolle. So bleibt die Frage der Verwendung offen.
Die Tradition des Werkes wird weitergeführt durch das Umspannwerk, das den
5000 Volt-Strom nach Finnentrop (Mannesmann) weiterleitet und den Strom für
die Plettenberger Industrie auf 10.000 Volt transformiert. Diese Anlage
wird in Zukunft modernisiert werden. Das noch bestehen bleibende neue
Wasserkraftwerk mit drei Turbinen erzeugt etwa 1600 bis 18000 kw stündlich.
Seine Kapazität reicht eben hin, um beispielsweise den Nachtstrom für
Plettenberg sicher zu stellen. Das fortan in Wegfall kommende zerstörte
Dampfkraftwerk hatte mit den übrigen Betriebsanlagen als Spitzenkraftwerk
mit 5-6.000 kw die Aufgabe, bei Höchstanforderungen zusätzlich auszugleichen.
Die beschränkte Leistungsfähigkeit der zwei Dampfturbinen mit einer Leistung
bis zu 6.000 kw, zeigt ein Vergleich mit dem weit leistungsfähigeren
Schwesternwerk Elverlingsen, wo eine einzige Dampfturbine es auf eine
Leistung von 25.000 kw bringt. Mit dem Abbau des Lennewerkes kommt eine
Stromerzeugungsanlage an dieser Stelle teilweise zum Erliegen, deren erste
Anfänge auf die 1890er Jahre zurückgehen. Damals (1896) errichtete die
Firma Brüninghaus, Werdohl, hier die erste Anlage, die dann 1914/15 vom
Kom.-Elektr.-Werk "Mark" übernommen wurde. Die Lenne wurde bereits beim
Bau der Eisenbahnstrecke verlegt. Sie erhielt ein ganz neues Bett. Das
alte, bis an die Reichsstraße an der Wibbecke herantretende Urflußbett,
die Altlenne, führt heute mit dem angrenzenden botanisch interessanten
Waldgelände am Stessel das beschauliche Dasein eines Naturschutzgebietes
(so weit es die Straßenverwaltung nich nach und nach zuschüttet!). Das
durch ein riesiges Walzenwehr gestaute Flußwasser wird von den Turbinen
im übrigen in einen unterirdischen Untergraben abgegeben, der, dem Tunnel
folgend, an der Eisenbahnbrücke gegenüber dem Sohn in die Lenne einmündet.
Die einstige Kapazität des Werkes war bestimmt durch die Leistung der
schwer getroffenen Dampfkraftanlage, die beispielsweise 1943 bei 7,5 Millionen
kw erzeugte, während die alten, ebenfalls beschädigten Wasserkraftanlage
mit rund 500.000 kw im gleichen Jahre weiter dahinter zurück blieb. Die
neue und erhalten gebliebene Wasserkraftanlage konnte es in dem allerdings
wasserreichen Jahr 1948 auf rd. 6.300.000 kw bringen. Der Ausfall dieses
Betriebes bzw. seine Verringerung stellt im Grunde - so bedauerlich in
verschiedener Hinsicht diese Einschränkung für unsere Stadtgemeinde ist -
nur eine Verlagerung dar. Das Werk Elverlingsen wird bekanntlich um so
moderner und größer ausgebaut. Auch in menschlicher Hinsicht sind die
Auswirkungen erfreulicher Weise nich tiefgreifend. Von den früher in Siesel
beschäftigten 30-35 Angestellten und Arbeitern werden wohl künftig nur
ca. 15 Mann beschäftigt sein. Aber manche sind inzwischen pensioniert,
und die übrigen werden bei der Betriebsabteilung Eiringhausen beschäftigt.
Die schön gelegene Werkssiedlung auf der Höhe des Bergvorstoßes in der
Lenneschleife liegt ja auch nicht all zu weit von den nahen Arbeitsplätzen
in Eiringhausen. So ist auch in dieser Hinsicht kein Problem entstanden.
Aber immerhin bleibt die als unmittelbare Kriegsfolge eintretende
Betriebseinschränkung örtlich ein gewisser Rückschlag, der natürlich
das örtliche Leben am Siesel in Mitleidenschaft ziehen muss.
Quelle: WR Plettenberg vom 30.03.2005
Vor 60 Jahren: Bomben auf das Kraftwerk
Von Horst Hassel
Plettenberg. Es war am Morgen des 19. März 1945, kurz vor Kriegsende. An jenem Schicksalsmorgen kreisten wieder einmal feindliche Flieger über dem Siesel.
Dort war ein Zug auf der Strecke, der den Sieseler Tunnel in Richtung Eiringhausen bereits passiert hatte, dann aber zurücksetzte und im Tunnel Schutz suchte.
Der folgende Luftangriff aber besiegelte nicht das Ende des Zuges, sondern das des Dampfkraftwerkes der Elektromark in Siesel. Der Umstand, dass ein bereits entdeckter Eisenbahnzug plötzlich verschwunden war, machte die Flieger wohl besonders aufmerksam.
Nun hatte der Güterzug in dem nur 95 Meter langen Sieseler Tunnel keine volle Deckung gefunden. Es langte nicht ganz. Am Kraftwerk Siesel, das bekanntlich unmittelbar am Tunnelausgang nach Süden liegt, sah das Ende des Zuges heraus und auf der anderen Seite die Lok.
Die feindlichen Flieger griffen an und nahmen die beiden Zugenden ins Visier. Sie schossen die Lokomotive leck und strichen die Schlußwagen mit Bordwaffen ab. Dann warfen sie 12 Bomben, vielleicht waren Zug und Tunnel gemeint, jedenfalls bekam das Kraftwerk dabei einige Treffer ab, und die gegenüberliegende Gastwirtschaft und das Haus Schröder wurden beschädigt.Zwei Bomben gingen im Umspannwerk nieder, wo allerdings nur Kabelschaden entstand, aber immerhin die Stromführung unterbrochen wurde. Zwei Bomben trafen das Dampfkraftwerk, die eine war ein "Ausbläser", die andere aber versetzte die Fundamente der Dampfturbinen und brach die Säulen der Halle, wodurch die Anlage betriebsunfähig wurde. Menschen kamen wie durch ein Wunder nicht zu Schaden. Aber der Schaden war groß. Die Wasserkraftmaschinen selbst waren nicht beschädigt. Durch einen Bombentrichter war jedoch die Kühlwasserleitung derart angeschlagen, dass Lennewasser ins Wassermaschinenhaus eindrang, so dass die Anlage absoff. Die Arbeiten mussten in jenen Tagen aus erklärlichen Gründen unterbleiben - wenngleich der Betriebsleiter, Herr Kolter, mit seinen Leuten nach Kräften versuchte, zu retten, was zu retten war.
Die Beschädigungen am Kraftwerk waren so stark, dass 1947/48 der Abbruch erfolgte. Die noch intakten Einrichtungen wurden ausgebaut. Die Kessel wanderten zu Seifenfabriken und Zechen nach Bayern. Die völlig zerstörten Gebäudeteile wurden abgeräumt und das Material verkauft. Erhalten geblieben sind das Fundament des Dampfmaschinenhauses bis zur Fensterhöhe, das Kesselhaus, Pumpenhaus und das Bürogebäude.
Das Kraftwerk war in den letzten zehn Jahren vor seiner Zerstörung technisch nicht modernisiert worden. Der Niedergang begann schon 1933, als das Peroxydwerk in Siesel trotz heftiger Gegenbemühungen aus betriebwirtschaftlichen Gründen aufgegeben und nach Hönningen am Rhein verlegt wurde. Das Werk wurde abgebrochen. Damals verlor Elektro-Mark einen seiner größten Konsumenten, der stündlich bei 3000 kW verbraucht hatte. Zum Vergleich: das Plettenberger Stadtgebiet benötigt stündlich etwa 5000 kW. Damals wurden die Abbruchziegel des Peroxydwerkes von den Kleinsiedlern abgeholt und verbaut, und so war es auch beim Abbruch des Dampfkraftwerkes.
|