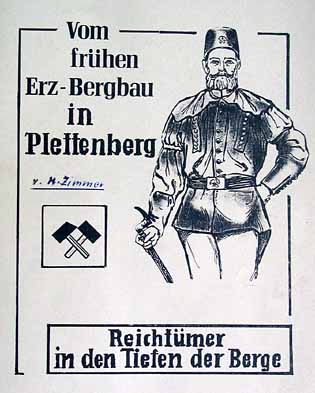|
Vom frühen Erz-Bergbau in Plettenberg Reichtümer in den Tiefen der Berge Von Martin Zimmer (1983)
Im Bereich des "Bärenberges" und der "Hohen Molmert" sowie im
Bommecketal finden wir Reste ehemaliger Stollen und Schächte, aus
denen mit Hilfe einer Seilwinde (Haspel) das Erz ans Tageslicht
gefördert wurde. Ausgedehnte Mulden und Gräben (Pingen) in oftmals
unwegsamen Waldgebieten entstanden durch Einsturz unterirdischer
Stollengänge. Solche Pingen finden wir auch im Bereich des
Schwarzenberges, wo einst Schiefer bergmännisch abgebaut wurde.
Die Geschichte des Plettenberger Erzbergbaues reicht nachweislich
bis in das Jahr 1046 zurück. Mit Sicherheit wurden aber schon vor
dieser Zeit Erze abgebaut und in Rennöfen verhüttet, wie zahlreiche
Schlackenfunde im gesamten märkischen Raum beweisen. Im Laufe der
Jahrhunderte bildeten sich auf dem heutigen Stadtgebiet vier
Bergbauzentren, in denen Kupfer, Eisenstein, Zink, Blei, Schwefelkies
und geringe Mengen Silber abgebaut wurden:
Das Grubenfeld "St. Kaspar" ("Vorsicht" und "Vorsehung") auf
dem "Bärenberg" wird 1338 als "Koppern-Groven up dem Bermberg im
Kerchspiel Plettenbracht" genannt. Weit in den Berg hinein trieben
die Bergleute mit Hammer und Schlegel die Stollen durch das harte
Gestein, um an die Erznester zu gelangen (vgl. Abb. 3 S. 4). Zwei
übereinander verlaufende Stollensysteme, die durch Blindschächte
(Gesenke) miteinander verbunden waren, beweisen noch heute die
hohe Abbauwürdigkeit der Kupfererze am Bärenberg. Das "Hangende"
und "Liegende" (Nachbargesteine) bestand zu großen Teilen aus
weißem Quarz, durchsetzt mit Malachit.
Die geschlagenen Erze wurden zunächst mit der Hand verlesen,
zerkleinert, gewaschen (Erzwäsche) und zur Erzschmelze (Schmelzhütte)
gebracht. Nach alter Überlieferung sollen Proben im Abbau des
Ganges 27 bis 50 Prozent Kupfer und 40 Gramm Silber pro Tonne
ergeben haben. - Die Schmelzhütte lag im Grünetal (siehe Bild)
und wurde während des I. Weltkrieges abgebrochen. Dabei fand
man noch 200 Pfund reines Kupfer. - 1982 wurden die "historischen
Kupferstollen auf dem Bärenberg" wegen ihrer wirtschaftsgeschichtlichen
Bedeutung unter Denkmalschutz gestellt. Besondere Gitter versperren
die Eingänge und schützen somit auch die in den verzweigten und
sehr feuchten Gangsystemen überwinternden Feuersalamander und
Fledermäuse. Im Gebiet des "Heiligenstuhl" wurde ebenfalls Kupfer
gefördert. An jene Zeit erinnern heute noch die Namen der Gruben
wie "Heidberg I/II" und "Wilder Mann".
Bleibergwerk "Zeche Brandenberg" am Saley
Fritz Bertram, ein Plettenberger Bürger, hat sich um die
Erforschung der Bergbaugeschichte Plettenbergs sehr verdient
gemacht. Im März 1952 konnte er das Gangsystem der Bleierzgrube
"Brandenberg" noch "befahren". Ende der fünfziger Jahre
wurden alle Stolleneingänge wegen bestehender Unfallgefahr
zugeschüttet.
Wenn dieses Zeugnis alter Bergbautätigkeit nunmehr verschlossen
ist, so bleiben die noch weithin sichtbaren Abraumhalden ein
eindrucksvoller Beweis für die einstige Größe dieser Grube.
Zinkerzgruben "Emilie" und "Theodora" in Plettenberg-Blemke
Bis 1867 wurde im Gebiet der Blemke das Zinkerz im Tagebau gefördert,
danach mittels mehrerer Haspelschächte. Die in den Schächten
anfallenden Grubenwasser wurden durch Tonnen ans Tageslicht
gehaspelt. Ebenfalls förderte man das Erz in solchen (Foto) Kübeln
nach oben. Das "vor Ort" abgebaute Zinkerz brachte man mit
kleinen Handkarren, die über Laufbohlen geschoben wurden, zum
Schacht - später zur Erzwäsche. 1867 legte man über den in der
Zwischenzeit mehrmals vorgetriebenen Stollen einen Maschinenschacht
von 47 Meter Tiefe, baute stärkere Fördereinrichtungen und
Wasserpumpen ein und erweiterte erneut die Abbaustrecken. 1874
wurde der Hauptstollen bis zu einer Länge von 536 Meter vorgetrieben.
Ein Jahr zuvor war der Maschinenschacht auf 63 Meter Tiefe abgeteuft
worden. Die Erzförderung geschah mit Hilfe einer 20 PS (Pferdestärken)
starken Maschine, die es in Kübeln zum Hauptschacht tansportierte,
von wo es zutage gebracht wurde.
Erzförderung der Zinkgewerkschaft Plettenberg/Blemke:
Dieser Teil einer alten Erzwäsche wurde vor einigen Jahren bei
Hüinghausen gefunden. Sie gehörte einst zu der Grube "Alex I".
Und so funktionierte die 'Wäsche' einst:
Um die Jahrhundertwende kam der Bergbaubetrieb in der "Galmeigrube",
wie das Grubenfeld der Zinkgewerkschaft in Plettenberg-Blemke
auch genannt wurde, zum Erliegen. Seit Anfang der fünfziger
Jahre werden die ehemaligen Erzstollen als Wasserspeicher durch
die Eiringhauser Wassergenossenschaft genutzt.
Der Erzbergbau rund um die Hohe Molmert konzentrierte sich
hauptsächlich auf den Abbau von Blei und Zink. Aber auch Kupfer
und Eisenstein wurden hier geschürft. Oberhalb von Plettenberg-Holthausen
am sogenannten "Dümpel" (Wurmberg) waren bereits vor 1600 zwei
Bleigruben in Betrieb.
(die gesamte Arbeit kann auf Anfrage in Kopie gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt werden) 58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |