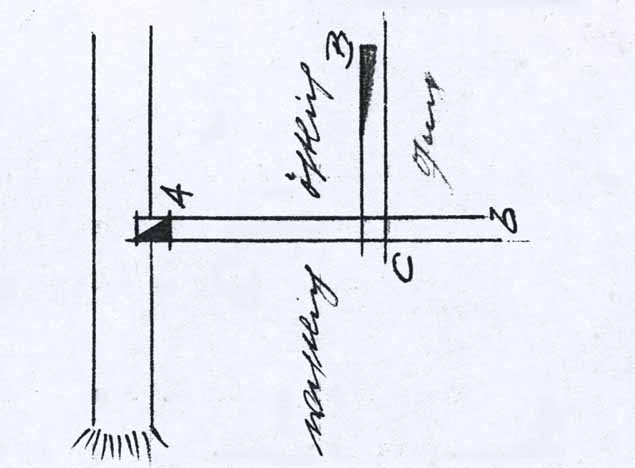|
am Bärenberg (Grubenfeld St. Caspar)
Quelle: WR Plettenberg vom 01.07.2006
Plettenberg - unterirdisch schön
Plettenberg. (jam) Wenn Uli Haller zu Werke geht, kriegts keiner mit.
Meist weit nach Mitternacht rückt der Stipendiat des Kunstfördervereins Werkstatt
Plettenberg an, um mit Digitalkamera und bizarr anmutender Beleuchtungstechnik
banale Ansichten mit zauberhaften Lichtwelten zu verbinden.
"Stadtraum - Spielraum": unter diesem Thema nähert er sich den Plätzen seiner
Heimat auf Zeit. Und probiert dabei auch neu entwickelte Lichtelemente aus.
Auf der Elsewiese kam erstmals ein mehrschichtiger, innen beleuchteter Ball
ins Spiel - und zaubert, mit Bedacht geführt oder gekickt, überraschende
Lichteffekte über die Spielfläche und ins Tornetz. Der Trick bei allen Aufnahmen:
Die Kamera steht auf einem Stativ, der Kameraverschluss wird für mehrere Minuten
geöffnet und der schwarz gewandete Haller dirigiert, nach exakter Choreografie,
seine Leuchtmittel durchs Bild.
Auf der Suche nach "starken Orten" lässt sich Haller auch von längeren nächtlichen
Spaziergängen nicht abschrecken. "Mit meiner Freundin war ich auf dem Hexentanzplatz."
Eine seiner ersten Arbeiten in Plettenberg führte Uli Haller in den Hestenbergertunnel
(die WR berichtete). Seitdem lässt ihn das Thema "Plettenberg unter Tage" nicht
los. Beim Rotwein mit dem heimischen Höhlenexperten Martin Zimmer wurde die Idee
geboren, in den zahlreichen Plettenberger Stollen und Höhlen nach Locations für
seine Lichtartistik zu suchen.
Die WR begleitete Uli Haller, als er sich unter der Führung von Henning Hobein
auf die Suche nach der unterirdischen Schönheit der Vier-Täler-Stadt machte. Im
Licht der Taschenlampen stellte sich indes heraus, dass der alte Stollen oberhalb
der Hachmecke mit seinen vor Jahrhunderten für die Kupfererzgewinnung aus dem
Stein gehauenen schmalen Gängen zwar faszinierende Details aufweist, aber
buchstäblich keinen Spielraum bietet für Hallers Aktionen. Besser ging es in
der Zinkerz-Grube Theodore in Eiringhausen, wo bereits erste Testaufnahmen entstanden.
Viel verspricht sich Uli Haller von einem Besuch in der Grube Neu Glück an der Weide,
die im zweiten Weltkrieg teilweise als Luftschutzbunker ausgebaut worden war und
mehr Spielraum hat. Bekanntlich strebt die Stadt Plettenberg an, dort eine Art
"Besucherbergwerk" einzurichten.
Quelle: Süderländer Tageblatt vom 31.03.1982
Grube am Bärenberg als Besucherbergwerk?
Plettenberg. (HH) Rund 900 Jahre lang standen die Gruben am Bärenberg
für jedermann zur Begehung offen, jetzt fordert das Bergamt Siegen eine
kurzfristige Sicherung der verlassenen Gruben im Feld "Vorsehung" und zwar
durch eine meterdicke Stahlbetonwand. Lediglich für Molche und Salamander
sowie Fledermäuse sollen kleine Schlupflöcher freigehalten werden. Dieser
Bergamt-Forderung stand gestern anlässlich einer Besichtigung im Kreise
sämtlicher Betroffener der Vorschlag der Landesanstalt für Ökologie, Landwirtschaft
und Forsten (LÖLF) gegenüber, die ein starkes Gittertor mit Öffnungsmöglichkeit
als ausreichend ansah. Nach langer Diskussion bahnt sich nun ein Kompromiss an:
Die beiden Gruben sollen zum Besucherbergwerk erklärt werden. Dadurch ist das
Bergamt Siegen nicht mehr sicherungspflichtig, sondern der Betreiber des
Besucherbergwerkes.
Schlagzeilen hatte das Bergamt Siegen gemacht, als Naturfreunde aus dem Raum
Menden verbreiteten: das Bergamt Siegen will die Grubeneingänge am Bärenberg
durch Sprengung schließen! "Kein Wort wahr", berichtigte gestern der Leiter des
Bergamtes Siegen, Dürr, und sein Kollege H. Schmidt. Von der Spreng-Version habe
man erst durch eine Verfügung des Regierungspräsidenten erfahren, der darin das
Bergamt aufforderte, diese Sprengung zu unterlassen. "Wir sollten etwas unterlassen,
was wir nie vorhatten", amüsierten sich die Vertreter gestern über die Mendener
Unterstellung.
Durch einen Bericht in der Zeitschrift "Ruhrkohle", in der Bergleute über eine
Begehung der Bärenberg-Gruben berichteten, war das Bergamt Siegen auf die
offen stehenden Mundlöcher aufmerksam geworden. Per Gesetz ist dem Bergamt die
Aufgabe übertragen (als Exekutive), für die Sicherung aufgegebener Bergwerke
zu sorgen. Aufgrund schlechter Erfahrungen, besonders in letzter Zeit, gilt als
einzig wirksame Sicherung der Verschluss von Gruben durch Stahl-Beton-Armierung.
Die in der Vergangenheit in anderen Gruben angebrachten Gitter und Türen wurden
durchgesägt, aufgebrochen, mit dem Presslufthammer bearbeitet oder - so ein Fall
in jüngster Zeit - per Handgranate (!) aufgesprengt.
"Vor Ort" trafen sich gestern der Vertreter der Unteren Landschaftsbehörde (Stadt
Plettenberg) Gotthard Keil, der Oberen Landschaftsbehörde (Märkischer Kreis) Heinz
Störing, des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege, Hoebel, von Aak vom
Regierungspräsidenten in Arnsberg und Dr. Schulte von der LÖLF. Sie alle sprachen
sich gegen eine endgültige Schließung der Grubeneingänge durch einen Betonblock
("Westwall") aus. Da die Vertreter des Bergamtes von dieser Forderung nicht
abrückten, suchte man nach einem Kompromiss und fand ihn im Begriff "Besucherbergwerk".
So einigte man sich darauf, dem Bergamt Siegen in den nächsten Tagen mitzuteilen,
dass die beiden Grubeneingänge am Bärenberg zu einem Besucherbergwerk umfunktioniert
werden sollen. Zur Sicherung soll etwa 10 Meter "vor Ort" ein stabiles Schutzgitter
angebracht werden. Besucher können dann zu bestimmten Zeiten (um der Tierwelt einen
ruhigen Winterschlaf zu gönnen) in die Grube einfahren, jedoch nur bis zum angebrachten
Gitter. Zu klären wäre dann noch, wer die notwendige Trägerschaft (als Nachfolger des
Bergamtes Siegen) des Besucherwergwerkes übernimmt.
Denkbar wäre der Heimatverein Plettenberg als Träger, zumal die Auflagen für ein
Besucherbergwerk - Sicherung der Grube, Standfestigkeit des Gesteins garantieren,
Wetterführung (Sauerstoffzufuhr) sichern - bei den Bärenberg-Gruben ohne großen
Aufwand zu erfüllen sind. Das Grubenfeld "Vorsehung" könnte dann in die sogenannte
"Schmiedestraße" technischer Kulturdenkmale des Märkischen Kreises eingefügt werden.
Eine Beteiligung an der Finanzierung zur Anbringung der Schutzgitter signalisierten
der Vertreter des Regierungspräsidenten (75 Prozent), des Denkmalpflegeamtes sowie
des Kreises.
Ist der gestern gefundene Kompromiss durchführbar, werden die ältesten Bergwerkszeugen
des Sauerlandes (der Ursprung reicht bis ins Jahr 1046 zurück), die KUpfergruben am
Bärenberg, nach wie vor zu besichtigen sein.
1 Foto, Text: Der Leiter des Bergamtes Siegen, Dürr (mit dem Rücken zur Kamera), bestand
gestern am Bärenberg auf einer Grubensicherung durch eine meterdicke Stahlbetonwand. (Foto: H. Hassel)
Quelle: Heimatblätter des mittleren Lennegebietes, Nr. 21,
Anfang Dezember 1927, 4. Jahrgang
Vom Kupferbergwerk
Am Berenberg wurde in alter und neuerer Zeit Kupfer gegraben, schon
im Jahre 1338 sind die dortigen "Koppern-Groven" erwähnt. Im 16. Jahrhundert
war das Kupferbergwerk am Berenberge eine Zeitlang für jährlich
45 Rtlr. verpachtet, später für den Zehnten. Von 1627 bis 1650 hat
"St. Caspar am Bierenberge" still gelegen. Dann unternahm es der Begründer
der preußischen Artillerie, der Generalfeldzeugmeister Otto Christoph
Freiherr von Sparr, das Bergwerk wieder ergiebig zu gestalten. Es ist kein
gutes Zeichen für den Erfolg, dass er das Unternehmen 1651 schon an den
Ober-Kommissar Johan Paul Ludwig abtrat, der es mit "schweren Kosten"
fortgesetzt hat. Durch den Grafen von Waldeck ließ der Große Kurfürst
erklären, er wolle sich auf Gewinn und Verlust zur Hälfte mitbeteiligen
und hat dem Amtmann und Richter zu Plettenberg, den Bergdirektoren und
Bergverwaltern dieserhalb schriftlich Befehl gegeben.
Der Ausbau des Bergwerks kostete 1100 Rtlr. Als der Kurfürst seinen
Anteil im Februar 1652 noch nicht bezahlt hatte, da bot Ludwig ihm
an, er möge das Bergwerk übernehmen, was er aber abgelehnt hat. 1656
belehnte der Große Kurfürst Joh. Paul Ludwig und seine Nachkommen mit
diesem Bergwerk und außerdem noch mit dem Bleibergwerk "aufm Wormelbergk"
und dem "aufm Ziegenkampf". Er, seine Hausfrau und seine Rechtsnachfolger
durften "ahn solchen Bergen nach Erz einschlagen, stollen treiben und
schacht öffnen, auch Schmelz- und Kohlenhütten, Bochwerke, wohnhäuser,
Stallung und was sonst darzu ferner nötig und thunlichsten zu sein
befinden auß dem aus solchen Bergen stehendem gehöltz ohne engelt
aufbauen, nützen und genießen, sich auch mit denen zu solchen Berkwerken
gehörigen Bergleuten, aller freyheiten, immunitäten, privilegien und
Gerechtigkeiten gleich in denen Sächsisch und Braunschweigischen
Landen gelegenen Bergwerken üblich und Herkommen erfreuen." Ihm und
seinen Nachkommen wurde auch auf 10 Jahre der Zehnte erlassen.
....
Über einen späteren Versuch zur Erzgewinnung in diesem uralten Bergwerk
berichtet ein Vorfahr des Herrn F. Stahlschmidt in Hagen in folgender
Weise: "1801 hatten sich einige unternehmenslustige Männer, darunter
mein Großvater, geeinigt, den Bau wieder aufzunehmen. Weil die zu Gebote
stehenden Mittel gering waren, wurde er schwach betrieben, aber doch
mehrere Jahre fortgesetzt. Der Großvater hatte die sehr hohe Zubuße
nicht immer zahlen können, deshalb meinen Vater zur Übernahme einiger
Kuxen bewogen. Lange fand sich das gesuchte Erz nicht oder doch nur in
geringeren Qualitäten. Endlich, im Sommer 1805, kam die erfreuliche
Nachricht, eine reiche Ader sei "vor Orts", d. h. am äußersten Ende des
alten Stollens, abgeschlagen worden.
Eine Art Festzug, dem sämtliche
Beteiligten sich anschlossen, fand statt. Der Großvater, nahezu
70 Jahre alt, nahm mich, als Vertreter der Kuxe meiner Mutter, mit.
Der Weg ging am linken Ufer des Grünebaches durch das diesen einschließende
enge Tal. Einer der Teilnehmer, Reidemeister Stahlschmidt, Besitzer
des Gutes Letmecke, kam zu Pferde, trat das Tier aber meinem Großvater
ab; mir wurde das Glück zuteil, dass ich mit aufsitzen durfte.
Dreiviertel Stunde bwegte sich der Zug im Tale, dann wurde der Bach
überschritten und der Weg in einer Bergschlucht, die ein kleiner Bach
durchrieselt und mächtig ansteigt, fortgesetzt. Bald erreichten wir
eine geräumige Halde, worauf ein Häuschen für die Bergleute errichtet
war. Dicht daran zeigte sich der Eingang des Stollens, der befahren
werden sollte. Nach einer kurzen Rast begann die Einfahrt...
Quelle: Vom frühen Erzbergbau im Märkischen Sauerland, Heinrich Streich, 1979, S. 81
Vorsehung: Gemutet am 10. September 1860, die Fundstelle liegt
in unmittelbarer Nähe des Hauses auf dem Berenberge. In dem vorgetriebenen
Stollen fand man Malachit, Kupferkies, Fahlerz, weißen bis roten Quarz,
Hornstein, Eisenoker und Lette. 1861 Verleihung, 1891 endgültige Versteigerung.
Kupfer- und Fahlerzgrubenfelder
S[t]ollen des Fundbesichtigungsprotokolls "Vorsehung"
Nach diesen Merkmalen trifft der Stollen den Gang da, wo der Übergang von den
oxydischen Erzen zur Zementationszone stattfindet. Es steht unzweifelhaft fest,
dass die beiden Grubenfelder einen Erzgang überdecken, der auf über 1500 m
fündig überschürft und durch drei Stollen aufgeschlossen ist, und der nach der
Augenscheinnahme und den anderen Fundesbesichtigungsprotokollen bauwürdige
Mengen enthält.
Beweis: Anstehen der Erze im oberen Stollen. Erze im mittleren Stollen, zur Teufe
durch zwei Gesenke aufgeschlossen, der Erzgang geht regelmäßig in die Teufe. Es
wurden Erzmittel zwei Fuss mächtig derb, neben Hangendes und Liegendes mit Quarz
rötlich und weiß mit reichlich Malachit angefahren, die Analyse der derben Erze
aus dem Gesenke brachten 56,2 % Cu auch jedenfalls reichen Silbergehalt. Wie
vorerwähnt, beginnt am mittleren Stollen die Zementationszone, namentlich hat der
Gang schon mehr derbes Erz. Die Erzproben ergaben im mittleren Stollen, da wo
derselbe den Erzgang trifft, Kupferglanz mit 27,85 % Cu und 40 g Silber pro Tonne.
Dass die Zementationszone reiche Kupfererze enthalten muss, ergibt sich aus der
Gangbreite und dem Erzgehalt der Oxydationszone. Die oxydischen Erze des Vorkommens
werden sich zur Auslaugung (Darstellung von Kupfervitriol und Zementkupfer) eignen,
denn die Kupferoxyde der Oxydationszone bilden viele in Säuren lösliche Bestandteile
des Erzganges.
In der Praxis rechnet man, dass derartige Erze bei einem mittleren Kaufpreis noch
mit 1,5 % Cu bauwürdig sind. Ein lohnender Betrieb ist also schon durch die Oxydationszone
gesichert. Beweis: Marberger Kupferhütte; die laugen die Erze mit 1 % augenblicklich
noch aus. Vorerwähnte Grubenfelder wurden vom Tage der Mutung an bis 1865 in Betrieb
genommen und ergaben reiche Ausbeute an derben Erzen. Die Erze der Oxydationszone
haben die Alten stehen gelassen. Im Jahre 1865 fielen die Kupferpreise infolge
einsetzenden amerikanischen Einflusses und der Betrieb wurde eingestellt. Die alten
Schriften geben Aufschluss darüber, dass die Bergleute in dem Gesenke schlechte bis
schließlich gar keine Wetter mehr zum Atmen hatten, auch hatten sie unter Wassereinbrüchen
zu leiden. Die drei vorhandenen Wasserpumpen waren zu schwach, da wurde der Betrieb
eingestellt. Auch mussten die Kupfererze nach Duisburg gefahren werden.
Beschreibung des Kupfererzbergwerkes "Vorsehung"
Das Kupfererzbergwerk "Vorsehung" liegt in der Gemeinde Eiringhausen und
Plettenberg im Kreise Altena. Dasselbe gründet seine Berechtsame auf die am
3./4. Juli 1860 eingelegte Mutung, welche eine vor Ort eines Stollens am
alten Bärenberge entdeckte Kupfererz-Lagerstätte befasst.
Daselbst, und zwar vor jenes Stollens, war nach der Augenscheinsverhandlung
vom 10. September 1860 ein 3 - 4 Fuss mächtiges, in hora 6 streichendes
und mit 60 Grad nach Süden einfallendes Erzlager aufgeschlossen, durchsetzend
den Grauwackenschiefer mit einem Streifen in hora 7 und einem nördlichen
Einfallen von 60 Grad.
Das Erzlager bestand aus einem weißen und roten quarzgrauen Hornstein mit
weißen Quarzschnüren; Eisenocker und Becken führte Malachit reichlich in
Crystallen und kleineren derben Partien, Kupferkies, eingesprengt und in
schmalen Schnüren, Ziegelerz in Schnüren sowie außerdem ziemlich häufig Fahlerz
in kleineren derben Knollen.
Demnächst erging unterm 8. September 1861 die Verleihungsurkunde, durch
welche das Bergeigentum des vorbeschriebenen Bergwerks zu einer Fundgrube
und 855 Maaßen gevierten Feldes so wie auf solches auf die Berechtsamszeichnung
Nr. 3083/281 nach seiner Lage und in seinen Grenzen bezeichnet ist, zur
Gewinnung aller in demselben vorkommenden Kupfererze einschließlich der
Fahlerze allen etwaigen Rechten anderer unbeschadet, verliehen worden ist.
Betrifft: Kupfererzgrube "Vorsehung" bei Plettenberg.
Die vor dem Stollenmundloch der Grube "Vorsehung" lagernde große Halde,
welche im Durchschnitt noch 2,1 % Kupfer enthalten soll, beweist, dass schon
die Alten hier einen bedeutenden Betrieb mit Vorteil geführt haben müssen.
Vom Fundpunkt A aus ist in neuerer Zeit das streichende Ort A.B. ca. 32 Lachter
lang wieder aufgewältigt, welche hauptsächlich durch Zubruchgehen des
Hangenden verstürzt war. Auf dieser ganzen Erstreckung ist früher noch
nichts abgebaut worden, was in einem ca. 1 1/2 Lachter hohen Überbruche
bei 12 Lachter östlich vom Fundpunkte zu ersehen ist, wo die quarzige Gangmasse
1 bis 3 Zoll mächtige derbe Kupferglanze mit etwas Malachit führt. Man
hat hieraus wohl mit Recht geschlossen, dass die Alten jedenfalls noch edlere
Anbrüche gehabt haben müssen, weshalb man jetzt beabsichtigt, das genannte
Ort weiter aufzuwältigen und hierdurch sowohl Aufschluss über den Bau der
Alten als auch über das Verhalten der Lagerstätte überhaupt zu erhalten usw.
Betriebsbericht vom 11. Juli 1862
Bei Eröffnung des Betriebes der Grube "Vorsehung" waren vom Eintritte des 109 Lachter
langen Stollens in die Gangmasse ca. 32 Ltr. der Feldort im Altenmann
aufgewältigt und in Türstreckenzimmerung gesetzt usw. - Die Gewinnungsarbeiten
hatten nicht den günstigen Erfolg, wie man bei Eröffnung des Betriebes annehmen
konnte. Bei 12 Ltr. östlich vom Stollenorte ist ein 3 3/4 Ltr. hoher Überbruch
vorgerichtet und nach W 1 1/2 Ltr. langer Firstort getrieben. Hier verloren sich
die derben Kupferglanze aber gänzlich und führt die Gangmasse nur noch Kupferschwärze,
während das Liegende (ein milder Grauwackenschiefer) Malachit eingesprengt
enthält.
Betriebsbericht vom 20. Oktober 1862
Aufwältigungsarbeiten in östl. Streichungsorte der Grube auf eine Länge
von 122 Lachter erreicht. Bei ca. 120 Ltr. traf man auf zwei große,
unregelmäßig geformte, von den Alten abgebaute Nester, welche nach
den im umgebenden Gestein anstehenden Malachiten zu urteilen, sehr
derbe und reiche Kupfererze geführt haben müssen. Diese ca. 1200
Cbfuß haltenden Räume waren gänzlich mit Wassern angefüllt, welche,
als man noch ca. 3 Fuß vom Überbruche, welcher in jene Räume führte,
entfernt war, anfingen durchzubrechen. usw.
Witten, den 22. Februar 1863
Der Betrieb der Kupfererzzeche "Vorsehung"
Durch die sehr geehrte Verfügung des Kgl. Oberbergamtes vom 17. November 1862
wurde mir die Mitteilung gemacht, dass die Kupfererzzeche "Vorsehung" bei
Plettenberg auf Antrag des Repräsentanten in Frieden gelegt sei. Gleichwohl
habe ich bei meiner gestrigen Anwesenheit in Plettenberg in Erfahrung
gebracht, dass die genannte Zeche unausgesetzt in Betrieb ist.
Der Revierbeamte in Witten vom 26. Februar 1863 schreibt an den
Repräsentanten der Kupfererzzeche "Vorsehung", Herrn Kommerzienrath
Wiesehahn in Dortmund, und fordert die Einreichung des Betriebsplans
an.
Es folgt dann der Betriebsbericht von Kommerzienrath Wiesehahn vom
3. März 1863 über beabsichtigte Aufwältigung einer zu Bruch gegangenen
Strecke.
Betriebsplan vom 4. Juni 1863 von Kommerzienrath Wiesemann ist nicht von
Belang, da damit nur von der Fortsetzung von Aufwältigungsarbeiten die
Rede ist.
Betriebsbericht von Steiger H. Stahlschmidt
Plettenberg, den 18. Juli 1863
Betriebsbericht für das III. Quartal 1863 von H. Stahlschmidt
Aufräumungsarbeiten und weiteres Abteufen eines alten im Hangenden der
Lagerstätte angesetzten Gesenkes.
Betriebsbericht vom 8. Januar 1864 pro IV. Quartal 1863
Die erste Pumpe im Gesenke im Liegenden der Lagerstätte im westl. Stosse
eingebaut, die die Grubenwasser bis zu einer Höhe von 30 Fuss hebt. Dann
ist ein Ort zur zweiten Pumpe vorgerichtet und ein Kasten zur Aufnahme
des Wassers eingebaut.
Betriebsbericht von H. Stahlschmidt vom 7. April 1864
I. Quartal. Beim Abteufen des im Hangenden der Lagerstätte angesetzten Gesenkes
eine mit etwas Ziegelerz ausgefüllte Kluft, welche sehr viel Wasser führt, so
dass dieselben mit Handpumpen kaum gehalten werden konnten.
Betriebsbericht von H. Stahlschmidt vom 3. Juli 1864
Im Gesenke wurden 2 Oerter auf dem Streichen des Ganges angesetzt, um das
Verhalten der Lagerstätte in dieser Richtung kennen zu lernen. Vor dem östlichen
Orte wurden zum Ende des II. Quartals s.c. ein 1 1/2 Fuss mächtiges Kupferglaserzmittel
angefahren, welches bis jetzt noch ziemlich regelmäßig durchzusetzen scheint.
Betriebsbericht von Kommerzienrath Wiesehahn vom 9. Oktober 1864
Im Überbruch wurden 30 Ctr. Erze gewonnen. Die Lagerstätte besteht aus einem
ca. 2 Fuss mächtigen mit Kupferglanz Malachit und Kupferschwärze durchsetzten
rötlichen Quarz.
Betriebsbericht von Kommerzienrath Wiesehahn vom 10. Januar 1865
In den Gesenken versoffen und dann auf Stollensohle einige Versuche gemacht
in der zu Bruch gegangenen Strecke und haben im ganzen 3 Fuss weiter vorgetrieben
und da sehr schöne derbe Kupferglaserze welche auf eine Länge von 12 - 14
Lachter bei einer wechselnden Mächtigkeit von 10 bis 18 Zoll regelmäßig durchsetzen,
angefahren.
Kommerzienrath Wiesehahn schreibt am 29. März 1865, dass Obersteiger
Stahlschmidt behufs Erhebung der Aufsichtssteuern Angaben über die bis Ende
Dezember 1864 verkauften Erze machen soll.
Betriebsbericht von H. Stahlschmidt vom 18. Juli 1865
Belegschaft zur Hälfte zum Abbau des 10 bis 15 Zoll mächtigen Kupfererzglasmittels
benutzt, die andere Hälfte der Belegschaft zur Untersuchung der Lagerstätte.
Quelle: HH u. Bezirksregierung Arnsberg, Abt. Bergbau u. Energie in NRW, Dortmund |