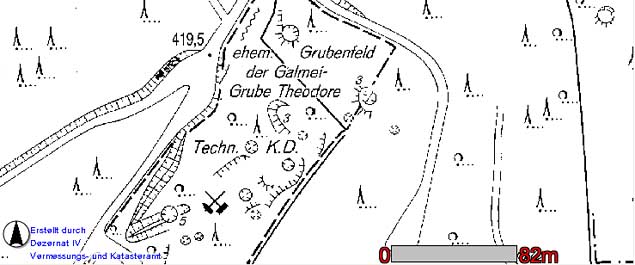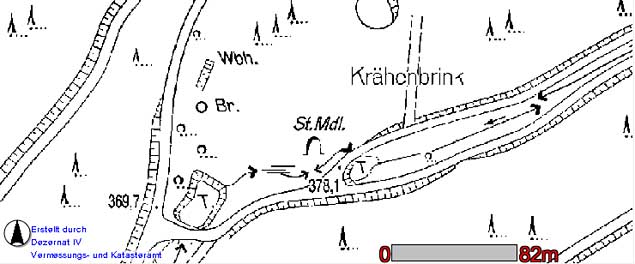Zink(Galmei-)-Stollen in der Blemke,
gemutet 1863, ca. 1864 mit der benachbarten Grube "Emilie" verbunden; Stillegung 05.12.1883;
seit 1949 werden die Stollen als Wasserspeicher durch die Eiringhauser Wassergenossenschaft genutzt; |
|
|
Quelle: Westfalenpost vom 18.11.1949
Wasser für Eiringhausen
Plettenberg. Vor einem Monat berichtete die WESTFALENPOST, dass die
Wassergenossenschaft Eiringhausen in der Blemke einen alten Galmeistollen
der ehemaligen Hermannszeche in Allendorf entdeckt hatte, der selbst in den
trockendsten Sommermonaten immer noch gleicmäßig Wasser lieferte. Der Plan,
diese Wasserquelle für die Wasserversorgung von Eiringhausen nutzbar zu machen,
wurde jetzt verwirklicht. Anfang dieser Woche konnte im Beisein der
Vorstandsmitglieder der Wassergenossenschaft dieses neue Wasserreservoir in
Betrieb genommen werden.
Der Wassergenossenschaft kam es hauptsächlich darauf an, dem in den letzten
Monaten sehr unangenehm auftretenden Wassermangel ein Ende zu bereiten. Zu
diesem Zweck war die Verlegung einer 1300 Meter langen Rohrleitung von der
Schlucht bis zum Stollen bei einem Gefälle von 100 Metern notwendig. In der
Hauptsache wurden Rohre mit einem Durchmesser von 100 Millimetern verlegt
und nur an der Stelle, die den größten Druck auszuhalten hat, erweitert sich
der Durchmesser auf 150 mm. Die Inbetriebnahme der neuen Wasserleitung ging
ohne Zwischenfälle vonstatten. Allerdings ist noch abzuwarten, ob der erhöhte
Druck nicht in nächster Zeit Rohre bricht.
Auf Grund dieser Rohrlegung hat man die Einrichtung der Filterstation für
einige Zeit zurückgestellt. Gleich zu Beginn der Arbeiten, die von der Baufirma
Kraus, Böddinghausen, ausgeführt worden sind, wurde der Stolleneingang auf einer
Strecke von ungefähr 15 Metern ausbetoniert. Am Eingang des Stollens steht
das Filterhaus bereits im Rohbau fertig. Der weitere Ausbau wird in nächster
Zeit erfolgen.
Damit ist die Wassergenossenschaft Eiringhausen einen wesentlichen Schritt
weitergekommen. Die Bundesbahn mit ihrem täglichen Verbrauch von 100 cbm
Wasser ist heute einer der größten Abnehmer. Aber auch die Industriebetriebe
Graewe & Kaiser u. a. stehen nicht zurück. Nun wird die neue Quelle, zu
deren Ausbau die Wassergenossenschaft rund 30.000 DM aufwenden muss, wesentlich
dazu beitragen, die Wassernot in Eiringhausen zu beheben.
Dies ist aber nicht das einzige Projekt, das die Wassergenossenschaft im
Augenblick durchführt. Die Silbergsiedlung, die bislang ohne Wasserleitung
auskommen musste und gezwungen war, das Wasser an einer Zapfstelle in der
Friedhofsstraße zu entnehmen, wird bald dieser Sorgen enthoben sein. Von der
Friedhofstraße aus wird jetzt die Leitung über eine Strecke von 300 Meter
bis zur Silbergsiedlung verlegt werden. Diese Leitung wird aus dem Hochbehälter
auf der Halle an der Straße nach Affeln gespeist werden. Damit hat die
Wassergenossenschaft auch diesem Mangel ein Ende bereitet. Die Erdarbeiten
wurden von der Firma Schöpe, die Installationsarbeiten von Klempnermeister
Werle und die Betonierungsarbeiten von der Firma Kraus ausgeführt.
Quelle: Süderländer Tageblatt vom 17.11.1949
Bergwerkstollen als Wasserreservoir
. . . Diesen außerordentlichen Umstand, der der Genossenschaft viel Geld
für Wassersuche und Quellsammler zu ersparen geeignet war, hat die
Genossenschaft zu nützen verstanden. Die Voraussetzungen für eine
Wassernutzung in diesen Stollen schienen von vornherein günstig. Das
Gelände-Einzugsgebiet ist mit Wald bestanden. Die geringste Deckung
über dem Stollen beträgt 2 1/2 Meter. davon 1 Meter festes Gestein.
Eine ungünstige Beeinflussung durch Oberflächenwasser schied damit aus.
Nachdem sich die Genossenschaft Gewißheit über die einwandfreie Beschaffenheit
des Wassers und eine dauernde gute Ergiebigkeit des Wasserstollens
verschafft hatte, hat sie sich die Rechtsgrundlage zur ungestörten
Benutzung des Stollens gesichert. Schon vor 10 Jahren wurde das
hygienische Institut in Gelsenkirchen mit der Untersuchung des Wassers
beauftragt. Damals, wie bei der im Jahre 1948 wiederholten Untersuchung,
wurde festgestellt, dass das Stollenwasser bakteriologisch in jeder
Hinsicht (vor allem in Bezug auf etwaige Beeinflussung durch erzhaltiges
Gestein) einwandfrei und somit als Trinkwasser durchaus geeignet ist.
Die Analyse ergab eine sehr niedrige Keimzahl sowie das völlige Fehlen
von Colibazillen. Blei und Arsen waren nicht nachweisbar, Zinkoxyd fand
sich nur in leisesten Spuren. Die gesundheitliche Zuträglichkeit des
Wassers wurde in mehrfachen wissenschaftlichen Untersuchungen festgestellt.
In chemischer Hinsicht wurde das Wasser aggressiv befunden, was aber
nur Bedeutung hat in Hinsicht auf die Rohrwandungen der Leitung, die
durch Entsäuerung des Wassers aber entsprechend geschützt werden können.
Regelmäßige, durch lange Jahre hindurch fortgesetzte Messungen ergaben
im übrigen, dass maximal mit einer Tagesschüttung von 500 (!) cbm Wasser
(selbst im abnorm trockenen Sommer 1947 waren es noch 355 Kubikmeter täglich)
gerechnet werden darf. Auch in diesem trockenen Sommer hat sich die
Ergiebigkeit des Stollens unverändert gezeigt.
Eine heikle Frage
Quelle: Amtliche Bekanntmachungen vom 19.10.1949
In der Blemke:
Plettenberg. (Eig. Ber.) Dumpfe Kellerluft strömte der dunkle Gang aus,
der in den Berg hineinführt, und innen plätschert es leise und stetig - dort
oben in der Blemke. Die Wassergenossenschaft Eiringhausen wurde schon vor
längerer Zeit auf diesen alten Stollen aufmerksam, der in einer kleinen Schlucht
anfängt und ungefähr nach 400 Meter im Berg verschüttet wurde. Angeblich
handelt es sich um einen alten Stollen der Hermannszeche in Allendorf, in
der früher, so um 1860 herum, Galmei gewonnen wurde. Und nun rieselt trotz
größter Trockenheit immer noch gleichmäßig ein kleiner Bach aus diesem
Stollen. Angestellte Messungen ergaben, dass diese Quelle auch jetzt noch
18 Kubikmeter Wasser stündlich liefert.
Die Trockenheit bewirkte in letzter Zeit im Versorgungsgebiet der
Wassergenossenschaft Eiringhausen sowieso schon zu dauernden Störungen in
der Versorgung. So kam man auf den Gedanken, diese neue Quelle für diese
Zwecke nutzbar zu machen.. Zuerst legte man den Eingang zu dem Stollen
frei. Mit Gummistiefeln und Blendlaterne unterzog man den dunklen Gang
einer genauen Untersuchung. In der Mitte des Ganges lag eine alte, handgeschmiedete
Schaufel mit einem morschen Griff, die anscheinend noch aus der Zeit
stammte, da der Stollen noch in Betrieb gewesen ist. Auch alte Bohlen und
Eichenstützen lagerten noch hier und da.
Nun plant die Wassergenossenschaft Eiringhausen, vor dem Eingang zu dieser
Quelle eine Filterstation zu errichten und das gewonnene Wasser dem Hochbehälter
in der Blemke zuzuleiten. Soweit ist alles bereits in die Wege geleitet.
Mit dem Ausbau der Filterstation wurde die Firma Wilhelm Kraus, Böddinghausen,
beauftragt und jetzt wartet man nur noch auf die Baugenehmigung. -ka-
Quelle: Schreibmaschinenmanuskript, 9 Seiten, Verfasser unbekannt (im Archiv H. Hassel) Seite 5 bis 7:
Zinkgewerkschaft musste die Grube "Theodore" stilllegen
...Wir verlassen die Bleierzgruben und wenden uns den Zinkerzfunden
zu. Dieses Mineral ist allgemein unter dem Namen "Galmei" bekannt;
auch heute noch ist die Kenntnis von den Galmeigruben in der oberen
Blemke, ca. 250 Meter oberhalb des Kahlberges, allgemein gut. Fast
das ganze Gebiet von der Wilden Wiese über die Homert bis zum Baukloh
ist Eigentum der Plettenberger Zinkgewerkschaft, die ihre Anfänge
in den Galmeigruben der Blemke hatte. Diese Gruben hatten den Namen
"Emilie" und "Theodore", von denen der Betrieb "Theodore" der jüngere
ist. 1852 wurde die Fundstelle "Emilie" gemuthet. Man baute zunächst
das Zinkerz in Form kleiner Haspelschächte ab, die maximal etwa bis
zu 10 Meter abgeteuft wurden. Das Galmeilager war 8 bis 9 Fuss mächtig,
darüber lag Toneisenstein. 1867 wurde dann auf der Grube "Emilie" und
der benachbarten "Theodore" der Tagebau weitgehend aufgegeben und man
trieb einen gemeinsamen Stollen in das Gebirge.
Wenn man das Grubenbild der Grube "Theodore" betrachtet, was anhand
alter Betriebsberichte rekonstruiert werden konnte, dann wurde zunächst
ein Förderstollen angelegt (Zeichnung Grube "Theodore"). Ca. 150 Meter
vom Stolleneingang entfernt setzte dann ein Maschinenschacht an, der
nach oben durchschlägig gemacht wurde. Mittels Dampfmaschine konnte
das Zinkerz aus einer 1. Tiefbausohle bei 20 Meter und einer 2. Tiefbausohle
bei 40 Meter, der Maschinenschacht selber wurde insgesamt 63 Meter
abgeteuft.
Es wurde neben Zinkerz auch Schwerspat gefördert. Einige Zahlen mögen
einen Hinweis auf die Ergiebigkeit geben:
Am 07.02.1878 musste der Betrieb plötzlich eingestellt werden, weil die
in der unteren Blemke befindliche Papiermühle auf Schadenersatz geklagt
hatte, weil das verschmutzte Wasser der Zinkerzgrube das Papier verdarb.
Den angestrengten Prozess verlor die Plettenberger Zinkgewerkschaft, sie
musste die Grube vorübergehend stilllegen und 12.000 Mark bezahlen. Von
diesem Schlage hat sich die Gewerkschaft nie wieder erholen können, so
dass der Betrieb 1888 endgültig eingestellt wurde.
Der Förderstollen war bis auf wenige 100 Meter bis zu den Stollen der
Hermannszeche bei Allendorf im Kreise Arnsberg vorgetrieben worden,
und so machte die Gewerkschaft der Hermannszeche noch 1935 den Vorschlag,
besagten Stollen weiter zu führen, damit man dann die Eisenerze der
Hermannszeche von der Plettenberger Seite abbauen könnte. Es blieb bei
dem Vorschlag und 1948 verkaufte die Fa. Grillo, die die Repräsentantin
der Plettenberger Zinkgewerkschaft ist, die Wassergerechtsame im Umkreis
von 1 km um den Stollen, so dass nun die Eiringhauser Wassergesellschaft
das Trinkwasser aus der Grube "Theodora" bezieht.
|