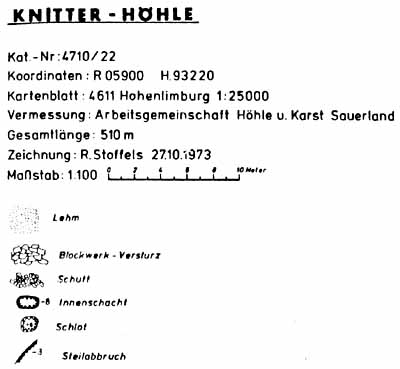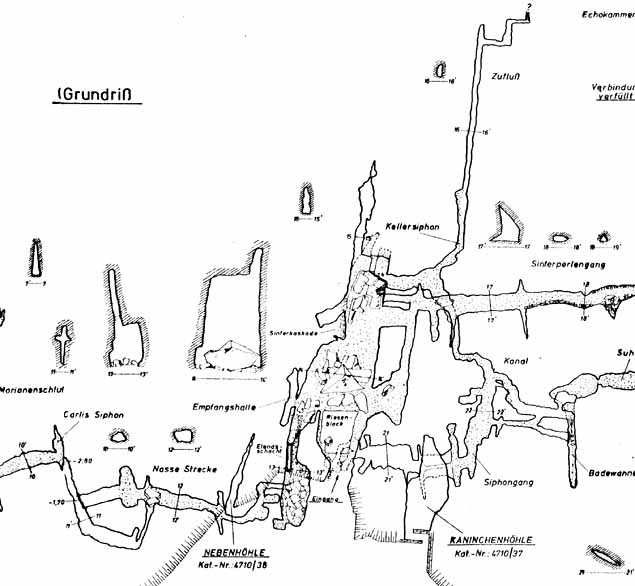|
Quelle: AntiBerg Nr. 6 vom 01.03.1977, S. 4-6
Die Erforschung der Knitterhöhle
Von Rainer und Dieter Stoffels
Zwischen der von Iserlohn nach Letmathe führenden Bundesstraße 7 und
der in halber Höhe des Südhanges des Sonderhorstes verlaufenden
Bahnstrecke liegt im mitteldevonischen Massenkalk ein seit dem
vorigen Jahrhundert aufgelassener Steinbruch. Besitzer des teilweise
bebauten Grundstücks ist der Uhrmacher Alfred Knitter (Iserlohn-Letmathe,
Hauptstr. 77)
Hinter seinem Wohnhaus führt ein Weg durch einen terassenartigen
Garten empor zum Eingang der Knitterhöhle. Er liegt am Fuße einer
kleinen Steilwand oberhalb einer bewachsenen Halde. Die erste
genauere Untersuchung der tagnahen Höhlenteile datiert wohl aus
dem Jahre 1868, als oberhalb der Höhle die Trasse der Iserlohner
Eisenbahn in den Kalkstein gesprengt wurde. Bei dieser Gelegenheit
bahnte man sich auch mit Dynamit einen Weg durch die engsten
Teile des "Sinterperlenganges", der die Knitterhöhle mit der
Höhle "Pferdestall" (4710/8) verband.
1910 erfolgte die erste höhlenkundliche Untersuchung durch Dr. Benno
Wolf, dem 1. Vorsitzenden des Rheinisch-Westfälischen Höhlenforschungsvereins
in Elberfeld. Er veröffentlichte im Mitteilungsblatt seines Vereins
eine ausführliche Beschreibung der bis damals bekannten Höhlenteile
(Westdeutsche Höhlen I, Höhlen Nr. 31, 32, 33: "Untere Dechenhöhle",
siehe auch folgenden Artikel).
Erst im Frühjahr 1973 setzte durch einen Hinweis der Studiengemeinschaft
für Vorgeschichte und Höhlenkunde Iserlohn eine Neubearbeitung der
Höhle seitens der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Sauerland ein.
Im Laufe eines halben Jahres gelang nun durch den Einsatz von Spaten,
Hammer und Tauchgeräten der Vorstoß in die bis dahin unbekannten
Gänge der Knitterhöhle. Anfangs bildeten die sechs Syphone der
ausgedehnten wasserführenden Teile das größte Hindernis. Nur die
Hälfte konnte durchtaucht werden. Der Rest war trotz vorangeschobener
Pressluftflasche zu eng oder eine ungünstige Fließrichtung trübte
das Wasser zu stark.
Erst als im September 1973 die anhaltende Trockenheit des vorangegangenen
Sommers zum Versiegen des Höhlenbaches führte, und der örtliche
Karstwasserspiegel sich um über 7 Meter senkte, wurde auch der Weg
durch die restlichen Syphone frei. Damit wurden auch alle sonst unter
Wasser liegenden Gangstrecken zum erstenmal befahren. In rascher
Folge, die baldige Rückkehr des Höhlenbaches fürchtend, erfolgten
nun weitere Neuentdeckungen und anschließende Vermessung. So konnte
die vorher mi 98 Meter veranschlagte Höhle (H. Streich) auf eine
Gesamtganglänge von 510 Meter vermessen werden. Der vorliegende Plan
zeigt die Knitterhöhle in wasserlosem Zustand.
Beschreibung
An den Wänden der Empfangshalle lässt sich unschwer das Niveau einer
ehemalig durchgehenden Sinterdecke nachweisen. Sie ist im nördlichen
Hallenteil noch erhalten und untergliedert ihn in zwei Etagen. Diese
Sinterdecke muss auf einer Lehmablagerung entstanden sein, die später
durch den Höhlenbach wieder fortgeschwemmt wurde. Dieser Vorgang
führte zum Einsturz der Decke. Davon zeugt das Bruchstück einer
mächtigen Tropsteinsäule, die heute weit unterhalb des Niveaus der
alten Sinterdecke am Hallenboden liegt. Auf ihr wachsen bereits
Stalagmiten der 2. Generation.
Zur 1. Sintergeneration dürfte dagegen der sogenannte "Wächter"
gehören. Diese mehrere Meter hohe, säulenartige Wandversinterung ist
das eindrucksvollste Tropfsteingebilde der Höhle. An dieser Säule
lässt sich das Tropfstein-Wachstum außergewöhnlich gut beobachten,
da die Basis der Säule wegen des Einstürzens der Sinterdecke
vollkommen frei liegt.
Will man den aktiven Teil der Höhle befahren, steigt man zwischen den
Blöcken im hinteren Teil der Empfangshalle ab zum "Kellersyphon". Den
Zugang zu diesem Syphon sperrte bis 1973 eine 0,50 Meter starke
Lehmwand, aus der aus einer nur 0,20 mal 0,30 Meter großen Öffnung
der Höhlenbach hervorsprudelte. Erst nach Aufgraben der Engstelle
und mehreren vergeblichen Tauchvorstößen konnte der Syphon überwunden
werden. Leider endete der dadurch entdeckte "Zufluss" in einer
abwärtsführenden, unschliefbaren Kluftfuge.
Dem Kellersyphon gegenüber schließt sich in südlicher Richtung
bachabwärts der sogenannte "Kanal" an. Auch dieses Gangstück musste
erst aufgegraben werden und war, wie der größte Teil der neuen Gänge,
nur auf allen Vieren oder auf dem Bauche zu befahren. |