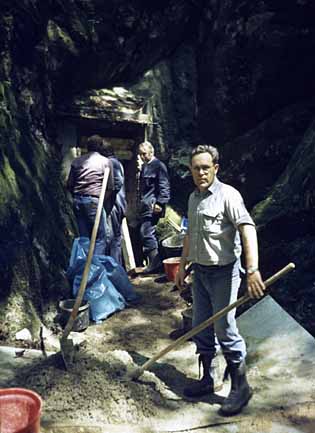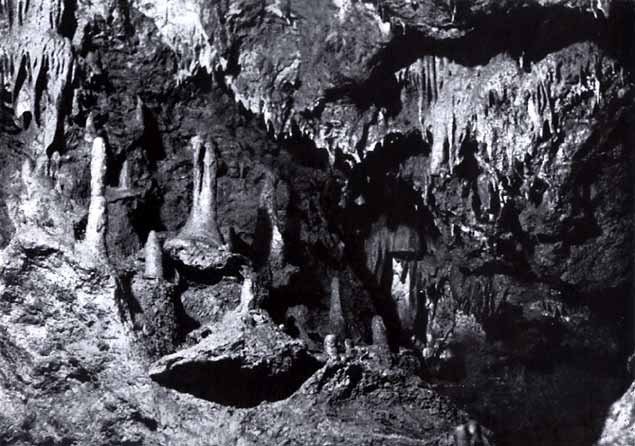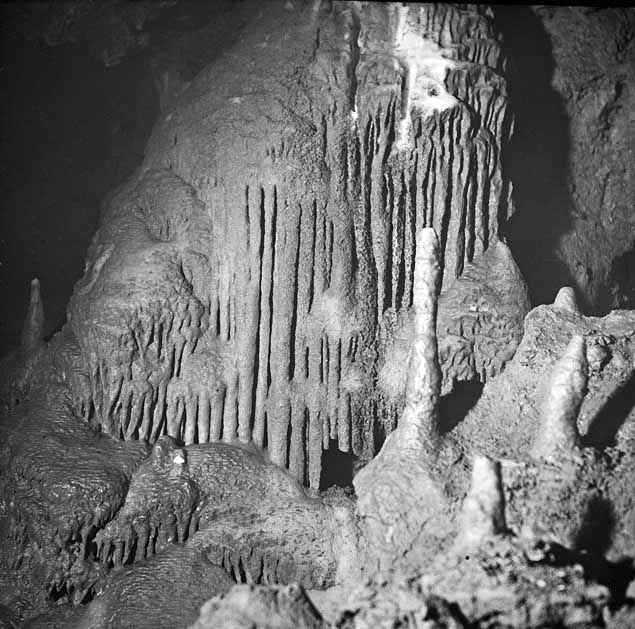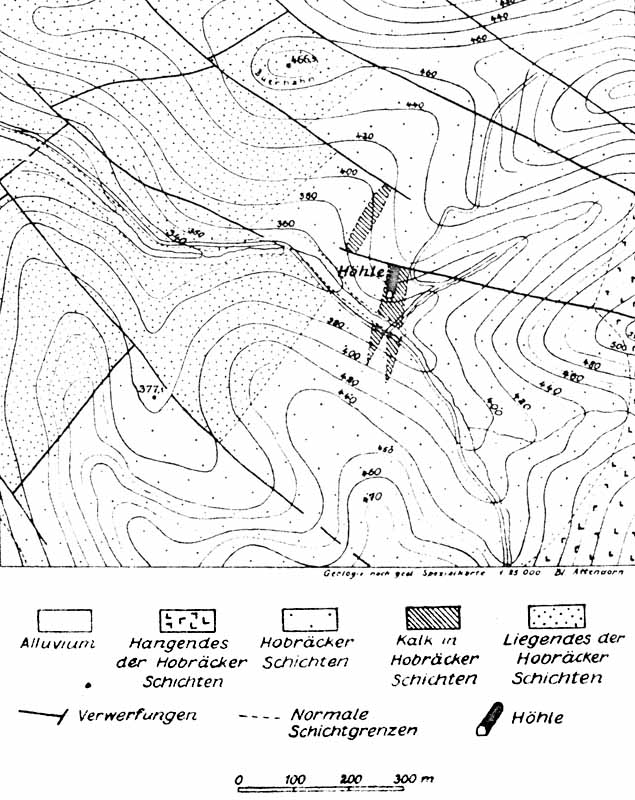Quelle: Süderländer Tageblatt vom 31.12.2005
Martin Zimmer erkundete
Zimmers Diavortrag bei den Kückelheimer Senioren stieß auf reges Interesse. Abgebildete Plettenberger Höhlen sind heute meist gar nicht mehr zugänglich.
PLETTENBERG Auf eine spannende Reise in die vergessenen Stollen und Höhlen
der Vier-Täler-Stadt nahm Stadtarchivar Martin Zimmer am Donnerstag etwa
65 Kückelheimer Senioren mit. Er war mit seinem Referat einer Einladung der
Kückelheimer Silvestersänger in die Erlöserkirche gefolgt, wo diese einen
Nachmittag mit Kaffee und Kuchen für die Senioren des Dorfes veranstalteten.
Besonders beeindruckend waren neben dem fachlich fundierten Vortrag über
den historischen Bergbau in Plettenberg auch die einmaligen Bilder "unter
Tage" aus Stollensystemen und Höhlen, die heutzutage gar nicht mehr oder
nur noch schwer zugänglich sind. Die Auswahl aus etwa 1 000 angefertigten
und zusammengetragenen Lichtbildern vermittelte dem Publikum einen
interessanten Einblick in den "Schweizer Käse" Plettenbergs, wie Wolfgang
Baberg treffend die Landschaft unter Tage betitelte.
Denn 113 Grubenfelder waren von 1600 bis 1952 im Amtsgerichtsbezirk Plettenberg,
zu dem auch die Gemeinde Herscheid gehörte, verzeichnet. Eisen, Kupfer,
Blei und Zink wurden in teils kilometerlangen Stollen abgebaut. Ob Hestenberg,
Saley oder Bärenberg: Überall wiesen die "Höhlenforscher" um Martin Zimmer
Spuren des Bergbaus nach. Neben den Stollensystemen, die teilweise bis
ins Jahr 1046 zurück datiert wurden, galt der Fokus des Vortrages, aber
auch der Heinrich-Bernhard-Höhle im Oestertal, Plettenbergs größter
Tropfsteinhöhle. Diese ist heute nur noch für Fledermäuse zugänglich
– aufgrund fortlaufender Beschädigungen der Schlösser hatte man Mitte
der 80er Jahre beschlossen, die Höhle mittels einer meterdicken Eisentür
zu versiegeln.
Die einzigartigen Aufnahmen, die in der "Forschungszeit" entstanden,
lassen jedoch aufregende Naturschönheit hinter dem kalten Deckel vermuten.
Viele der Bergwerksstollen im Stadtgebiet seien in den Jahren des Zweiten
Weltkriegs zu Luftschutzbunkern ausgebaut worden. Ein beeindruckendes
Beispiel seien die Stollen gegenüber der Firma DURA – leider sind auch
diese nicht begehbar, da sie zugemauert wurden. Kurz: Die Kückelheimer
Senioren genossen den fachlich versierten Vortrag und erhielten Einblicke
in die Historie und die Höhlensysteme der Vier-Täler-Stadt, die kaum
alltäglich sind. Im Anschluss saß man in geselliger Runde bei Kaffee
und Kuchen zusammen und hatte viel Gesprächsstoff. Höhlen sind doch
stets geheimnisvoll und in jedem steckt ein "kleiner Höhlenforscher". jmt
Quelle: "Plettenberg - Märkischer Kreis", herausgegeben vom
Kreisheimatbund zum Kreisheimattag 1994 in Plettenberg, hier: Die
"Heinrich-Bernhard-Höhle" bei Plettenberg - ein einzigartiges
Naturdenkmal, Autor: Martin Zimmer, S.60-63, 6 Fotos, 1 Zeichnung.
"Heinrich-Bernhard-Höhle" bei Plettenberg
Von den Höhlen, wie man sie insbesondere in Kalk- und Dolomitgegenden
vorfindet, geht zweifellos eine eigenartige Faszination aus.
Es liegt wohl daran, dass sie den Zugang zu einem Teil unserer
Welt bieten, der uns sonst verborgen bleibt.
Das Sauerland, das "Land der tausend Berge", gilt nicht zu
Unrecht als "Land der Naturhöhlen". Die Bewohner dieser Landschaft
sowie die große Zahl der Touristen aus dem benachbarten Ruhrgebiet
besuchen auf ihren Wanderungen durch das südwestfälische Bergland
gern die "Unterirdischen Zauberreiche" der bekannten Tropfsteinhöhlen
bei Letmathe oder im Hönne- und Biggetal, um bei ihrem Gang durch
die weit verzweigten Felsspalten, Klüfte und Sintergalerien den
großen Formenreichtum der Tropfsteine und damit auch ein Stück
Erdgeschichte des Sauerlandes zu erleben.
Die "Schau- und Besucherhöhlen" liegen fast ausnahmslos in den
mächtigen Formationen des "Sauerländer Massenkalkes", die sich in
einem breiten Band von Hagen über Letmathe, Iserlohn, Balve (Hönnetal)
bis an die Lenne hinziehen und in ihren Ausläufern Attendorn erreichen.
- Neben diversen für die Öffentlichkeit zugänglichen Tropfsteinhöhlen
gibt es im Sauerland eine Vielzahl von weniger bekannten Höhlensystemen
unterschiedlichster Ausdehnung. Sie sind wegen ihrer oftmals sehr
versteckten Lage und schwierigen Begehbarkeit nur von geübten und
entsprechend gut ausgerüsteten "Höhlenwanderern" zu begehen. Hinzu
kommt, dass in derartigen Naturhöhlen meistens nur wenige Tropfsteine
vorhanden sind und sie sich demzufolge als "Touristenhöhlen" kaum
eignen würden. Dennoch gilt gerade jenen weithin unbekannten
Höhlensystemen das besondere Interesse der Höhlen- und Karstforscher
(Speläologen). Sie sind u. a. darum bemüht, Naturhöhlen zu vermessen,
durch neue Grabungen vorhandene Gangsysteme weiter zu erforschen oder
ihre geologischen Besonderheiten im Bild zu dokumentieren. Somit ist
Höhlenforschung ein wesentlicher Beitrag zur Geschichte des Sauerlandes.
Außerhalb der bereits erwähnten Zone des Sauerländer Massenkalkes
liegt nahe der Stadt Plettenberg das landeseigene Naturdenkmal
"Heinrich-Bernhard-Höhle", benannt nach ihren Entdeckern Heinrich
Decker und Bernhard Klein aus Plettenberg-Oesterau.
Über einem ehemaligen Kalksteinbruch, an dessen Steilhängen Kalke, z. T.
Felsklippen bildend, zutage treten, liegt der Eingang zur Höhle
(s. Abb. 1/2). Die schätzungsweise 20 bis 30 Meter mächtige Südostwand
wird vorwiegend aus den Riffbildern (Organismen) Stromatoporen,
Tabulaten und Tetrakorallen aufgebaut. Bei den Kalkschichten handelt
es sich um den Ansatz zur Bildung eines Korallenriffs auf einem
flachen, küstennahen Meeresboden. Infolge sich ständig wiederholender
Einschwemmungen sandiger und toniger Schichten, die das Korallenwachstum
stören, konnte sich das Riff nicht voll entfalten. So sind die
Kalkablagerungen unrein und teilweise von Grauwackematerial
durchsetzt. Wir haben es hier mit einer Kalklinse zu tun, die
außerhalb des eigentlichen Sauerländer Massenkalkgürtels liegt.
Schon in den zwanziger Jahren galt dem "Kruplouk", wie die wenige Meter
lange Felsspalte in dem kleinen Kalkkomplex des "Keuperkusens"
südlich des "Buerhahns" allgemein von den Bewohnern des Oestertales
genannt wurde, die besondere Aufmerksamkeit von Bernhard Klein. In
seinem Arbeitskollegen und Freund Heinrich Decker fand er einen
engagierten Helfer, denn von 1934 bis 1942 führten sie gemeinsam
systematische Untersuchungen in "ihrer Höhle" durch.
Der Bereich des recht engen Höhleneingangs wurde zunächst in
mühevoller Arbeit erweitert und die einlagernden Lehmschichten
abgetragen. Hierbei fand sich schon in den oberen Lehmschichten
ein Faustkeil, ein sogenannter "Spinngürtel" zum Bearbeiten von
Wolle, und ein Gehörnstück, dass vermutlich von einem Elch stammte.
Die Echtheit jener Artefakte, die auf eine sehr frühe Besiedlung
unserer Heimat schließen lässt, wurde Jahre später von berufener
Seite anerkannt. Leider sind jene Fundstücke durch Kriegseinwirkungen
verlorengegangen.
Die eigentliche Neuentdeckung der größeren Höhlenbereiche gelang
erst, als ein am Ende des bereits bekannten Lehmganges quer liegender
Felsblock durchbrochen werden konnte. - 1942 wurde Heinrich Decker
zur Wehrmacht eingezogen. Er kehrte leider nicht wieder in seine
Heimat zurück. Bernhard Klein blieb es überlassen, allein die
Erschließung "seiner Höhle" fortzusetzen.
Erst im Jahre 1949 wurde man auch seitens der Behörden auf die
Forschungsarbeiten von Bernhard Klein aufmerksam. Am 28. Oktober
1949 fand auf Anregung des Sauerländischen Gebirgsvereins, Bezirk
Unterlenne, eine Begehung der inzwischen durch Treppen und Leitern
erschlossenen Höhle statt. Unter Leitung von Bernhard Klein nahmen
seinerzeit Prof. Dr. Beck (Universität Münster), Stadtdirektor
Heinrich Kordes (Stadt Plettenberg), Rektor Rosendahl (Nachrodt)
sowie der Vorsitzende der damals noch existierenden SGV-Abteilung
Oestertal, Willi Arndts, an dieser Exkursion teil.
Wenige Wochen später, am 17. Dezember 1949, wurde die Höhle von
Professor Lotze, Münster, erstmalig wissenschaftlich untersucht
und beschrieben. Eine genaue Vermessung der gesamten Höhle sowie
die Erstellung eines Grundrisses erfolgte allerdings erst im Jahre
1988 durch Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst,
Hemer e.V., unter Leitung von Heinz Werner Weber (Hemer).
Wie so viele Höhlen des Sauerlandes ist auch die Heinrich-Bernhard-Höhle
vorwiegend durch Auslaugung des Kalkes entstanden. Wasser drang durch
das Gestein ein und erweiterte durch Auflösung des Kalkes zunehmend
die Klüfte und Spalten. Mit Sicherheit floss einst ein Bach durch
die Höhle, bis sich - bedingt durch den Einsturz von Teilen des
Deckgebirges - der gegenwärtige Taleinschnitt herausbildete, das
Erosionsniveau tiefer verlegte und der Bach Keuperkusen seinen
jetzigen Verlauf erhielt.
Beschreibung der Höhle
Am tiefsten Niveaupunkt der Heinrich-Bernhard-Höhle liegt in
einer Kluftspalte von ca. 25 Metern Länge ein kleiner, schmaler
See (27 Meter unter Eingangsniveau). Wasserfärbungen haben ergeben,
dass von hier aus unterirdische Verbindungen zum Bachlauf des
Keuperkusens außerhalb der Höhle bestehen, und der Wasserstand
den Schwankungen des Grundwasserspiegels unterworfen ist.
Ein vom tiefsten Höhlenpunkt ausgehender Seitengang ("Korallengang")
steigt steil auf in ein weiteres Gangsystem. Es ist streckenweise
verstürzt und durch eindringendes Oberflächenwasser sehr schlammig.
Dennoch zeigen sich gerade hier in diesem unwegsamen Höhlenbereich
seltene Abdrücke verschiedener Riffbilder sowie in versteckten
Seitenspalten Exentriques. - Die Gesamtlänge dieser Höhle beträgt
192 Meter, ihre Raumhöhe schwankt zwischen 1,10 Meter und 9,00 Meter.
Nach Prof. Lotze weist die "Heinrich-Bernhard-Höhle" gegenüber
anderen sauerländischen Höhlen folgende Besonderheiten auf:
Somit "weist die 'Heinrich-Bernhard-Höhle' in Plettenberg Eigenschaften
auf, wie sie gerade in den überlaufenen Touristenhöhlen nicht mehr
anzutreffen sind." (Dr. C. D. Clausen, Geologisches Landesamt NRW,
Krefeld, 28.04.1978).
Auf Vorschlag von Prof. F. Lotze wurde das einstige "Kruplouk",
bzw. die "Romberg-Höhle", im Jahre 1951 nach den Vornamen der beiden
Entdecker in "Heinrich-Bernhard-Höhle" umbenannt und durch den
Regierungspäsidenten in Arnsberg als Naturdenkmal ausgewiesen. Damit
erfuhren Heinrich Decker und Bernhard Klein - wenn auch spät - eine
Würdigung ihrer mehr als ein Jahrzehnt lang durchgeführten Forschungsarbeiten.
Leider kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gewaltsamen
Einbrüchen in die "Heinrich-Bernhard-Höhle" und zu umfangreichen
Zerstörungen im Höhleninneren. Die Mitglieder der "Arbeitsgemeinschaft
Höhle und Karst e.V. Hemer" haben mit großzügiger Unterstützung durch
die Stadt Plettenberg, den Sauerländischen Gebirgsverein und den
verschiedenen Naturschutzbehörden auf Kreis- und Landesebene versucht,
das Naturdenkmal durch den Einbau neuer Sicherungsanlagen vor weiteren
Zerstörungen zu schützen. Leider haben die mutwilligen Beschädigungen
auch 1994 nicht aufgehört! Somit verdeutlicht die Geschichte dieser
Höhle auch das Ausmaß gewaltsamer Zerstörungen eines einst reichhaltig
vorhandenen Naturinventars. Dem Gedanken des aktiven Höhlenschutzes
kommt daher eine besondere Bedeutung zu.
"Höhlen - Welt ohne Sonne!" (Prof. W. Bauer, Wien 1971) Sie zu erleben,
zu erforschen und zu erhalten sind die eigentlichen Motive und Ziele
aller "Lehm- und Kriechgefährten", wie sich der Kreis der Höhlenfreunde
in Plettenberg und Hemer gern nennt! Allen sei Dank, die sich für den
Erhalt unserer Naturdenkmäler aktiv einsetzen und auch weiterhin an
der Plettenberger "Heinrich-Bernhard-Höhle" interessiert sind!
Quellen-/Literaturnachweise:
Quelle: WDR I. Programm, Hörfunk, Donnerstag, 24.01.1985
Auch kleine Höhlen haben ihren Reiz
Sprecherin: Zu Beginn des heutigen Programms laden wir ein zu einem
Erkundungsspaziergang in eine Naturhöhle des Märkischen Sauerlandes . . . Das
märkische Sauerland - zwischen Iserlohn und Lüdenscheid - birgt eine Fülle
von Naturhöhlen. Einige von ihnen sind wegen ihrer einzigartigen Vielfalt
an Tropfsteinformationen dem Besucher dauerhaft zugänglich. Doch auch die
versteckt gelegenen, stets verschlossenen, kleineren Höhlen haben ihre Reize.
Über eine von ihnen, die Heinrich-Bernhard-Höhle bei Plettenberg, berichten
wir jetzt.
Mark vom Hofe: Wir stehen hier an einer kleinen, schmalen Brücke, einem
sehr wackeligen Steg über einem dahinplätschernden. Diese Brücke leitet uns
steil einen Berg hinan zu einer der vielen Höhlen im Märkischen Sauerland.
Niemand kennt diese Höhlen alle. Einige sind bekannt, darunter die Atta-Höhle
und die Dechenhöhle, doch diese kleine Höhle, um die wir uns jetzt bemühen
und für die wir und interessieren, ist die sogenannte Heinrich-Bernhard-Höhle.
Ich habe mir bei Herrn Martin Zimmer, einen begeisterten und interessierten
Höhlengänger. Herr Zimmer, was macht den Reiz und die Bedeutung dieser
Heinrich-Bernhard-Höhle aus?
Und damit erlebt er auch ein Stück Erdgeschichte des Sauerlandes. Diese Schau-
oder Besucherhöhlen liegen fast ausnahmslos in den mächtigen Formationen des
Sauerländer Massenkalkes aus der Zeit des Oberen Mitteldevons.
Mark vom Hofe: Wie alt ist das ungefähr, das Obere Mitteldevon?
Wieviel Jahre liegt das zurück?
Martin Zimmer: Ja man muss ungefähr ausgehen von einer Zahl 340 bis 380
Millionen Jahre, wobei es auf einige Jahre sicherlich hier nicht ankommt. Nun,
sie erwähnten bereits vorhin, dass neben diesen bekannten Schauhöhlen es noch
eine Vielzahl von weniger bekannten Höhlensystemen in der unterschiedlichsten
Ausdehnung gibt. Sie sind nicht einfach zu finden. Oft liegen sie versteckt.
Sie sind schwierig in der Begehbarkeit und deshalb auch nur von geübten und auch
entsprechend gut ausgerüsteten Höhlenwanderern zu begehen. . . .
Quelle: "Plettenberg, Industriestadt im märkischen Sauerland", 1962, S. 149 (Willi Arndts)
Heinrich-Bernhard-Höhle bei Oesterau
Die Höhle war schon 1934 bekannt, wurde aber erst in den Vorkriegsjahren
von Bernhard Klein und Heinrich Decker erforscht und erschlossen. Wer sich
ein Bild von der gewaltigen Arbeit dieser beiden Männer machen will, der
betrachte die große Lehmhalde vor der Höhle und überlege sich, dass
diese ca. 200 Meter lang ist und darin Höhenunterschiede bis zu 40 Metern
zu bewältigen sind. In vielen Arbeitsstunden haben Bernhard Klein und
Heinrich Decker die ganze Höhle geräumt; es war daher eine Anerkennung
ihrer Arbeit, als die Höhle nach dem Kriege unter Naturschutz gestellt
und nach den Erforschern "Heinrich-Bernhard-Höhle" genannt wurde.
Quelle: Süderländer Tageblatt vom 17.11.1949
Im Reich der Riesen und der Zwerge
von Rektor Gustav Rosendahl, Naturschutzobmann des SGV-Bezirks Unterlenne
Plettenberg-Oesterau Eine herrliche Höhle wurde von zwei
Männern in jahrelanger, mühevoller Arbeit erschlossen. Vor 15 Jahren
begannen Bernhard Klein und Heinrich Decker aus Oesterau eine
bis dahin nicht beachtete Höhle im Kalkgebirge des Oberdevon
einzudringen. Alle freien Stunden mussten dem idealen Werk
gewidmet werden, bis man endlich Aussicht auf Erfolg erwarten
durfte. Bis zum Jahre 1942 arbeitete man gemeinsam manche Nacht
im tiefen Schoß der Erde. Bei spärlichem Lampenlicht wurde der
Höhlenlehm entfernt, aber jede Schaufel sorgfältig untersucht,
ob nicht auch interessante Einschlüsse entdeckt würden.
Zeuge dafür, dass unsere Heimat schon vor mehr als 50.000 Jahren bewohnt war.
Werke riesiger, erdgestaltender Kräfte wir künstlerischer Zwergenarbeit zu bewundern.
Und dann stehen wir staunend und
bewundernd vor den schönen Tropfsteingebilden, die wie ein großer
Wasserfall an den Wänden hinabhängen oder vom Boden aus noch immer
in die Höhe "wachsen" oder von den Decken sich nach unten strecken.
Auch an feinen Gardinen haben es die Zwerge bei der Ausschmückung
der Höhle nicht fehlen lassen. Und wie glitzern die Kristalle des
Kalkspats an dem Felsgestein! Interessante, formenreichste
Kleinbildungen der Tropfsteine erfreuen wieder an anderen Stellen
das Auge des Beschauers.
Ein Höhenunterschied von etwa 45 m musste auf den Leitern, die Bernhard
Klein sicher einbaute, überwunden werden. Wenn dann der Blick nach
oben schweift und die Felsen vom Licht der Azethylenlampe auch nur
dürftig erhellt werden, so ermisst der Mensch an der gigantischen
Wunderwelt, die sich vor seinem Blick auftut, seine ganze zwergenhafte
Kleinheit. Etwa 150 bis 200 m weit kann man in diese herrliche
unterirdische Welt eindringen.
Es ist zu vermuten, dass der Hauptraum der Höhle noch gar nicht erschlossen ist;
Der Bezirk Unterlenne des SGV nahm sich der verdienstvollen Sache
an, und der Verfasser machte dem Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte
in Münster wie dem Regierungsbezirk Arnsberg, Lienenkämper, Meldung.
Am 28.10.1949 fand
die erste offizielle Begehung der Höhle
Herr Stadtdirektor Kordes versprach, sich für den Schutz der Höhle
einzusetzen und vor allen Dingen eine Stahltüre und weiteres Material
für die Sicherung des Einganges zur Verfügung zu stellen; denn es ist
beschämend, wie rohe Hände in dem Wunderwerk der Höhle vernichtend
wirkten. 64 DM gab Klein bereits allein für immer wieder zertrümmerte
Vorhängeschlösser aus. Eine Azethylenlampe wurde ihm beim Einbruch
in die Höhle zerschlagen , mehrere Kilogramm Azethylen durch die Höhle
gestreut, manches schöne Tropfsteingebilde freventlich zertrümmert.
Hoffentlich wird den Rohlingen das weitere Eindringen bald unmöglich
gemacht. Der Naturschutzbeauftragte für Arnsberg konnte am Tage der
Begehung leider nicht erscheinen. Er wird sich die Höhle bald ansehen
und sie dann unter Naturschutz stellen.
Bernhard Klein und Heinrich Decker aber haben sich durch die Erschließung
der Höhle ein Denkmal gesetzt, und jeder Heimatfreund wird ihnen für
den der Heimat geleisteten Dienst danken.
Quelle: "Unterirdische Zauberreiche des Sauerlandes", Heinrich Streich,
1967, S. 108-111
Heinrich-Bernhard-Höhle
Vom Ortsteil Lettmecke (Stadt Plettenberg) wandern wir auf der Hauptstraße
Richtung Attendorn. Etwa 200 Meter hinter der Straßengabel, welche rechts
nach Herscheid, links nach Attendorn führt, verlassen die Attendorner
Landstraße und biegen links in ein hübsch gelegenes Tal ein. Nach etwa
20 Minuten Fußmarsch, vorbei am neuen Forsthaus, erreichen wir links am
Wege das kleine Wasserwerk der Stadt Plettenberg. Hier steigen wir die
Stiege hinab, überqueren den Bach, bewegen uns links über Treppenstufen
aufwärts und erreichen unverkennbar den im Felsgestein schön hergerichteten
Höhleneingang.
Die Höhle ist normalerweise verschlossen, doch erhalten wir den Schlüssel
im neuen, oben erwähnten Forsthaus oder bei Herrn Bernhard Klein in
Plettenberg-Oesterau, Oestertalstr. 43.
Die Höhle verläuft zunächst auf einer Erstreckung von 50 Meter annähernd
waagerecht, dann erfolgt ein Abstieg von 12 Meter über mehrere Sprossenleitern.
Danach verläuft der Gang leicht abwärts. Nach etwa 15 Metern von der Eisenleiter
entfernt befindet sich rechter Hand ein langgestreckter Teich in einer
Spalte, welcher, durch Grundwasser bedingt, wechselnde Ausmaße hat und sich
dem romantischen tiefsten Höhlenteil schön einfügt. Nach links steigt von
dieser Stelle der Höhlengang um etwa 10 Meter aufwärts und endet hier in
einem schmalen, noch unerforschten Teil. Im Gang linker Hand große
Korallen-Abdrücke.
Die Befahrung der Höhle ist leicht und bereitet auch das Durchfahren des
Steilstückes mittels der fest eingemauerten Leiter keine Schwierigkeiten.
Die Höhle, die inzwischen unter Naturschutz gestellt worden ist, weist
gegenüber anderen westfälischen Höhlen folgende Besonderheiten auf:
1. "Während die übrigen Tropfsteinhöhlen des Sauerlandes in dem
dem Oberen Mitteldevon angehörenden Massenkalk liegen, befindet sich die
Heinrich-Bernhard-Höhle in einem tiefmitteldevonischen Korallenkalk. Es
handelt sich bei dem Kalk ganz offenbar um den Ansatz zur Bildung eines
Korallenriffes auf einem ganz flachen, küstennahen Meeresboden. Das Riff
konnte sich aber nicht voll entfalten, weil immer wieder sandige und
tonige Einschwemmungen das Wachstum der Korallen störten.
Die Höhle enthält noch schöne Tropfstein- und Sintergebilde. Auch der
Fotofreund findet noch dankbare Objekte.
Quelle: Naturschutz in Westfalen, 10. Jahrgang 1950
Die neuentdeckte Tropfsteinhöhle
F. Lotze, Münster
Der Arbeiter Bernhard Klein in Plettenberg hatte bereits seit 15 Jahren
das Vorhandensein einer Höhle in einem felsig hervortretenden Kalksteinzug
südlich des Buerhahns, einer Anhöhe östlich von Lettmecke, vermutet.
Seit 1934 hat er dann zusammen mit dem Arbeiter Heinrich Decker systematische
Untersuchungen durchgeführt. Durch Abräumen von Gesteinsmassen wurde der
Höhleneingang freigelegt und eine zunächst schmale Spalte aufgeschlossen.
Dadurch wurde der Zugang zu der eigentlichen, teilweise recht geräumigen
Höhle geschaffen.
Diese selbst wurde durch Schlagen von Stufen, durch Erweiterung niedriger
Teile und Einbau von Leitern mit Geländer auf beträchtliche Erstreckung
begehbar gemacht. Es ist eine bewundernswerte Arbeit, die so von den beiden
Männern geleistet wurde; sie könnte eine gewisse Anerkennung dadurch finden,
dass wir die Höhle als "Heinrich-Bernhard-Höhle" (nach den Vornamen der
beiden Entdecker) benennen.
Man gelangt zu der Höhle von Lettmecke aus, einem Ortsteil von Plettenberg,
durch das Tal, das bei Punkt 284 (Meßtischblatt Attendorn) von Osten her
in dasjenige des Nuttmecker Baches ein mündet. Nach etwa 600 Metern gabelt
es sich. Man geht dann in dem nördlichen Talast in südöstlicher Richtung
weiter, seinen Windungen folgend, und gelant nach ca. 750 Meter an eine
Stelle, wo von Nordosten her ein steiles Seitentälchen einmündet. Hier findet
sich linker Hand (nördlich des Weges) ein kleiner verlassener Kalksteinbruch,
und am steilen Hang darüber treten Kalke, z. T. Felsklippen bildend, zutage.
In diesen befindet sich die Höhle.
Es handelt sich bei den Kalken um eine Einschaltung in den Hobräcker Schichten
des Unteren Mitteldevons. Das Kalkvorkommen ist auf Blatt Attendorn der
"Geologischen Spezialkarte von Preußen 1 : 25.000" verzeichnet (vergl.
Abbildung). Es hat hiernach nur eine verhältnismäßig geringe Erstreckung.
Vom Talgrund aus zieht es sich in nordnordöstlicher Richtung etwa 100 Meter
weit hin und wird dann von einer Verwerfung abgeschnitten. Nördlich derselben
setzt es, ca. 100 Meter nach Westen verschoben, wieder auf, um nach 120
Metern an einer weiteren Verwerfung zu endigen.
Die schätzungsweise 20 - 30 Meter mächtige, ziemlich steil gegen Südosten
geneigte Kalkbank wird vorwiegend aus Organismen, und zwar insbesondere aus
Riffbildnern wie Stromatoporen, Tabulaten und Tetrakorallen aufgebaut. In
der Höhle sind Korallenstöcke vielfach zu sehen und durch die Auswaschung
z. T. aus dem Gestein schön herauspräpariert. Es handelt sich bei dem Kalk
also ganz offenbar um den Ansatz zur Bildung eines Korallenriffes auf einem
ganz flachen, küstennahen Meeresboden. Das Riff konnte sich aber nicht voll
entfalten, weil immer wieder sandige und tonige Einschwemmungen das Korallenwachstum
störten. So sind denn auch die Kalkschichten sehr unrein und vielfach, besonders
im tieferen und höheren Teil, stark von Grauwackenmaterial durchsetzt.
Die Höhle, deren Eingang etwa 20 Meter über Talsohle liegen mag, ist durch
die Auslaugung dieses Kalkes entstanden. Der Kalk bildete wahrscheinlich ehedem
eine steilere, felsige Talstufe, über die das Wasser von Nordosten und
Südosten kommenden Bäche hinabfloss. Dieses drang durch die vorhandenen
Gesteinsklüfte in das Kalkgebirge und erweiterte durch Auflösung des Kalkes
während langer Zeiträume allmählich die Klüfte zu Spalten und schließlich
zu der geräumigen Höhle von heute.
Zeitweilig mag der gesamte Bach seinen Weg durch die Höhle genommen haben,
bis sich - vielleicht z. T. durch Einsturz von Höhlenteilen - der heutige
Taleinschnitt herausbildete, das Erosionsniveau tiefer verlegte und der
Bach seinen jetzigen Lauf erhielt.
Dieser Entstehung gemäß folgt die Höhle genau dem Streichen der Kalkzone in
nordnordöstlicher Richtung. Nach schmälerem, etwas gewundenen Eingang,
folgt eine starke Verengung; alsbald aber erweitert sich die Höhle zu
einer geräumigen Halle. Diese ist z. T. mit ansehnlichen Tropfsteinbildungen,
größeren Stalagtiten und einzelnen Stalagmiten, besetzt. Sie bilden sich
heute größtenteils nicht mehr weiter, ja, eine größere, von Sickerwasser
überflossene Sintermasse im vorderen Teil der Höhle zeigt sogar beträchtliche
Korrosionserscheinungen, und das Wasser hat hierin eine tiefe Furche
ausgewaschen.
Auf etwa 30 bis 40 Meter Länge (vom Eingang aus berechnet) bleibt die Höhle
etwa im gleichen Niveau. Die weitere Fortsetzung geht recht steil in die
Tiefe. Unten senkt sich die Höhlensohle weiter flacher gegen Nordosten ab.
Im Gegensatz zu dem höheren, mit Tropfsteinen etwas reichlicher geschmückten
Höhlenteil ist dieser untere arm an solchen und überhaupt recht trocken.
An einzelnen Stellen sitzen auf den Wänden seitwärts gewachsene, büschelförmige
Kalzitgebilde, die sich nicht aus freiem Sicker- und Tropfwasser, sondern
aus der "Bergfeuchtigkeit" und dem in den Felsklüften vorhandenen "Schwitzwasser"
abgeschieden haben.
Andrerseits zeigen diese tieferen Höhlenpartien sehr eindrucksvolle
Erosionsformen, die das die Höhle ehedem durchfließende Wasser ausgewaschen
hat. Sehr bizarre, schroffe und zackige Felspartien erzeugen den Eindruck
einer wilden Zerrissenheit.
Von der untersten Stelle aus, bis zu der ich bei meinem Besuch am 17.12.1949
gelangen konnte, führen schräg aufwärts weitere Höhlengänge, deren obere
Teile sparsam mit Tropfsteinen und daneben mit "Kalzitbüscheln" besetzt sind.
Diese Tropfsteine scheinen, wenigstens zum Teil, heute noch weiter zu wachsen.
In den nördlichen Teilen der Höhle scheint der Kalk teilweise dolomitisiert
zu sein. Man kann das als Hinweis auf die Nähe der Verwerfungszone werten,
die die nördliche Begrenzung der Kalkbank darstellt; solche sekundären
Dolomitisierungen pflegen ja vielfach von Verwerfungsspalten auszugehen.
Überhaupt erklärt sich das unvermittelte In-die-Tiefe-setzen der Höhle am
leichtesten durch die Nähe der Verwerfungszone.
Hinsichtlich der Tropfsteinbildung lassen sich drei übereinander liegende
Stockwerke unterscheiden:
Diese Verhältnisse stehen offenbar mit dem Wasserhaushalt in Zusammenhang:
im unteren Teil fehlt Tropfwasser fast ganz, im mittleren Teil ist es an
Kalk gesättigt, so dass sich daraus bei der Verdunstung Kalk ausscheidet,
im oberen ist es ungesättigt bzw. reich an freier Kohlensäure, so dass es
hier auflösend wirkt.
Die Höhle, die inzwischen unter Naturschutz gestellt worden ist, weist
gegenüber anderen westfälischen Höhlen folgende Besonderheiten auf: |