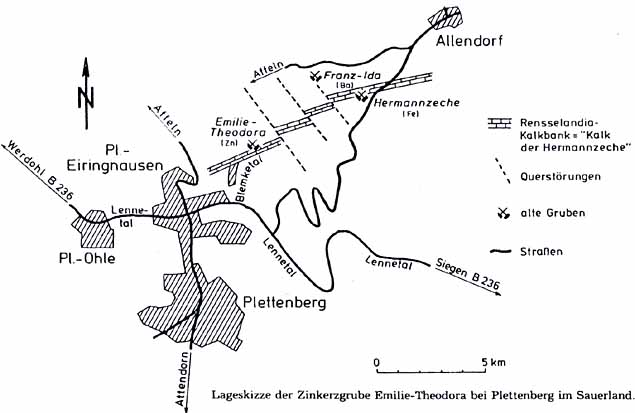|
Quelle: "Der Aufschluss", Jahrgang 25, Heft 11/1974
Die Zinkerzgrube Emilie-Theodora
Von Reinhard Schaeffer, Clausthal
Auch abseits der bis heute bzw. bis in die jüngste Vergangenheit gebauten
Lagerstätten von Meggen und Ramsbeck im Sauerland ging in der
Vergangenheit ein intensiver Erzbergbau um, so auch im Gebiet der ehemals
freien Bergstadt Plettenberg an der Lenne. Nachrichten darüber sind schon
wieder ziemlich in Vergessenheit geraten, hier soll insbesondere über die
von mir seit 1969 näher untersuchte Grube Emilie-Theodora - die bedeutendste
der Plettenberger Gruben - berichtet werden, auch wenn man heute dort
keine Schaustufen mehr findet.
Die ehemalige Erzgrube liegt nördlich der Lenne und des Plettenberger Stadtteils
Blemke an der Nordflanke des aus silurischen und unter- und mitteldevonischen
Schichten aufgebauten Ebbesattels. Die speziell im Blemketal und seiner
näheren Umgebung abgelagerten Schichten des Eifel und Givet sind von zahlreichen
Querverwerfungen gestört, die als Zubringerwege für die Erzlösungen dienten.
Emilie-Theodora ist nun die weitaus bedeutendste aller in diesem Gebiet
befindlichen gang- und lagerförmigen Vererzungen und zeichnet sich gegenüber
den wirtschaftlich unbedeutenden Vererzungen auf den Querverwerfungen durch
eine besondere Erzanreicherung und Regelmäßigkeit aus.
Das Zinkerzlager ist an einen NE-streichenden und mit 35-50 Grad S einfallenden
Kalk innerhalb des Rensselandia-Sandsteins (mittleres Givet) gebunden, der in
der neueren Literatur als "Kalk der Hermannszeche ausgeschieden wurde. Nur diese
5 bis 10 Meter mächtige Kalklage wurde metasomatisch vererut, erhalten gebliebene
Kalkreste sind dolomitisiert, und das Nebengestein wurde später durch die bei
der Oxidation entstandene Schwefelsäure in einen gelben, sandigen, sulfatreichen
Ton umgewandelt.
Im unteren Blemketal, unweit der Stadt, tritt dieser Kalk erzfrei und unzersetzt
auf, ebenso in einem kleinen Steinbruch bei Hagen im Sorpetal, weit östlich nur
noch mit geringer Brauneisenführung; durch diese beiden Punkte ist das westliche
und östliche Ende der Erzführung ungefähr anzugeben.
. . .
In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts fand dann ein ziemlich
planloser Abbau aus mehreren kleinen Haspelschächten und Tagebau auf das ausgehende
Lager statt. 1865 bestand die Grubenbelegschaft aus einem Steiger, einem Zimmerhauer,
10 Hauern, 6 Haspelziehern, 6 Schleppern, 3 Anschlägern, 3 Schürfern und 3
Aufbereitern. In diesem Jahr wurden 2400 t Erz gefördert. 1867 wurde dann der
eigentliche Tiefbau begonnen und die Grube ausgebaut. Der heute noch sichtbare
Förder- und Wasserlösungsstollen wurde auf 200 Meter aufgefahren und vor Ort
dann der 63 m tiefe Maschinenschacht abgeteuft. Unterhalb der Förderstollensohle
wurden von ihm aus zwei weitere Sohlen aufgefahren, auch zwei Wetterschächte
wurden abgeteuft.
Weiter wurde eine Aufbereitung gebaut, deren Setzmaschine, Setzsiebe und Trommeln
von einer Dampfmaschine betrieben wurden, auch die Wasserhaltung im Schacht wurde
wurde durch eine weitere Dampfmaschine besorgt, drei Waschteiche wurden aufgeschlossen,
der Förderstollen auf 500 m aufgefahren und in diesme Jahr 6.100 t Erz abgebaut.
Die Grube war weiterhin in gutem Betrieb, bis 1878 Wasser der Aufbereitung in einer
weiter im Tal liegenden Papierfabrik Schäden anrichteten und der Betrieb nach einem
verlorenen Prozess stillgelegt werden musste. Danach kam trotz mehrerer Versuche
kein größerer Bergbaubetrieb mehr zustande, 1883 wurde das Bergwerk endgültig
verlassen und alle Gebäude abgebrochen.
1935/36 wurden Untersuchungsarbeiten erwogen, dann aber bis auf einige Tiefbohrungen
doch nicht durchgeführt. Der allein heute noch erhaltene Förderstollen dient jetzt
der Stadt Plettenberg als Wasserwerk (Anm.: der Wassergenossenschaft Eiringhausen).
Die Grube erbachte in ihrer Blütezeit einen Gewinn von 22 Reichstaler im Jahr pro Kux,
es wurden auch Freikuxe für die Erhaltung von Kirche und Schule und für die Armen
der Gemeinde ausgegeben. Die Plettenberger Zinkgewerkschaft wurde später von der
Handelsgesellschaft Grillo in Duisburg übernommen, die den gesamten Felderbesitz
noch heute innehat.
Heute wächst wieder Wald auf den alten Halden. Mit einigem Glück kann man vor allem
in der Nähe des Stollenmundlochs noch manches Stück Erz finden, vor allem Kleinstufen
mit braunem Glaskopf, traubigen, weißem Hydrozinkit, Calcit xx, Hemimorphit xx und
Markasit xx.
Quelle: "Bergbau im Bereich des Amtsgerichtes Plettenberg", Fritz Bertram, 1952-1954, S. 63 ff
6. Emilie - Zinkerzgrube in der Blemke
Wie ich schon oben erwähnte, sind die beiden Gruben Emilie und Theodore
die Keimzelle der später begründeten Plettenberger Zinkgewerkschaft.
Diese Gewerkschaft entstand durch Zusammenschluss mehrerer Zechen im
Laufe der Zeit, die Namensgebung zur "Plettenberger Zinkgewerkschaft"
war dann am 03.06.1876. Vor diesem Gründungsdatum arbeiteten die
verschiedenen auf den Vorderseiten aufgezählten Gruben in einer mehr
oder weniger engen Interessengemeinschaft. Und so waren es die beiden
Zinkerzgruben Emilie und Theodore, die diese Gemeinschaft begründeten.
Von diesen beiden ist die Grube Emilie die ältere Fundstelle. Die
Muthung wurde eingelegt am 05.10.1852. Da der Fundschacht sehr schnell
voll Wasser lief, hatte man das Lager durch einen Stollen aufgeschlossen,
der 33 Lachter vom Fundschacht entfernt angefahren wurde. Am Endpunkt
des Stollens fand sich eine Schicht Grauwackenschiefer, die mit 40 Grad
nach Osten einfiel und ein Streichen in h W 1 hatte. Auf diesem Grauwackenschiefer
war eine anscheinend sandige und etwas lehmige Masse aufgelagert, und
in dieser Schicht fand man ein Mineral, welches teils aus traubigen,
nierenförmigen Gestalten bestand, teils drusig und derb war. Die Farbe
war grünlich-gelblich, teils ockergelb mit weißem Strich, und man erkannte
das Mineral als Kieselgalmei (Zinkerz). Der oben erwähnte Fundschacht
selber lag in h 4 421 Lachter vom Haus Kahlberg entfernt.
Man findet heute noch Überreste dieses Schachtes, wenn man 250 Schritte
auf dem Fußweg durch die Blemke nach Allendorf geht, gerechnet von der
Stelle ab, wo der Weg zur Hespe abzweigt. Am linken Berggehänge kann man
die alten Bauen dieses Fundschachtes erkennen, und rund 65 Meter talabwärts
findet man auch noch Überreste des angefahrenen Stollens.
Das Galmeilager war 8 - 9 Fuß mächtig, darüber fanden sich im Hangenden
Toneisensteinknollen in lettiger Masse. Genau südlich dieser Lagerstätte
hatte man einen Versuchsort aufgefahren, welcher in seiner ganzen
Schachtgröße von 6 Fuß Höhe in einem derben, mit etwas Lette untermischten,
ziemlich edlen Erzmittel anstand. Die Analyse ergab einen Zinkgehalt
von 40,54 - 36,45 Prozent Zink. Die Verleihung geschah am 08.11.1858.
Am 18.10.1864 konnte man bei einer bergamtlichen Besichtigung auch
Bleierz vorweisen und eine entsprechende Muthung einlegen. Die Verleihung
auf Ausbeute der anstehenden Bleierze wurde am 22.10.1864 erteilt (Quelle:
GbA Plettenberg).
Der Fundpunkt Theodore wurde am 06.02.1863 gemuthet . . .
In der Arbeit Schlüter/Wientzek (Bergbau im MK, 1993) findet sich
ein Quellenhinweis auf Heinrich Streich, S. 88:
|