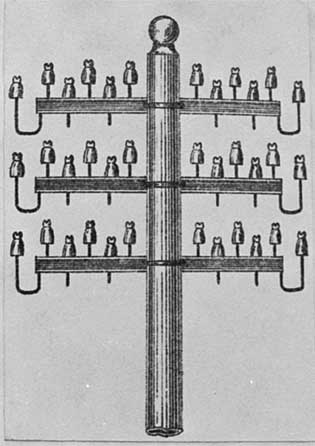Fernsprechgeschichte der Stadt Plettenberg
© Gerd-Wilhelm und Angelika Klaas
Herausgegeben im Selbstverlag zum 600 jährigen Stadtjubiläum der Stadt Plettenberg 1997
Auflage: 60 Exemplare
Inhalt
1. Telegraph
2. Bauweise der Telegraphenlinie
3. Technik
4. Betrieb
5. Kosten für ein Telegramm nach Amerika
6. Aufnahme des Telephonverkehrs in Plettenberg
7. Erstes Telephonverzeichnis von Plettenberg
8. Statistik 1900
9. Teilnehmer der Stadt-Fernsprecheinrichtung 1903
10. Statistik 1903
11. Aufnahme des Telephonverkehrs in Plettenberg
12. Gewerkschaft
13. Wie wurde man Fernsprechteilnehmer
14. Grundstückseigentümererklärung
15. Bestallungsurkunde der Telegraphen- Gehilfin Maria Höfer 1918
16. Gemeinde Öffentliche Sprechstellen
17. Statistik der Einnahmen und der vermittelten Gespräche 1916 - 1920
18. Prüfung der Kriegswichtigkeit
19. Plettenberger Telephonanträge von 1900 - 1949
20. Telefonapparate
21. Wie wurde telefoniert
22. Fernsprechverzeichnis Plettenberg und Umgebung 1929 - 1930
23. Statistik Fernsprechverzeichnis 1929 -1930
24. Morse Farbfernschreiber wird nicht mehr benutzt
25. Fernsprechanschlüsse Plettenberger Juden und von Jakob Kurth
26. Nationalsozialistische Zeit 1933 - 1945
27. Gaudiplom für hervorragende Leistung
28. Umbenennung von Straßen durch die Nazis
29. Plettenberger Telefonbuch 1941
30. Statistik Amtliches Fernsprechbuch 1941
31. Prüfung der Kriegswichtigkeit
32. Neues Postamt am Maiplatz
33. Als die Amis einmarschierten 12. April 1945
34. Amtliches Fernsprechbuch 1946
35. Verzeichnis der Rufnummernänderung -
36. Amtliches Telefonbuch, Plettenberg 1950
37. Statistik Amtliches Telefonbuch 1950
38. Ausbildung bei der Deutschen Bundespost
39. Heimleiter
40. Arbeitszeit
41. Berufsschule
42. Dienstsport
43. Berichtshefte
44. Verpflegung
45. Ausbildungsinhalte
46. Fernmeldebautrupp Plettenberg
47. Sprechstellenbau
48. Nebenstellenbau
49. Verstärkerstelle
50. Fernsehsender Nordhelle (Rehberg)
51. Studium Siegen-Gummersbach
52. Studium Darmstadt, Kleinheubach, Düsseldorf
53. Planungstelle Linientechnik Hagen
54. Planungsstelle Amtstechnik Hagen
55. Organisationsstelle Hagen
56. Beratung und Verkauf bis 1981 in Lüdenscheid und Hagen
57. Statistik der Telefonanschlüsse in Plettenberg
58. Drahtfunk
59. Telefax
60. Vergleich der Fixkosten Fernschreiber / Fernkopierer 1981
61. Gebühreneinheiten im acht Minuten Takt
62. Treffen der ehemaligen Fernmeldelehrlinge im Böddinghauser Hof
63. Funktelefon
64. Radio
65. Fernsehen
66. Öffentliche Fernsprechzellen
67. Englische Telefonzelle am Alten Markt
68. Fernsprechanschluß in der Gräwestraße
69. Literaturhinweise
Telegraph
© Gerd-W. Klaas
Am 1. Juli 1876 wurde Plettenberg mit anderen Städten in Westfalen verbunden.
Von Siegen über Weidenau, Kreuztal, Grevenbrück, Plettenberg, Werdohl,
Altena nach Iserlohn wurde entlang der Bahnlinie (Bergisch- Märkische Eisenbahn)
eine Telegraphenleitung gebaut, über die der Telegraphenbetrieb mit
Morseschreiber abgewickelt wurde. Das Postamt Plettenberg und die Post in Eiringhausen
waren ebenfalls an die Telegraphenverbindung angeschlossen. Telegramme wurden
seinerzeit nach Siegen weitergeleitet. Der Telegraphenbetrieb wurde in Holthausen
am 1. Mai 1893 eingerichtet. Im Jahr 1879 wurden die Telegraphenverbindungen von
Plettenberg nach Dortmund, Herscheid und sämtlichen Postämtern des
Lennetals hergestellt.
Bauweise der Telegraphenlinie
Sechs bis zehn Meter lange Telegraphenmasten wurden ca. 1 m bis 1,6 m tief
ins Erdreich eingebaut. An diesen Masten waren Querträger aus Eisen montiert.
An diesen Querträgern wurden Isolatoren angebracht. Der Leitungsdraht bestand
aus 2,5 mm starkem Bronzedraht oder aus Eisendraht. Der Bronzedraht wurde mittels
Kupferdraht am Isolator befestigt. Oftmals wurden statt einfacher Masten sogenannte
A-Masten zur Stabilisierung der Strecke eingebaut. Ebenso wurden an den Telegraphenmasten
bei Richtungsänderungen Stützen aus Holz oder Draht angebracht.
Technik
Die ersten Telegraphenapparate wurden mit nur einer Leitung betrieben. Als Rückleitung wurde die Erde benutzt.
Betrieb
Der Telegraph wurde an erster Stelle für den Bahnbetrieb und für
staatliche Stellen benutzt. Privatpersonen wurden später auch zugelassen.
Im Directionsbezirk Cöln ist die Eisenbahn- Telegraphenstationstation Menden
der Königlich Elberfelder Eisenbahn, Zweigbahn Fröndenberg- Menden,
ist für den Privat- Depeschenverkehr eröffnet.
Telegramme wurde mit Telegraphen- Freimarken bezahlt. Ab Oktober 1872 wurden
die Telegraphen- Freimarken mit der Aufschrift Norddeutsche Bundes- Telegraphie
ungültig.
Vom 1. November des Jahres 1872 wurden neue Telegraphen- Freimarken
eingeführt, welche im Wesentlichen die Form und Zeichnung der bisherigen
Freimarken haben, aber mit der Umschrift „Telegraphie des Deutschen Reichs“
versehen sind und die Wertbezeichnung „Groschen“ in schwarzem, statt bisher
weißem Überdruck erhalten.
Für das Publikum ist noch anzumerken, daß die Sibirischen Linien
bis Wladiwostock wieder hergestellt sind, dagegen ist eine Unterbrechung
des Kabels Wladiwostock - Nagasaky eingetreten.
Telegramme nach Südamerika werden nur bis Cuba mit dem Telegraphen zugestellt.
Danach werden sie mit dem Dampfboot befördert. Ein Zuschlag von 4 Talern
und 5 Silbergroschen ist zu erheben.
Kosten für ein Telegramm nach Amerika
Im Jahre 1872 konnten Privatdepeschen bis nach Amerika aufgegeben werden. Gewöhnliche Privatdepeschen sind solche, welche entweder ausschließlich aus Worten oder aus derartig geordneten Worten Zeichen und Buchstaben bestehen, dass ihr Sinn dem Annahme- Beamten verständlich ist. Die Gebühr für die Beförderung einer Depesche für 10 Worte kosteten von Brest oder London nach New York, 13 Taler und 10 Silbergroschen. Es müssen noch die Gebühren von Plettenberg nach Brest oder London hinzugerechnet werden. Hinzu kommt noch, daß das Telegramm zuvor nach Menden oder Dortmund mit der Postkutsche befördert werden mußte. Privatdepeschen konnten ab 1876 mit der Bergisch- Märkischen- Eisenbahn- Telegraphenstationen befördert werden. Menden- London oder Brest über Borkum 1 Taler 14 Silbergroschen Zuschlag.
Ein normal Sterblicher konnte sich diese ungeheure Summe nicht leisten.
Am 2. März 1898 wurde die Stromversorgung in Plettenberg eingeschaltet. Die Leitungen wurden vom Siesel bis in die Stadt als Freileitung geführt.
Bürgermeister Posthausen hatte der Oberpostdirektion Dortmund zwei Tage vorher versichert, daß „zur Inbetriebnahme der elektrischen Hochspannungsanlagen wird nicht eher die Genehmigung erteilt, bis durch Organe der Oberpostdirektion, durch Versuche festgestellt worden ist, daß die Schutzvorschriften den Reichstelegraphen- und Fernsprechleitungen vollständige Sicherheit gewährt wird.“
Die Stadt verpflichtete sich per Vertrag vom 16. Juli 1897, die Telegraphenlinie vom Postamt bis zum Kersmecker Weg und vom Postamt bis zum Kirchlöh (Gasthof Schwarzenberg) unterirdisch ein Meter tief, 75 cm von der Straßenrinne entfernt zu verlegen.
Diese Telegraphenlinie ging vom Postamt bis zum Bahnhof in Eiringhausen.
Die Aufnahme der Stromversorgung war die Voraussetzung dafür, daß der Fernsprechverkehr aufgenommen werden konnte.
ST 25. Januar 1898
Nach einer Mitteilung der Kaiserlichen Oberpostdirektion in Dortmund werden wir
durch die demnächst einzurichtende Fernsprechanlage mit folgenden Orten
sprechen können:
Werdohl, Lüdenscheid, Altena (Westf.), Gevelsberg,
Siegen, Arnsberg, Neheim, Menden (Bez. Arnsberg), Iserlohn, Barmen, Elberfeld,
und den zum niederrheinisch- westfälischen sowie zum bergischen
Bezirks-Fernsprechnetz gehörigen Orte Bochum, Borbeck, Dortmund, Duisburg,
Essen/Ruhr, Gelsenkirchen, Hagen (Westf.), Herne, Mühlheim/Ruhr,
Oberhausen/Rhld., Ruhrort, Steele, Werden/Ruhr, Witten, Lenne, Ohligs,
Radevormwald, Remscheid, Ronsdorf, Schwelm, Solingen, W.- Vohwinkel,
Wermelskirchen. Eine etwaige weitere Ausdehnung des Sprechverkehrs bleibt
für spätere Zeit vorbehalten. Zur beschleunigten Ausführung
der Anlage dürfte es sich für die Interessenten empfehlen,
ihre Meldungen behufs des Anschlusses umgehend bei dem hiesigen Postamt zu
machen.
Aufgrund dieser Anzeige meldeten einige Firmen ihr Interesse an einen
Fernsprechanschluß an. Zum Beispiel Wilh. Allhoff in Fa. Allhoff u. Müller,
Draht u. Schraubenfabrik, Grünestr. 16.
ST 10.Februar 1898
In Ergänzung unserer früheren Notiz über die Fernsprecheinrichtung
hierselbst, bringen wir im Folgenden ein Verzeichnis der Ortschaften, in Verkehr
mit welchem für jedes gewöhnliche Gespräch bis zur Dauer von drei
Minuten eine Gebühr von 25 Pfennig erhoben wird. Es sind die innerhalb eines
Umkreises von 50 km gelegenen Orte: Werdohl, Lüdenscheid, Altena, Gevelsberg,
Siegen, Arnsberg, Neheim, Menden, Barmen, Iserlohn, Dortmund, Hagen, Witten, Lenne,
Radevormwalde, Remscheid, Ronsdorf, Schwelm und Wermelskirchen.
ST 16. März 1899
Seitens der Oberpostdirektion zu Dortmund ist den hiesigen Interessenten die
Mitteilung zugegangen, da die Fernsprechanlage für Plettenberg nunmehr dem
Reichspostamt empfohlen ist. Die Anlage würde voraussichtlich mit der in
Werdohl zu gleicher Zeit ausgeführt werden.
ST 1. Mai 1899
Der Fernsprechverkehr mit Berlin von Altena, Gevelsberg, Hamm, Iserlohn, Lippstadt,
Lüdenscheid, Siegen und Soest ist eröffnet worden
Anno Domini 1900 klingelte das erste Telephon in Plettenberg
Nachdem genügend Anträge auf ein Fernsprecher, so die damalige offizielle Bezeichnung für ein Telefon, vorlagen wurde im damaligen Postamt ein Vermittlungsschrank aufgebaut. Das war damals eine kostspielige Angelegenheit, die sich nur wohlhabende Bürger leisten konnten. Ein „Fräulein vom Amt“ mußte jedes Gespräch vermitteln, wobei es zunächst ein solches Fräulein noch nicht gab. Dem Postvorsteher oder seinem Stellvertreter war es vorbehalten, die gewünschte Verbindung herzustellen. Vom Postamt wurden in alle Richtungen Telefonleitungen ab. Zuerst wurden diese 1,5 mm starken Bronzeleitungen oberirdisch geführt. Über 100 Bronzeleitungen „verdunkelten“ den Himmel.
Gespräch führen
Um ein Gespräch zu führen mußte man die handgekurbelten Apparate, die an der Wand hingen, bedienen.
Zuerst mußte man den Hörer, der noch nicht mit dem Mikrophon vereint war, vom Harken nehmen. Alsdann kurbelte man mit der Hand. Dieses Kurbeln bewirkte, das am Vermittlungsschrank im Postamt eine Klappe fiel und ein Schnarrton zu hören war. Der Postvorsteher ging zum Vermittlungsschrank und fragte nach der gewünschten Verbindung. Nachdem die gewünschte Verbindung mit dem Klinkenstecker gesteckt war kurbelte der Vorsteher den gewünschten Gesprächspartner an. Beim Gesprächspartner klingelte der Wecker am Telefon. Der Kunde nahm den Hörer ab und meldete sich z.B. mit „Hier Firma Oderwald“.
Der Postvorsteher fragte:“ Soll ich Sie mit dem Teilnehmer Klaas verbinden. Wenn das die Firma Oderwald bejahte, stöpselte (vermittelte) der Postvorsteher die beiden Gesprächspartner zusammen. Der Postvorsteher betätigte die Telefonuhr und schrieb einen Gebührenzettel aus. Nach dem Gespräch kurbelte der Teilnehmer Klaas mit seinem Apparat und der Postvorsteher trennte die Stöpselverbindung. Die Gesprächszeit wurde ermittelt und auf dem Gebührenzettel vermerkt. Die Gebührenzettel wurden abgeheftet und am Ende des Monats dem Teilnehmer in Rechnung gestellt.
Nach dieser Art der Vermittlung ist jedem klar, daß Gespräche nur während der Öffnungszeiten des Postamtes geführt werden konnten.
Das „Fräulein vom Amt“ hieß offiziell Telegraphengehilfin.
Am 1. November 1900 wurde mit 41 Teilnehmern der Fernsprechverkehr in Plettenberg aufgenommen.
Frommann veröffentlichte u. a. im Süderländer Tageblatt (75. Jubiläumsbeilage), das es in Ohle vor 1900 Telefon gab. In der Stadtchronik wurde die falsche Jahreszahl übernommen.
Einige Jahre vorher wurden allerdings auch aus den Kreisen der Plettenberger Industrie immer wieder Anfragen und Anträge auf einen Fernsprecher gestellt.
Die Nummer 1 bekam am 1.11.1900 die Firma Achenbach in Ohle. Gleich drei Telephonanschlüsse mit den Nummern 3, 4 und 5 , bekam die Firma Brockhaus Söhne. Das Ohler Eisenwerk bekam zwei Telefonanschlüsse und zwar die Rufnummern 11 und 13.
Man stellte wahrscheinlich beim Ohler Eisenwerk fest, das ein Anschluß zu wenig war. Man war aber nicht schnell genug, zwischenzeitlich wurde die Rufnummer 12 schon an die Firma Meuser vergeben.
Auch das Kommunale Elektrizitätswerk Mark war entsprechend dem Stand der Technik von Anfang an dabei. Auch die Straßenbahn AG bekam in ihr damaliges Büro an der Herscheider Str. 7 (gegenüber von Budde und Steinbeck) den Anschluß Nummer 16. Auch zwei Hotelbetriebe nuzten die moderne Technik das Hotel Ostermann bekam die Telefonnummer 14 und das Hotel „Zum Schwarzenberg“ die Nummer 35. Die Stadt - Sparkasse (der Stadt Plettenberg) hatte die Rufnummer 32. Dr. Wilmes aus Eiringhausen der die Rufnummer 29 bekam und die Engel - Apotheke Rufnummer 21 vertraten 1900 das Medicinalwesen fernmeldetechnisch in Plettenberg Stadt - und Plettenberg - Land. Die Kolonialwarenhandlung Gustav Böcker aus der Kampstraße hatten die Rufnummer 24.
Interessant ist, dass weder die Stadtverwaltung noch die Amtsverwaltung zur
damaligen Zeit ein Telephon besaß (Die Polizeiverwaltung „Ortspolizei“ folgte
schnell). Auch das Amtsgericht Plettenberg war ebenso wie die Feuerwehr noch nicht
vertreten.
Erstes Telefonverzeichnis von Plettenberg
Fernsprechverzeichnis 1900
Copyright Angelika u. Gerd-W. Klaas
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|
Name
Achenbach
Allhoff & Müller
Brockhaus Söhne
Brockhaus Söhne
Brockhaus Söhne
Gregory, August
Messingwerk
Graewe & Kaiser
Reichsbahn, Güterabfertigung
Kommunales Elektrizitätswerk
Ohler Eisenwerk
Meuser
Ohler Eisenwerk
Hotel Ostermann
Chemische Fabrik Siesel
Plettenberger Straßenbahn A.G.
Herscheider Str. 7
Prinz
Pühl
Reinländer, Carl, Gabelfabrik
Rempel
Engel-Apotheke
Schlieper & Heyng
Schmellenkamp, Gebr.
Böcker, Gustav, Kolonialwaren-
handlung, Kampstr. 54
Plettenberger Drahtindustrie
Schulte, W. O.
|
Nr.
27.
28.
29.
30
31.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
|
Name
Seissenschmidt
Vieregge
Wilmes, Dr., Bhf.
W. Wagner, Köbbinghsn.
Wirth, Gebr., Ziegelei
Stadt-Sparkasse
Groote, Fr.W., & Co
Schade
Hotel "Zum Schwarzenberg"
Kirchhoff, C.,
Kaiser, Peter
Loos
Vieregge
Schmidt
Siepmann
Mylaeus
Kühne
Vetter, Ludwig
Kellermann
Polizeiverwaltung
Hotel zur Krone
Haape, Fritz
Schneider, Dr. jur.
Schneevoigt
Borbeck, Robert
Haushaltungsverein
Nockemann, Robert
Küchen, Rechtsanwalt
|
Quelle: "Adreßbuch der Stadt Altena und für den Lennebezirk
des Kreises Altena", Hrsg. Roland Kord-Ruwisch, 1906, 127 S.
Hier: Telefonverzeichnis S. 8 ff. (übertragen von Horst Hassel, 06.05.2010)
Telefonverzeichnis Plettenberg 1906
Dienststunden: Werktags von 7 bzw. 8 Uhr vorm. bis 9 Uhr
nachm., Sonntags von 7 bzw. 8 Uhr bis 9 Uhr vorm. und von
11 1/2 Uhr vorm. bis 1 1/2 Uhr nachm.
Oeffentliche Sprechstellen zum Ortsfernsprechnetz von
Plettenberg gehörig, in Holthausen, Kr. Altena, Plettenberg
und Plettenberg 2 - Bahnhof bei den Postämtern und bei
den Postagenturen in Oesterau und Ohle.
1 Achenbach & Schulte, Kesselschmiederei, Ohle
2 Allhoff, Wilh. (Allhoff & Müller), Drahtzieherei, Grünestr. 16
48 van Almsick, Wilh., Kaufmann, Plettenberg, 2-Bahnhof
52 Blomberg , F. Wwe., Bäckerei und Kolonialwaren
51 Borbeck, Robert, Kaufmann
4 Brockhaus, Ernst & Comp., Gesenkschmiederei, Wiesenthal
5 Brockhaus, Paul, Gesenkschmiederei, Oesterau
56 Bürgermeisteramt Plettenberg, Rathaus
64 Contze, August, Baugeschäft, Plettenberg, 2-Bahnhof
96 Damm, Anton, Tierarzt, Wilhelmstr. 54 I
62 Evangelisches Krankenhaus, Stiftstr.
24 Fischer, Dr. prakt. Arzt, Maiplatz 4
57 Geck, Otto, Bankgeschäft, Bahnhofstr.
8 Gräwe & Kaiser, Nieten-, Muttern- und Schraubenfabrik, Pletenberg, 2-Bahnhof
33 Grote, Fr. Wilh., Gesenkschmiederei, Ziegelstr. 10
9 Güterabfertigung Plettenberg, 2-Bahnhof
46 Gummich, Wilh. Rendant, Wilhelmstr. 36
55 Gut Hohenwibbecke (Pächter Schütz)
Hanebeck, Wilh., Gasthof Deutsches Haus, Eiringhausen
94 Höfinghoff & Allhoff, Glaswaren und Musikinstrumentenhandlung, Wilhelmstr. 18
3 Hotel Böley
14 Hotel Ostermann
53 Hotel zur Post (C. Meinhardt)
35 Hotel zum Schwarzenberg (O. Bettermann)
37 Kaiser, Peter, Baugeschäft, Bahnhofstr. 17
45 Kellermann, Aug., Gasthof, Plettenberg, 2-Bahnhof
6 Kersthold, Ferd., Baugeschäft Siesel bei Plettenberg, 2-Bahnhof
36 Kirchhoff, C., Baugeschäft, Herscheider Str. 6
73 Klein, Pastor
43 Kühne, Wilh., Schraubenfabrik, Viktoriastr. 4a
58 Laas, Wilh., Gärtnerei, Grünestr. 30
100 Boswan & Knauer, Baugeschäft, Oestertalsperre, Düsseldorf, G.m.b.H.
10 Lenne-Elektrizitätswerk, Plettenberg, 2-Bahnhof
11 Lion, Drahtzieherei, Wilhelmstr., Oestertalsperre
38 Loos, Carl, Baugeschäft, Bahnhofstr. 6
49 Luke, Dr., Arzt, Plettenberg, 2-Bahnhof
99 Maas, J. F. C., Manufakturwaren, Wilhelmstr.
7 Messingwerk Plettenberg, Walzwerk, Draht- und Rohrzieherei, Plettenberg, 2-Bahnhof
75 Menschel, Adolf, Wirtschaft
70 Menschel, Wilh., Wirtschaft
12 Meuser, C., Betthakenfabrik, Kaiserstr. 18
61 Möller, Dr. med., Gartenstr. 1
60 Mürmann, A., Eisen-, Kalk- und Kohlenhandlung, Holthausen Kreis Altena
42 Mylaeus, Gebr., Fabrik landwirtschaftl. Geräte, Bachstr. 10
41 Osterhammer, Werkzeugfabrik u. Gesenkschmiederei
66 Oestertalsperren-Genossenschaft Himmelmert
13 Ohler Eisenwerk, Theob. Pfeiffer, Ohle
65 Pickardt, L., Gasthof, Herscheiderstr. 1
39 Pieper, Alb., Gastw., Kückelheim
97 Plankemann & Schul, Gabelfabrik, Plettenberg, 2-Bahnhof
15 Plate, Rob. & Herm., Gabelfabrik, Holthausen
16 Plettenberger Straßenbahn
34 Schade, W., Metallwarenfabrik, Bahnhofstr.
95 Schlame, Fr., Fuhrunternehmer, Stiftstr. 5
22 Schlieper & Heyng, Gesenkschmiederei, Herscheiderstr.
17 Prinz, H., Hakenfabr., Holthausen
18 Pühl, Ad., Splintenfabrik, Herscheiderstr.
19 Reinländer, Carl, Gabelfabrik, Grünestr. 12
20 Rempel, Scheibenfabrik, Grafweg
47 Schmidt, Wilh., Gasthof, Wilhelmstr. 28
23 Schmellenkamp Gebr., Hakenfabrik, Plettenberg, 2-Bahnhof
25 Schulte, D. W., Dampfhammerwerk und Stimmnägelfabrik, Grünestr. 67
26 Schulte, W. O., Gabelfabrik, Wilhelmstr.
27 Seißenschmidt, H. B., Schraubenfabrik, Grünestraße
59 Seuthe, Heinr., Messing- und Bronzewarenfabrik, Holthausen Kr. Altena
63 Siepmann jun., H., Kohlenhdlg. und Speditionsgeschäft, Wilhelmstraße 30
21 Sluyter Dr., Apotheker, Wilhelmstraße
93 Span, E. Buchhandlung, Maiplatz 1
32 Städtische Sparkasse, M. Weiß, Sparkassenrendant, Kaiserstr. 7
44 Vetter, Ludwig, Holzhandlg. u. Dampfsägew., Plettenberg, 2-Bahnhof
28 Vieregge, A. Gesenkschmiederei, Elsethal bei Plettenberg
57 Vieregge, Heinr., Gesenkschmiederei, Holthausen
98 Vieregge, Wilh., Gutsbesitzer und Fischzuchtanstalt, Leinschede
69 Vieregge, Fr. W., Fabrikant
29 Weißer, Dr., Plettenberg, 2-Bahnhof
74 Wever & Möller, Brennerei
30 Wagner, W., Gesenkschmiederei, Köbbinghauserhammer
72 Winterhoff, Bierverlag
31 Wirth, Gebr., Dampfziegelei, Ziegelstraße
68 Wochenblatt, (Märker)
Königliche Eisenbahn-Direktion Elberfeld
Station Plettenberg.
Stationsvorsteher: Kirchner.
Güterexpedient: Voigt.
Eisenbahn-Assistenten: Beil, Koch, Näther, Schmidt, Wichmann.
Eisenbahn-Praktikant: Reuter
Lademeister: Fink.
Weichensteller: Bastert, Böcker, Henkel, Japes, Kraume, Rötz, Weber.
Bahnwärter: Krämer.
Rottenführer: Limberg.
Bahnsteigschaffner: Dreyer.
Weichenschlosser: Weißpfennig.
Telegraphenarbeiter: Leerman.
Wahlverband der Aemter
Rentner Krägeloh, Schalksmühle
Gemeinde-Vorsteher Wortmann, Schafsbrücke
Fabrikant Reinh. Engstfeld, Bollwerk
Gutsbesitzer Friedr. Hohage, Bremke
Gemeinde-Vorsteher Plankemann, Herscheid
Fabrikant Alfred Winckhaus, Oeckinghausen
Fabrikant Ernst Dunker, Werdohl
Königliche Aichämter
Altena: Aichmeister: Diedr. Opderbeck
Plettenberg: Aichmeister Carl Alberts sen.
Handelskammer in Altena
. . .
Albrecht v. Banchet, Fabrikant, Plettenberg
Paul Brockhaus, Fabrikant, Oesterau
Wilhelm Otto Schulte, Fabrikant, Plettenberg
. . .
Königliche Militärbehörden
Offiziere des Beurlaubtenstandes im Kreis Altena
a) Reserve-Offiziere
Leutnant Sluyter, Apotheker, Plettenberg
Leutnant d. Res. Schnevoigt, Landmesser und Kulturingenieur, Plettenberg
b) Landwehr-Offiziere
Oberleutnant d. L. Hensgen, Direktor, Plettenberg
Leutnant d. L. Mylaeus, Prokurist, Plettenberg
c) Sanitäts-Offiziere
Oberarzt d. Res. Dr. Fischer, prakt. Arzt, Plettenberg
Marine-Oberass.-Arzt d. Res. Dr. Weiser, prakt. Arzt, Eiringhausen
|