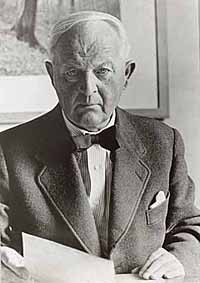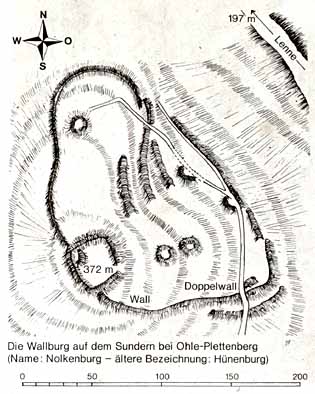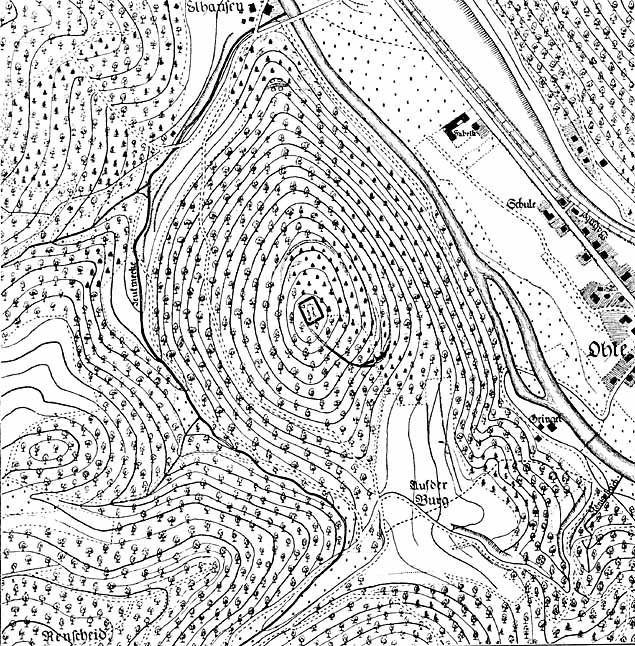|
Quelle: "Plettenberg - Märkischer Kreis", herausgegeben vom
Kreisheimatbund zum Kreisheimattag 1994 in Plettenberg, hier: Die
Wallburg bei Plettenberg-Ohle, Autor: Martin Zimmer, S.55-57, 4 Fotos, 1 Zeichnung, 1 Kartenausschnitt.
Martin Zimmer
Die Wallburg bei
In den sechziger Jahren entstand unweit des einstigen Bauerndorfes
Ohle die Siedlung "Auf der Burg". Ihr Name erinnert an eine alte
Wallburganlage, wie wir sie u. a. auch in Hohensyburg und nahe dem
ehemaligen Benediktinerkloster Grafschaft bei Schmallenberg finden.
Derartige Verteidigungsanlagen, bzw. Fluchtburgen, wurden bereits
von den Kelten angelegt.
Erste Ausgrabungsergebnisse ließen eine archäologische
Sensation vermuten. Man fand zwei verschiedene Festungsanlagen:
Weitere Ausgrabungen und die spätere Auswertung verschiedener Funde
widerlegten die anfänglichen Vermutungen: Es war keine keltische,
sondern eine sächsische Anlage aus dem 8. Jahrhundert, entstanden
z. Zt. des Kampfes gegen vordringende Westfranken. Die vor der
älteren Mauer befindliche jüngere Anlage ist später von den
Westfranken errichtet worden, evtl. in Zusammenhang mit dem
Burgenerlass König Heinrich I. (921) im Kampf gegen die Ungarn.
Der Zugang zur Fliehburg auf dem "Sundern" war einstmals durch ein
fast 6 Meter breites Kastentor gesichert. Seine Tiefe entsprach
der Breite des Wallkörpers, bzw. der Trockenmauer. Das Tor war
zweiflügelig und wurde wahrscheinlich durch Brand zerstört. - An
gleicher Stelle wurde unter Einbeziehung der älteren Toranlagen
in der jüngeren Bauperiode ein neues Tor errichtet. Es "bildete
zusammen mit dem älteren Tor um eine 5 bis 6 Meter tiefe und 5 Meter
breite Gasse, in die die Mörtelmauerenden trichterförmig einbogen.
Von den sieben Pfosten des neuen Kastentores waren je drei als
Außen-, Mittel- und Innenpfosten längs der Torwangen postiert; der
in der Mitte zwischen beiden Mittelpfosten stehende siebente Pfosten
teilte das somit ebenfalls zweiflügelige Tor in zwei Fahrhälften"
(Quelle: Barth/Hartmann/Kracht: Kunst- und Gschichtsdenkmäler im
Märkischen Kreis, Heimatb. MK, 3. Aufl. 1993).
Der heute noch erkennbare Wall zieht sich vom Eingangsbereich des
ehemaligen Burgtores auf einer Länge von ca. 230 Metern bis auf
die Bergkuppe des "Sundern" hin, wo er in ein Viereck von 45 Meter
Seitenlänge mit abgerundeten Ecken einmündet.
Hier auf der Höhe
liegen die Mauerreste einer wesentlich jüngeren Burganlage. Prof.
Dr. A. Stieren wies 1954 darauf hin, dass es sich vielleicht um
einen Wehrturm gehandelt haben könnte. Genauere Suchgrabungen
wurden seinerzeit nicht durchgeführt. Nach mündlicher Überlieferung
soll sich hier auf dem "Sundern" im 16. Jahrhundert eine Familie
Nölken angesiedelt haben. So ist es auch erklärlich, wenn in der
Ohler Bevölkerung heute noch von der "Nölkenburg auf dem Sundern"
gesprochen wird.
"Das Geheimnis der Erdwälle auf dem Sundern" dürfte durch die
genannten Ausgrabungen weitgehend gelüftet sein. Zumindest bestätigen
sie, dass es sich bei dieser Wallburganlage um das älteste
siedlungsgeschichtliche Zeugnis der Stadt Plettenberg handelt.
Quelle: "Westfalenland", Heimatbeilage zum Westfälischen Tageblatt,
Nr. 5, Hagen, im Mai 1934, S. 70 ff. - "Von den Wallburgen im Volme-
und unteren Lennegebiet" von P. D. Frommann, Hagen Boelerheide
Hauptburg ein unregelmäßiges Viereck
Der 375 m hohe Sundern bei Ohle mit seinen steilen Abhängen an allen
Seiten eignete sich wie kaum ein anderer Berg zur Errichtung einer
Burg. Die Trümmer derselben zeigen, dass der nicht so großen Hauptburg
an 3 Seiten eine Vorburg von bedeutender Ausdehnung vorgelagert war.
Den Zugang zu letzterer sicherte ein Zwinger, ein kleiner von
besonderen Mauerwällen umschlossener Raum vor dem Tore der Vorburg.
Dieser Vorwall ist nach der Lenne hin schon länger verwischt; an
der gegenüberliegenden Seite kann man aber noch deutlich die mit
Lehmmörtel aus brauchbaren Bruchsteinen hergestellte 60 cm dicke
Mauer in seinem Innern erkennen. Die Entfernung von dieser Mauer
bis zum Toreingang beträgt 17 Schritt. Der Wall der Vorburg ist zu
beiden Seiten der Toröffnung noch etwa 8 m hoch (von der Grabensohle
aus gemessen). Der Wall rechts vom Eingange führt erst noch eine
kurze Strecke bergab, biegt dann nach Norden und verschwindet
allmählich. Gleich an seinem Anfange ist ein ebener Platz (ähnlich
wie beim Vorwall der Raffenburg), von welchem eine Böschung nach
Norden geht. Diese wird westlich von einer andern längeren begleitet.
Wo sie endet, beginnt einige Meter höher hinauf ein fast halbkreisförmiger
Wall, der die Vorburg in ihrem nördlichen Teile abschloss. Er führt
fast bis zur Hauptburg, deren Mauertrümmer ein unregelmäßiges Viereck
bilden mit Seiten von rund 50:40:43:40 m Länge. In der Nordwestecke
der Innenburg ist eine 2 m tiefe Grube mit einem Durchmesser von fast
8 m, deren Wände nicht gemauert sind. Von der Südwestecke erstreckt
sich eine anfangs niedrige, weiter bergab höher werdende zusammengestürzte
Mauer über Süden nach dem Eingange zur Vorburg.
Die Burg auf dem Sundern heißt Nolkenburg, zufolge Zeugenaussagen aus
dem 16. Jahrhundert nach einem Pächter Nolken. Ihre ältere Bezeichnung
ist Hünenburg. Burgen dieses Namens gibt es außer 4 im oberen
Wesergebiet und einer bei Bielefeld im Sauerlande bei Meschede,
zwischen Rumbeck und Oeventrop, bei Menden und zwischen Wocklum
und Mellen. Die bei Menden umfasste auch eine eingebaute Steinburg.
Schuchardt urteilte über derartige Burgen: "Die Burgen, welche die
Sachsen gegen Karl den Großen benutzten, sind immer große befestigte
Heerlager auf unzugänglichen Bergen. Sie haben als Hauptstück einen
großen geschlossenen Ring, der immer ohne Graben ist. Er enthält meist
eine Mauer, vielfach ist er vielleicht nichts als eine Mauer, die
zusammenfallen. Als zweites Stück haben die Sachsenburgen auf der
gefährdeten Seite dicht vor dem Hauptring einen Schutzwall mit
Außengraben. Am Tore pflegt er abzubiegen und kleine Schanzen zu
bilden (wodurch der Zwinger entstanden ist). Beides aber, der
geschlossene Ring und der Zwinger, sind für die Sachsenburg so
bezeichnend, dass eine Burg, bei der sie fehlen, von vornherein
als nichtsächsisch erscheinen muss." Demnach ist die Burg auf dem
Sundern eine altsächsische Anlage.
|