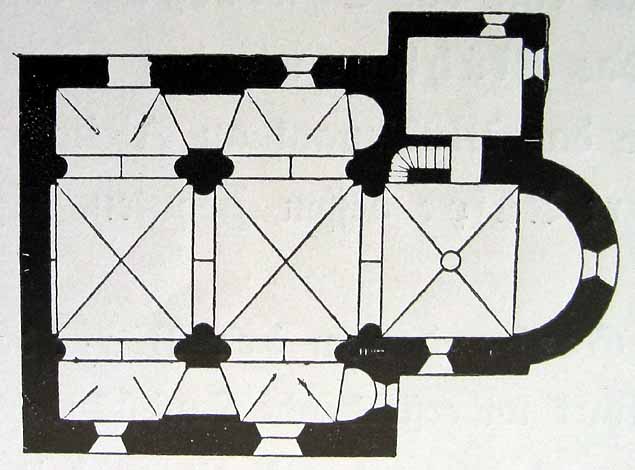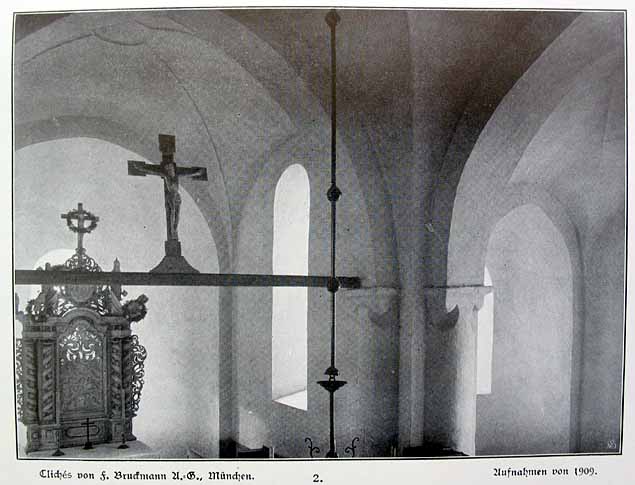|
Quelle: Martin Zimmer, Stadtarchivar, 17.09.1987
Die Evangelische Kirche in Ohle (ehem. St. Martin)
Die Kirche in Ohle gilt als bemerkenswertes Beispiel für den Typ
der sauerländischen Hallenkirche. Mit ihrem tiefgezogenen
Satteldach lässt die durch ausgesprochene Schlichtheit und
Wuchtigkeit ganz eigenständige Kirche Bauelemente des
heimischen Bauernhauses erkennen. Das dreischiffige, zweijochige
Langhaus wird durch zwei Pfeiler getragen. Der Turm ist nicht, wie
sonst grundsätzlich üblich, im Westen, sondern über der Vierung
des Chores im Osten und der früheren Kapelle hochgezogen.
Die ältesten Bauteile der Kirche stammen aus der Zeit um 1050 bis
1100, als diese noch eine Kapelle war. Später (14. Jhdt.), als sich
die kleine Filialgemeinde von der Muttergemeinde Plettenberg abzweigte,
wurde die Kapelle zur Kirche umgebaut. Seitdem ist die Ohler Kirche
selbständige Taufkirche. Ihr Patron war der Hl. Martin. Sie war
in vorreformatorischer Zeit ein weit und breit berühmter Gnaden- und
Wallfahrtsort. In einem Wandschrein auf der nördlichen Chorseite
befand sich damals das Haupt des Hl. Cornelius, Bischof von Skamandra,
eines in der Apostelgeschichte erwähnten römischen Feldhauptmanns,
das alljährlich am Kornelitage der Prozession zum Hemberg vorangetragen
wurde.
Äußerlich war die alte Kirche wesentlich anders als die jetzige.
Die Sakristei wurde erst 1653 angebaut. 1751 wurde der Turm um
ein Stockwerk erhöht und der heutige Helm in Gestalt einer achtseitigen
Pyramide aufgesetzt. 1963/64 erfolgte eine Grundrestaurierung der
Kirche, wobei unter anderem auch die inneren Ausmalungen von einst
freigelegt und in ihrer ursprünglichen Form ergänzt wurden.
Das Patronat der Kirche hatte das Haus Brüninghausen. Im Jahre 1875
wurde der katholische Besitzer des Hauses nach Zahlung eines
namhaften Betrages aller Patronatspflichten unbd -rechte "für ledig"
erklärt. 1391 ist das Ohler Gotteshaus als "Kerke tho Ole" bezeichnet.
Ihrem Patron, dem St. Mauritius, wurde einst auch die größte Glocke
geweiht. Sie trägt die Inschrift
scs mauritius byn ych genant
Die "Mauritius-Glocke" wurde 1963 als Läuteglocke stillgelegt. Sie dient
seitdem als Schlagglocke für die sieben Bitten des "Vater Unser".
Immerhin handelt es sich bei der genannten Glocke um die älteste in
der heutigen Stadt Plettenberg (Glockenguss 1480!). |
|
|
|
|
Das Innere der Kirche
Im Chor sind 1907 Wandmalereien aufgedeckt und nach dem damaligen Geschmack
unter Verwendung einer späteren gotischen Übermalung nachgestaltet
worden. Sie wurden später - wie bereits erwähnt - erneut freigelegt.
Sie stellen Christus in der Mandorla mit Evangelistensymbolen als
Weltenrichter dar (Mitte 13. Jhdt.), während die Heiligengestalten,
darunter St. Mauritius, von einer Erneuerung bzw. Ergänzung des 15. Jhdt.
stammen. Die Ornamentmalerei des Langhausgewölbes zeigt das Soester Schema
nur in der Kopie von 1907.
An dem mittelalterlichen steinernen Altar ist, wohl aus dem 14. Jhdt.,
ein gemaltes Antependium zu sehen, Rauten zwischen rahmenden Säulen
mit Spiralbändern. Der Altaraufsatz mit einem geschnitzten Abendmahlsrelief
wurde 1720 gefertigt.
Das barocke Orgelgehäuse stammt von 1768, die Empore von 1662. Sie hat
Fachschnitzereien und eine griechische Inschrift. Sie liest sich in Umschrift
folgendermaßen: to agalma tou hierou kai hagiou tou theou (Die Zierde
des Heiligtums und Tempels Gottes). Die Stifternamen der Empore stehen
auf den oberen Leisten.
Quellen:
Quelle: Martin Zimmer, Kirchenarchiv Ohle, September 1999
Die Evangelische Kirche zu Ohle
Die Kirche zu Ohle wurde im 11. Jahrhundert als eine romanische
Hallenkirche gebaut. Als Baumaterial diente der hier vorhandene
Grauwacke-Bruchstein. Der Turm steht im Osten der Kirche. In
ihm befindet sich der Altarraum.
Bei der Restaurierung der Kirche (1962-1964) kam die alte Freskenmalerei
an Wand und Decke des Chorraumes wieder zum Vorschein. In der Mandorla
sitzt Christus, der Herr der Welt, auf der Erdkugel. Er ist umgeben
von den vier Evangelisten, die dargestellt sind unter den Zeichen
Engel, Löwe, Stier, Adler. Das Friesband, das diese Deckenmalerei
von der Wandmalerei trennt, ist erhalten geblieben. Es variiert im
Muster, während die Bemalung links zerstört war und nach Schablone
erneuert wurde.
An der Wand hinter dem Altar befindet sich links eine schlecht erhaltene
und schwer zu erkennende Freskenmalerei. Deutlich ist das Antlitz der
Maria zu erkennen, weniger deutlich, aber noch erkennbar, ist das Haupt
Christi, während ein anderer (Heiliger) ncht zu deuten ist. Wahrscheinlich
war das Ganze eine Kreuzigungsdarstellung, deren unterer Teil zerstört
wurde, als man um 1220 eine Nische ausbrach zur Aufnahme der Reliquie.
Bei ihr handelt es sich um das Haupt des Cornelius (vgl. Apostelgeschichte
10), das um 1220 dem Ritter von Ohle an der "Heiligen Eiche" bei Ohle
(Hemberg) durch Engel in einer Muschel überbracht wurde. "Sie haben es
von Mailand nach Ohle gebracht", so sagt die Legende. Tatsache ist, dass
für diese Reliquie die ursprüngliche Malerei zerstört wurde. Es entstand
eine Reliquien-Nische, vor der einige anbetende Personen dargestellt
wurden, und um dieser Reliquie willen vielen Besucher nach Ohle kamen.
Die Malerei an der Nische ist kaum erkennbar.
Hinter dem Altar an der Wand ist links ein unbekannter "Heiliger"; rechts
steht ein Heiliger, bei dem das Spruchband sagt "scs. mauricius ora pro
nobis" (Sanctus Mauritius, bitte für uns). An den heiligen Mauritius
erinnert auch die älteste Glocke der Kirche, auf der geschrieben steht:
scs mauritius byn ych genant wan ych rope so comet to hant 1483.
Der Altar-Aufsatz ist eine barocke Bauernschnitzerei und -malerei. Auf
der großen unteren Tafel ist die Feier des Abendmahls dargestellt; auf
dem weißen Tischtuch liegen Schwarzbrote, eine Schale mit dem Passa-Lamm,
daneben ein Kelch.
Die Malerei oben am Altar erinnert an die Opferung Isaaks durch Abraham.
Rechts und links am Altar stehen Aaron im priesterlichen Gewand und mit
den Insigniend es Hohen Priesters sowie Mose mit den beiden Gesetzestafeln.
Quelle: Aufzeichnungen von Ewald Baberg, 6 DIN A 4-Seiten,
maschinengeschrieben, um 1962 (Kirchenarchiv Ohle)
Die alte Kirche in Ohle
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Ohle
beschloss um die Mitte des Jahres 1962 die Renovierung
unserer alten Kirche. Da ich die Instandsetzung in den
Jahren 1914-1916 noch gut in Erinnerung habe, und wie ich
hörte, aus diesen Jahren nichts Schriftliches hinterlassen
wurde, hielt ich es für richtig, alles Wissenswerte
niederzuschreiben.
Wie sah nun die Kirche vor der Renovierung aus? Der
Außenputz der Kirche bestand aus Kalkmörtel. Die meisten
Häuser in Ohle waren so geputzt. Der Mörtel aus gesiebtem
Lennesand und Kalk aus dem Kalkofen im Vossloh bei
Grimminghausen. Turm und Kirchenschiff waren so wie heute
mit Schiefer gedeckt. So um das Jahr 1906 hat der Maurermeister
Julius Kahle aus Hilfringhausen Außen- und Innenwände der
Kirche mit Kalkmilch geweisselt.
Der Platz rund um die Kirche war ursprünglich Friedhof, zu
meiner Zeit Schulplatz für die alte Schule, allerdings
standen noch einige Grabsteine daselbst. Innen war die Kirche
weiß getüncht, der Altar und die Orgel in weißer Farbe
gehalten, mit Goldverzierungen. Die Kanzel und das ganze
Gestühl hatten einen graublauen Anstrich. Die Namen der
Besitzer der Kirchenstühle (Stand) waren mit Farbe aufgemalt.
Das adelige Haus Grimminghausen hatte gleich links der
Eingangstür eine Empore als Stand (die sogenannte kleine
Libberigge). Eine Holztreppe führte hinauf. Darunter war der
Stand des adeligen Hauses Brünninghausen (von Wrede) obwohl
die Familie katholisch war, so hatte sie doch einen Stand in
der Kirche, denn der Herr von Wrede hatte das Patronat.
Die vier Presbyter saßen auf dem Chor rechts. Der Kirchmeister
Karl Schmidt-Kellermann, Fritz Schmidt-Wüllner, der nach der
ersten Strophe des Kirchenliedes nach der Liturgie den
Klingelbeutel trug, Wilhelm Baberg-Rieckesmann, der ihn
gelegentlich ablöste und Wilhelm Baberg-Suhr. Die Konfirmanden
saßen auf zwei langen Bänken auf dem Chor. Links die Mädel,
rechts die Jungen. Die Katechumenen saßen vor dem Chor im
Kirchenschiff vor den Sitzen der Älteren auf zwei langen Bänken,
ebenfalls links die Mädel und rechts die Jungen.
Rechts vor der Kanzel, im sogenannten Ziarws-Eck (Servatius-Ecke),
saßen eine Anzahl männlicher Kirchenbesucher. Vor ihnen in der
Fensternische das Reiterstandbild des Heiligen Martin. An der
Wand neben dem Turmaufgang die Ehrentafel mit den Namen der drei
Gefallenen im Kriege 1870/71. Hinter einem eisernen Gitter in
einer Nische barg man im Mittelalter die Reliquie "Das Haupt des
heiligen Cornelius".
Links vom Turmaufgang stand ein großer Ofen, der mit Buchenholz
geheizt wurde. Die Beleuchtung bestand in einem Kronleuchter im
Kirchenschiff vor dem Chor mit 12 Kerzen und an den Wänden eine
Anzahl Leuchter mit je 3 Kerzen. Einmal im Jahr, am Heiligen Abend,
wurden diese angezündet zur Christvesper (Lichterkirche). Die
Unkosten für Beleuchtung und Heizung brachte man durch die Kollekte
am Heiligen Abend auf. Der Organist erhielt am Himmelfahrtstage
als einmalige Vergütung für sein Orgelspiel ein Opfer. Das heißt,
nach dem Kanzelsegen gingen die Kirchenbesucher um den Altar und
legten ein Geldstück dahin. Nach Aussage meines Großvaters soll
in alter Zeit die Besoldung des Pfarrers auch auf diese Weise
geregelt worden sein.
So habe ich die Kirche und Gottesdienst vor 1914 in Erinnerung.
Kurz vor Ausbruch des [I. Welt-]Krieges begann dann die große
Renovierung der Kirche innen und außen. Unter großen Schwierigkeiten
konnte das vollendet werden bis am 2. April 1916 die Einweihung
stattfand. Alle gottesdienstlichen Handlungen fanden während dieser
Zeit im Biermannschen Saale statt.
Am 15. Januar 1922 weihte die evangelische Gemeinde Ohle in einem
würdigen Weiheakt die Ehrentafel mit den Namen der Gefallenen von
1870/71 und von 1914/18. Der Männergesangverein Ohle und ein
Schulchor unter Lehrer Hüser, der ein Lied vortrug, das von ihm selbst
verfasst und in Noten gesetzt war, sowie mehrere Schüler, die
Gedichte vortrugen, umrahmten die feier. Die Weiherede hielt Pfarrer
Haverkamp, der dann auch den Weiheakt vornahm.
Der Entwurf der Ehrentafel stammte von dem Kirchbaumeister Hoffmann,
der wenige Jahre vorher die Renovierung der Kirche geleitet hatte.
Es wäre zu wünschen, wenn sich bei der heutigen Renovierung der
Kirche ein Platz fände, der nicht nur die Namen der 31 Gefallenen
und Vermissten von 1870/71 und 1914/18 aufnähme, sondern auch die
(etwa 100) Namen der Gefallenen von 1939/45.
Die Renovierung 1914-1916
Zunächst wurde der Außenputz entfernt. Die Steinfugen mussten mit
Zement aushefugt werden - eine langwierige Arbeit. Beim Bau der
Kirche und besonders beim Bau des Turmes waren viele kleine Steine,
die zum Teil dem Flußbett der Lenne entstammten, verwandt worden.
An der Westseite der Kirche musste ein Raum für die Orgel und ein
überdachter Raum für den Aufgang zur Empore geschaffen werden.
Darunter fand die neue Dampfheizung ihren Platz. Leider versäumte
man von der Westseite mit dem historischen Fenster ein Bild zu
machen, an dem man noch deutlich die Spuren der Verbindung zur
Burg "der Ritter von Ohle" sehen konnte.
Die großen Grabsteinplatten mit den Namen der Ohler adligen Häuser
ersetzte man durch Sandsteine. Die Grabsteine wurden an der Außenwand
links neben der Eingangstür angebracht, woselbst sie heute noch zu
sehen sind.
Drei neue Fenster erhielt die Kirche, zunächst das eine, welches in
schönen Worten von dem Umbau der Kirche berichtet, dann das Fenster
des Hlg. Martin im Ziarwseck und gegenüber an der Nordseite das
Wappenfenster mit den Wappen der adeligen Häuser von Ohle, unter
anderem die Jakobsmuschel des Ritters von Ohle.
Beim Entfernen des Innenputzes kamen die alten Freskogemälde zum
Vorschein. Im Altarraum sah man die Sinnbilder der vier Evangelisten
und den Weltheiland Christus. Die zwölf Apostel, von denen Wilhelm
Rötelmann noch um das Jahr 1840 berichtet, fand man jedoch nicht. Der
Altar und das Reiterstandbild des Hlg. Martin wurden in bunten Farben
restauriert. An den beiden Pfeilern, die das Kirchenschiff tragen, sah
man in Höhe der großen Empore rechts einen Hirschkopf, der mit der
Zunge nach Wasser leckt und links eine Teufelsfratze. Im Gewölbe sah
man neben schönen Friesen den Lebensbaum und den Fischreiher. Im
Chorgwölbe aber das Lamm mit einer schwarz-weiß-roten Fahne.
Die Orgel war nach der Renovierung in Weiß gehalten. Sie wurde
vollkommen erneuert und das Gebläse elektrisch betrieben. Selbstverständlich
erhielt die Kirche eine elektrische Beleuchtung. Erwähnen möchte ich
noch, dass damals von der letzten deutschen Kaiserin, Auguste Viktoria,
eine Altarbibel gestiftet wurde. Eine entsprechende Widmung auf der
ersten Seite der Bibel berichtet davon.
In den beiden ersten Jahren des großen Krieges, als unser tausendjähriges
Gotteshaus renoviert wurde, erneuerte man auch in Berlin die Schloßkapelle.
Inzwischen sind fünfzig Jahre ins Land gegangen. Heute ist wiederum eine
Erneuerung der Ohlöer Kirche notwendig geworden. Ich bin überzeugt, dass
dieses nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit
modernsten technischen Mitteln geschehen wird.
Wilhelm Rötelmann und P. D. Frommann berichten von Um- und Anbauten
der Ohler Kirche.
Quelle: Verzeichnis der Kirchensitze 1724, Kirchenarchiv Ohle, Sig. 1.12.1
Die Kirchensitze im Jahre 1724
Vor Servaty Altar
|