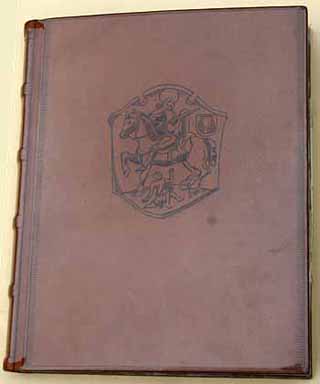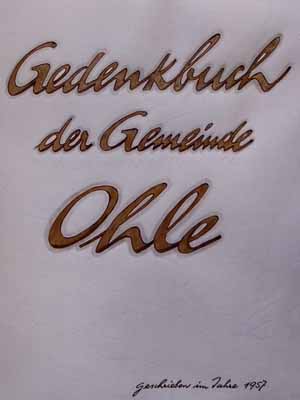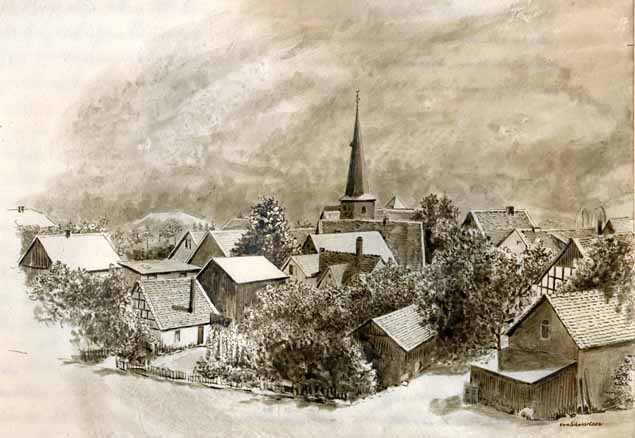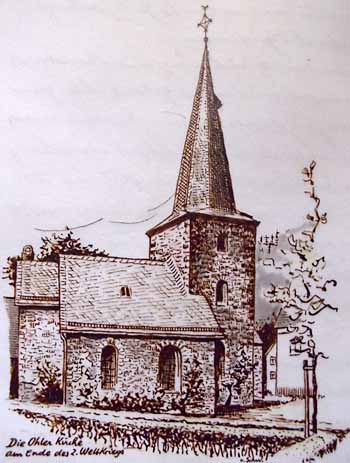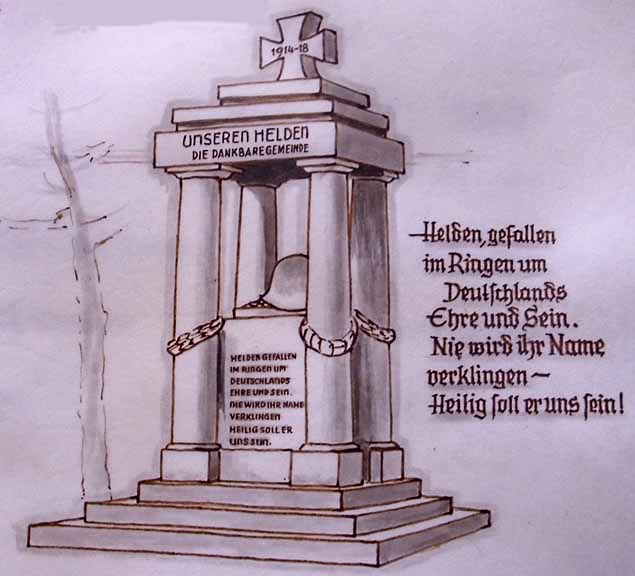|
Quelle: Gedenkbuch der Gemeinde Ohle im Kirchenarchiv d. ev. Kirchengemeinde Ohle
Das Gedenkbuch der Gemeinde Ohle
Darin: Das Ohler Wappen
Das im Jahre 1935 heraldisch verbesserte Wappen zeigt den Ohler Kirchenpatron,
den hl. Martin, der als Bischof von Tours um 400 gestorben ist und
später der Schutzheilige Frankreichs wurde. St. Martin zerschneidet
seinen Mantel und teilt ihn mit einem frierenden Bettler. - Die
rote Jacobs- oder Pilgermuschel entstammt dem Wappen des ausgestorbenen
Geschlechts der Ritter von Ohle.
Darin: Geschichtliches
Bei den letzten Ausgrabungen wurde ein ehemaliges, mehrere Meter breites
Burgtor entdeckt und freigelegt. Es hatte eine Falltür, deren Hölzer
nach unten angespitzt waren. Die Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem
Sundern weisen die gleichen Merkmale wie bei der Hohensyburg und bei
der Burganlage in der Nähe der Abteil Grafschaft auf. Für die Verteidigung
der Burg waren viele tausend Krieger erfordelich.
Als die Zeiten ruhiger geworden waren, verlegte der Burgvogt seinen
Wohnsitz ins Tal. Auf dem Ohl wurde eine Curtis, ein sog. Königshof,
errichtet, der durchmarschierenden Heeren als Herberge und Unterkunft
diente. Die heute noch bekannten Flurnamen "Wallstück" und "vorm Dore"
sind Zeugnis dafür, dass diese Anlage durch Wall und Tor geschützt
und, da sie auf dem Ohl' gebaut, eine Wasserburg war.
Das Haus Brüninghausen war Kurkölnisches Lehen und Stammhaus des
Geschlechts von Brüninghausen. Schon früh waren die Besitzungen geteilt.
Zwei Burghäuser waren vorhanden, das Turmgut und das Mühlengut. Das
Letztere besaßen die Herren von Ohle, das Turmhaus kam an die Familie
von Rüspe. Das Mühlengut kam 1400 an die Familie von Wesselberg, 1426
an Diederich Sprenge, 1431 an die von Kobbenroyde und später an die von
Rump. Schließlich kam es an die Besitzer des Turmgutes. Damit war ganz
Brüninghausen wieder in einer Hand.
Das eine der Burghäuser wurde abgebrochen. Im Erbgang kam später Haus
Brüninghausen mit sämtlichen Pertinenzstücken an die Familie von Wrede,
in deren Besitz es noch heute ist.
Das im Süden der Gemeinde Ohle gelegene adelige Haus Grimminghausen
spielte in der Ohler Vergangenheit ebenfalls eine wesentliche Rolle.
Fast alle Höfe im südlichen Gemeindeteil waren Pachthöfe dieses Hauses.
Der älteste Teil des Hauptgebäudes, einstmals "Loerhof" genannt, stammt
aus dem 14. Jahrhundert. 1675 wurde der neuere Teil angebaut. Bewohner
waren Familien von Rump, von Rüspe und von Plettenberg-Neilen. Später
kam Haus Grimminghausen an die des Glaubens wegen aus Luxemburg vertriebene
Familie von Mascharell. Der letzte dieser Familie, Johann von Mascharell,
Rentmeister von Hörde, vererbte es 1681 an Joseph von Katzler. 1800 kam
das Haus an Freiherrn von Kessel zum Neuenhof, dann an die Familie von
dem Busche zu Ippenburg. Heute noch ist die Familie von dem Busche-Kessel
Eigentümerin.
Ohle bildete seit Beginn der märkischen Zeit (14. Jahrhundert) einen
Bestandteil des Amtes Neuenrade. Auch während der napoleonischen Zeit
gehörte Ohle zum Kanton Neuenrade im Arrondissement Hagen. Diese Verbindung
hat mindestens ein halbes Jahrtausend bestanden, bis die Gemeinde in
natürlicher Entwicklung bzw. aus Gründen der Zweckmäßigkeit im Jahre
1890 in den Verband des Amtes Plettenberg aufgenommen wurde. Der Bau
einer neuen Lennestraße und der später - im Jahre 1904 - dem Verkehr
übergebene Bahn-Haltepunkt "Ohle" erleichterten den Verkehr mit dem
Amtsmittelpunkt.
Am 1. April 1941 erfolgte die Zusammenlegung des Amtes mit der Stadt
Plettenberg, wodurch auch Ohle zu einem Bestandteil der Stadt Plettenberg
wurde. - Nach dem 2. Weltkrieg unternahm die Gemeinde Ohle Schritte, um
ihre Forderung nach Wiedergewährung der Selbständigkeit als eigene
Gemeinde anzumelden. Eine gleichzeitig durchgeführte Abstimmung durch
Unterschriftsleistung hatte das ganz eindeutige Ergebnis von 97 v. H.
der wahlberechtigten Bevölkerung für die Ausgemeindung.
Auf Grund dieses Ergebnisses fühlten sich die Vertreter der Ohler Bürgerschaft
im Jahre 1950 berechtigt und zugleich verpflichtet, die Ausgemeindungsforderung
schriftlich der Kreisverwaltung vorzulegen. - Das Ausgemeindungsbegehren
stieß hier auf wenig Verständnis und wurde abgelehnt. Ein späterer, vom
Betriebsrat des Ohler Eisenwerkes beim Innenministerium gestellter
Ausgemeindungsantragverfiel ebenfalls der Ablehnung.
Ihr Patron war der heilige Martin (*Anm.: Es ist auch die Ansicht vertreten,
dass St. Mauritius der Ohler Patron sei, da die größte Glocke seinen Namen
trage). Sie war in vorreformatorischer Zeit ein weit und breit berühmter
Gnaden- und Wallfahtrsort. In einem Wandschrein auf der nördlichen Chorseite
befand sich damals das Haupt des hl. Bischofs Kornelius von Skamandra, eines
in der Apostelgeschichte erwähnten römischen Feldhauptmanns, dass alljährlich
am Kornelitage der Prozession zum Hemberg vorangetragen wurde. Ziel war dort
die alte Eiche, aus deren Zweigen der Sage zufolge das Haupt des Heiligen
seinen Weg nach Ohle gefunden hatte.
In den schmalen Seitenschiffen standen Nebenaltäre, im nördlichen der Marien-
und im südlichen der Servatiusaltar. Äußerlich war die Kirche wesentlich anders
als jetzt. Die Sakristei wurde erst 1653 angebaut. 1751 wurde der Turm um ein
Stockwerk erhöht und der jetzige Helm in Gestalt einer achtseitigen Pyramide
aufgesetzt.-
Das Patronat der Kirche hatte Haus Brüninghausen. Im Jahre 1875 wurde der
katholische Besitzer des Hauses nach Zahlung eines namhaften Betrages aller
Patronats-Pflichten und -Rechte fürledig erklärt.
In Teindeln stand eine zur Gemeindepfarre gehörige Kapelle, die St. Nicolaus
geweiht war. Sie war letztmalig 1709 instandgesetzt worden. 50 Jahre später war
sie bereits verfallen.
Die Besiedlung des Ohler Raumes ging in alter Zeit nur sehr langsam vor sich.
Am Ende des Mittelalters hatte Ohle 15 bäuerliche Siedlungen. Jahrhunderte
hindurch waren es 17, bis die napoleonische Zeit auch hier Wandel schaffte.
Als in den Jahren 1808 und 1811 durch zwei Dekrete des Korsen Leibeigenschaft
und Hörigkeit beseitigt wurden, machten die meisten Ohler Bauern Gebrauch von
der Möglichkeit, sich für den 25-fachen Betrag der jährlichen Abgaben mit Haus
und Hof, Grund und Boden loszukaufen. Erst dann entstanden neue Höfe, und zwar
bis Mitte des vorigen Jahrhunderts 11, und bis zum deutsch-französischen Krieg
1870/71 weitere 8 an der neuen Lennestraße. Der Straßen- und Eisenbahnbau
wirkten umgestaltend auf Ohle. So mussten allerdings auch drei Häuser dem Bahnbau
zum Opfer fallen.
Jahrhunderte hindurch beschäftigten sich die Ohler Einwohner fast
ausschließlich mit der Landwirtschaft. Bereits vor der Entstehungszeit
der Ohler Ansiedlung wurde aber auch Bergbau betrieben. Das beweisen
mehrere im Ohler Gebirge gefundene, glasig-poröse Schlackenreste, die
einwandfrei als Rückstände beim Verhüttungsprozess gedeutet werden konnten.
Da solche auch unter der freigelegten Mauer auf dem Sundern festgestellt
wurden, sind sie Anhaltspunkte für eine wenigstens frühmittelalterliche
Eisenverhüttung. In späterer Zeit wurde nahe beim Haus Brüninghausen Blei
gewonnen, auf der Haverley bei Elhausen grub man Eisenerz, das am Fuße des
Berges verblasen wurde.
Diese Tätigkeit ruhte jedoch seit dem 30-jährigen Kriege und wurde auch nicht
wieder aufgenommen. Dafür gingen mehrere Ohler in das benachbarte Plettenberg,
erlernten dort das Tuchmacherhandwerk und gründeten dort eine eigene Familie.
Einige kehrten nach Ohle zurück. So mag hier und dort im Dorf ein Webstuhl
geklappert haben.
Grundlegend änderte sich das geruhsame Dasein im Dorf im Jahre 1889, als von
den Fabrikanten Kölsche, Dieckerhoff und Achenbach ein Walzwerk errichtet
wurde. Im folgenden Jahre wurde von Achenbach und Schulte eine Kesselschmiede
erbaut. Beide Unternehmen standen unter einem günstigen Stern. Da das Dorf
Ohle den Bedarf an Arbeitskräften nicht mehr allein decken konnte, setzte ein
ständig steigender Zuzug von auswärtigen Arbeitskräften ein. Besonders das
Walzwerk, das Theobald Pfeiffer im Jahre 1896 mit einer Dampfkraftanlage
versah, wurde immer größer. 1897 wurde die zweite Walzenstraße gebaut.
Entsprechend dem technischen Fortschritt wurden die Einrichtungen der Ohler
Unternehmen laufend vergrößert und verbessert. 1892 wurde die Einrichtung
einer Postagentur erforderlich. Der Fernsprechverkehr wurde 1894 eingerichtet
und der Bahnhof Ohle wurde 1904 eröffnet. Im selben Umfang, wie die Betriebe
vergrößert wurden und die Belegschaft anwuchs, wurde auch der Wohnungsbau
betrieben. Das Eisenwerk verfügte im Jahre 1936 bereits über 300 eigene
Siedlungshäuser. Auch die alte Kirche erwies sich bald zu klein und wurde
deshalb im Jahre 1916 erweitert.
Die Einwohnerzahl stieg innerhalb von 10 Jahren von 760 (1895) auf 1.000 (1905).
1925 erreichte sie 2.500 und beträgt heute annähernd 4.500 Bewohner. Auch die
Schule konnte längst nicht mehr den Umfang bewältigen. 1919 brachte zwar die
Errichtung der Selscheider Schule, wohin 27 Kinder überwiesen werden konnten,
eine fühlbare Entlastung. Nach dem ersten Weltkrieg musste eine neue Lösung
geschaffen werden. Für die katholischen Kinder, die bis dahin als Gastschulkinder
nach Eiringhausen gingen, wurde zunächst in einer Kriegsgefangenen-Baracke beim
Ohler Eisenwerk eine katholische Schule eingerichtet, 1924 wurde für diese
Kinder ein neues Schulgebäude mit 2 Unterrichtsräumen errichtet. 1925 wurde
die neue evangelische Schule bezogen, die heutige Gemeinschaftsschule, die
4 Klassen umfasst. Heute sind beide Schulen bereits wieder zu klein.
Zu einem nicht unerheblichen Teil vollstreckte sich der Zuzug neuer Arbeitskräfte
aus dem katholischen Sauerland. Die Zahl der Katholiken wuchs dadurch ebenfalls
von Jahr zu Jahr. 1890 waren 32 Einwohner des Dorfes katholisch, heute sind es
weit über 1.000. Nicht nur die Unterbringung der katholischen Schulkinder war
daher vordringliche Aufgabe. Der Bau einer eigenen Kirche wurde immer notwendiger.
Der katholische Bevölkerungsteil Ohles wird noch in diesem Jahr seine neue Kirche
neben der Papenkuhle freudigen Herzens in Benutzung nehmen können.
Vorbildlich wurde in den Jahren 1953/54 die Anlage eines neuen Gottesackers an
der Straße nach Selscheid geplant und durchgeführt. Er kann mit seinem
naturgewachsenen Baumbestand 260 Gräber aufnehmen und ist noch um die Hälfte
erweiterungsfähig. Im Mittelpunkt steht die schmucke, weithin sichtbare Kapelle
mit ihrem Schindeldach aus Eichenholz und dem Glockentürmchen. Sie wurde zusammen
mit dem neuen, im Garten der alten Kirche errichteten, von Prof. Breker für die
gefallenen und vermißten Söhne der Gemeinde geschaffenen Ehrenmal am 18. Juli
1954 eingeweiht.
Ohle ist im Laufe seiner Geschichte von harten Schicksalsschlägen nicht verschont
geblieben. Seuchen, Feuersbrünste und Hochwasserkatastrophen haben der Gemeinde
große Opfer abgefordert.
Im Kriege 1870/71 starben für König und Vaterland 3 Ohler Bürger den Heldentod
Die Opfer der Gemeinde Ohle im 1. Weltkrieg 1914 bis 1918
Die Opfer der Gemeinde Ohle im 2. Weltkrieg 1939 bis 1945
1939
|