|
400 Jahre Evangelische Kirchengemeinde in Plettenberg
Quelle: Festschrift 1555 -1955 Evangelische Kirchengemeinde
Plettenberg i. Westf., Hrsg.: Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde, 55 S.
DIE EINFÜHRUNG DER REFORMATION IN PLETTENBERG Man schrieb das Jahr 1555. Die Heuernte war einigermaßen ausgefallen, und das Getreide stand gut im Halm. Das wußten nicht nur die Ackerbürger der Stadt und die Amtseingesessenen des ganzen Plettenberger Kirchspiels, sondern ebenso gut der Amtsdroste von Plettenberg und der Junker Joist Schade, die - vor allem aber der letztgenannte - ihre Bediensteten und deren Frauen in die zehntbaren Gärten und Felder der Bürger und Amtsleute schickten, um die Höhe des voraussichtlichen Ertrages auszuspionieren, damit an ihrem Zehntgewinn nichts "verdunkelt" würde. |
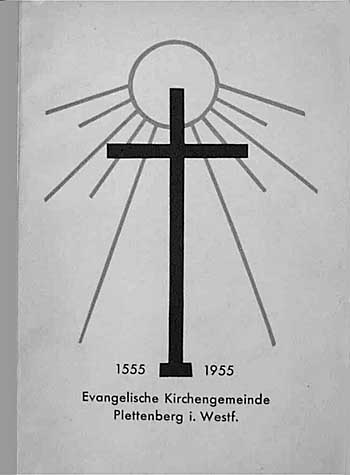
|
|
Es war darum nur zu verständlich, daß sich bei solchem Gebahren manche Faust in der Tasche ballte, zumal man wußte, daß
die Zehntherren, vor allem aber der Junker Schade, Schwiegersohn des Ritters Hermann von Cobbenrodt und Besitzer des
adligen Hauses Cobbenrodt, im Nehmen sehr rigiros waren, dagegen den schuldigen Zehntzins an den Zehntbesitzer, das
Kapitel St. Andreas zu Köln, nur säumig oder oft überhaupt nicht ablieferten und sich häufig weigerten, die schuldige
Rechnung diesem Stift gegenüber abzulegen.
Seit uralter Zeit hatten die Bewohner des Plettenberger Kirchspiels enge Bindungen, vor allem kirchlicher Art, die vorwiegend
in der Zahlung hoher Abgaben ihren Niederschlag finden. Als Hauptempfänger der Abgaben traten auf: der kurkölnische Hof,
die Stifte St. Andreas und St. Severin zu Köln. Weitere Abgabenempfänger waren die Stifte Meschede und Oedingen, die
Klöster Grafschaft und Oelinghausen. Fast alle Bürgerhäuser und Höfe der Amtseingesessenen waren mit ihrem Zubehör
diesen Stellen gegenüber zehntpflichtig, in den meisten Fällen aber gegenüber Köln. Und gerade das Kölner St. Andreasstift,
das den größten Anteil im Plettenberger Kirchspiel hatte, bediente sich beim Einzug des Zehnten in Form von Getreide,
Früchten, Vieh, Geld usw. eines solchen Subjektes wie des obengenannten Junkers Schade, der eigentlich Drost zu Kuglenberg
war, über seine Frau in den Besitz des Hauses Cobbenrodt mit allen Liegenschaften und Gerechtsamen kam und sich meist nur
in Plettenberg aufhielt, um die Zehntabrechnung mit den Bürgern und Amtsleuten vorzunehmen.
Und nun war wieder Erntezeit, und der Junker befand sich im alten Steinhoff, dem nach den späteren Besitzern genannten Haus
Cobbenrodt.
Aber noch ein anderer Umstand hatte in diesem Jahr besonders die Gemüter in Bewegung versetzt. Luthers Reformation hatte
mächtige Wellen in den südlichen Teil der Grafschaft Mark geworfen. In den märkischen Nachbarstädten Iserlohn, Lüdenscheid
und Altena sowie im nahen Valbert, hatte die Reformation längst Einzug gehalten. In Herscheid und Halver regte sich seit
einiger Zeit reformatorischer Geist. Auch in Plettenberg hatte bereits ein Umbruchsprozeß eingesetzt. Verfechter der neuen
Lehre war hier der Pastor Goddert Klouver (Klöver), Sohn des Plettenberger Bürgers Johannes Klouver, dessen Eifer in den
letzten Jahren zu heftigem Meinungsstreit innerhalb des Rates der Stadt und zwischen Bürgermeister und Rat auf der einen und
der Bürgerschaft auf der anderen Seite geführt hatte.
Konnte man noch bis Anfang dieses Jahrhunderts von einer tiefverwurzelten Volksfrömmigkeit sprechen, die gerade im
Plettenberger Raum zu einer besonderen Entfaltung kam und sich in einer Fülle von Kapellen- und Altarstiftungen offenbarte,
so waren auch hier die engen Bindungen der an sich konservativen einheimischen Bevölkerung zu ihrer Geistlichkeit infolge
der in den letzten Jahren offensichtlicher gewordenen üblichen Fäulniserscheinungen im Gefüge der mittelalterlichen Kirche
bedeutend lockerer geworden. Die Stellung der Geistlichen war erschwert. Die Pastorats- und Vikarieeinkünfte gingen schleppender
ein. Teilweise wurden sie überhaupt verweigert. Durch Veräußerung und Tausch von kirchlichen Liegenschaften durch einen
Teil der Kirchspieleingesessenen waren die Einkünfte "cerdunkelt" und wesentlich geschmälert worden.
Daran hatten weder die Bemühungen der kaiserlichen Obrigkeit um die Bereinigung der Streitpunkte innerhalb der Kirche und um
die Wiederherstellung der kanonischen Ordnung im allgemeinen, noch die Vorstellungen der Pletenberger Geistlichen beim
damaligen herzoglichen Richter in Plettenberg etwas ändern können. Bei der schwankenden Haltung des Landesherrn trat der
Plettenberger Richter wohl nur vermittelnd, vermutlich aber nicht entscheidend ein. So hatten die Dinge kaum gehindert ihren
Lauf genommen, im eigentlichen Sinne als eine Angelegenheit der bürgerlichen Gemeinde.
Entscheidend für den Fortgang dieser Entwicklung in Plettenberg wurde dann im Frühherbst dieses Jahres (1755) die Haltung der
Kölner Stiftsherren von St. Andreas, die beim raschen Fortschreiten der Reformation im märkischen Sauerland um den
Weiterbestand ihrer umfangreichen Rechte an dem Plettenberger Zehnten bangten und schließlich geneigt waren, diese so
günstig wie möglich abzutreten. Von welcher Seite nun der erste Anstoß hierzu kam, ist nicht mehr festzustellen. Jedenfalls
stand die Bürgerschaft, vertreten durch ihre Bürgermeister und Rat, mit den Kölner Stiftsherren wegen des Verkaufs des
Plettenberger Zehnten an die Stadt Plettenberg in Verbindung.
Nachdem sich schließlich Bürgermeister und Rat von der gesamten Bürgerschaft
Vollmacht hatten übertragen lassen, wurde der Kaufvertrag im Kapitel St. Andreas
besiegelt. Ein großes Ereignis in der Geschichte der Stadt von enormer Tragweite
war geschehen, freudig begrüßt und gefeiert von der gesamten Bürgerschaft und
den Amtseingesessenen. Von der Rathaustreppe wurde der Wortlaut des Vertrages
den Bürgern kundgegeben.
Zwar war das Opfer, das die Stadt infolge des Zehntkaufs bringen musste, außerordentlich
groß, und es mussten fremde Gelder zur Aufbringung des Kaufschillings herangezogen
werden,. Allein, die Tatsache, für immer aus der Kölner Abhängigkeit befreit zu
sein, wog diese Opfer auf und leitete die letzte Phase des Umbruchprozesses ein
und beeinflusste diese entscheidend. Ebenso entscheidend war das Zustandekommen
des Augsburger Religionsfriedens, dem der Landesherr zugeneigt war und sich diesem
schließlich anschloss.
Alle diese Faktoren waren dem Fortgang der Reformation so dienlich, dass diese
bereits nach wenigen Monaten als restlos durchgeführt galt. Die Bürgerliche
Gemeinde war Verwalter des kirchlichen Vermögens geworden. Nachdem die hier seit
vielen Jahrzehnten bestehenden Bruderschaften aufgelöst worden waren, ließ der
Magistrat einen Teil der geistlichen Stellen eingehen. Schon im Frühjahr 1556
waren die hier existierenden Bruderschaften aufgelöst. Gleichzeitig ließ man einen
Teil der geistlichen Stellen eingehen, und zwar solche der auswärts wohnenden
Vikare. Alle Einkünfte der Vikarie B. Mariae Virginis wurden vom Magistrat der
Stadt dem Schulvermögen zugelegt, um damit dem Schulwesen besondere Förderung
angedeihen zu lassen.
Abgesehen von der Abschaffung des Meßkanons und der Heiligenanrufung sowie der
Einführung der lutherischen Gesänge hatte sich an der Form des Gottesdienstes
nichts geändert. Auch äußerlich war eine Veränderung nicht bemerkbar. Der Hochaltar
und die Seitenaltäre, selbst das Meßglöcklein, blieben an ihrem alten Platz. Es
gab keine Bilderstürmerei, wie sie anderswo hervortrat. Weil die ganze Gemeinde
zur evangelischen Lehre übergetreten war, blieb sie von inneren Zwistigkeiten,
wenigstens in der letzten Zeit, verschont.
Unsere Christuskirche |
|
Die lutherischen Pfarrer 1555-1558 Raymund Palsoel 1558-1561 G. Klöver (zuvor Vikar) 1561-1580 Peter Stöter 1580-1599 Hermann Dübbe 1599-1609 Heinrich Huetband 1609-1653 H. B. Dübbe 1654-1691 Christoph Dübbe 1691-1707 H. E. Brockhaus 1707-1720 C. Hammerschmidt 1708-1735 J. W. Thöne 1723-1725 G. L. Brockhaus 1725-1783 J. P. Reininghaus 1738-1760 J. W. Lange 1762-1800 G. H. Möller 1784-1803 J. C. D. Dümpelmann 1801-1807 J. Fr. A. Kleinschmidt 1803-1809 G. H. C. Boden 1807-1828 J. P. Schlieper |
Die reformierten Pfarrer 1626-1656 Caspar Dübbe 1657-1677 Wilhelm Homberg 1677-1682 J. A. Pavenstedt 1682-1695 Konrad Beckhaus 1695-1710 Hermann Mintert 1711-1722 Diedrich Homberg 1722-1747 Peter Volkmann 1748-1805 C. C. Volkmann 1798-1803 Friedrich Ehrenberg 1805-1845 J. K. Paffrath 1845-1867 K. E. Paffrath
|
|
1829-1876 K. F. W. Schirmer 1867-1877 Friedrich Poetter 1876-1921 Hermann Klein 1878-1888 August Oetting 1889-1917 Eduard Ebbinghaus 1908-1915 Fritz Oetting 1916-1935 Kurt Müller |
1918-1922 Gottfried Röttgen 1922-1934 Otto Klein 1924-1945 Fritz Maas 1936-1945 Georg Benz 1938-1945 Karl Sandmann 1946-1953 Otto Grünberg
|
|
Von 1934-1945 halfen noch folgende Pastoren und Hilfsprediger: Albers, von Stockum, Nockemann, Baberg, Boche,
Stockamp, Clausen, Lohmann, Becker, Stolzenwald. (im Jubiläumsjahr 1955 sind Pastoren: W. Knippschild, Hans Oestreicher, Dr. G. Litschel)
58849 Herscheid, Tel.: 02357/903090, E-Mail: webmaster@plbg.de |